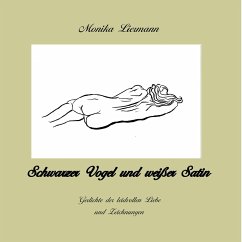Der Pianist als Dichter: Mit seinen komischen und grotesken Versen baut Alfred Brendel eine luftige Brücke zwischen Sinn und Unsinn. So wird bei ihm Beethoven (der, was auch ziemlich unbekannt ist, ein Neger war) als Mörder von Mozart entlarvt oder die bewegende Frage erörtert, was geschah, als Brahms sich in den Finger geschnitten hatte. In Brendels Gedichten - von denen sämtliche in diesem Band versammelt sind - kommt alles und jeder zur Sprache, sogar ein Speckschwein, das am Telefon grunzend seine Lebensgeschichte erzählt.

Kaustischer Witz, Spukbilder der Albernheit: Die Gedichte des Pianisten Alfred Brendel
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts komponierte Gustav Mahler sein merkwürdigstes Werk, die IV. Symphonie. Ihr Finale beschwört ein Himmelreich, in dem unter Aufsicht des „Metzgers Herodes” ein „unschuldig’s, geduldig’s, ein liebliches Lämmlein zu Tod” geführt wird. Mahler, der bei Nietzsche vom Tode Gottes gelesen hatte, war dahinter gekommen, dass es Beunruhigenderes gibt als den Gedanken, Gott ‚existiere nicht‘ – saubere Lösung verständiger Denkbeamter, die das Klappen von Aktendeckeln selig macht, zwischen denen erledigte Fälle ruhen. Wahrhaft verstörend wirkt demgegenüber bei Mahler die in Schwärze verhüllendes Licht getauchte Vision eines Himmels, in dem es just so absurd und brutal zugeht wie hienieden. Mahlers heiterstes Werk ist sein traurigstes.
Seit Mahler, zu dessen Zeiten sich immerhin noch mancher daran stieß, die ‚Existenz‘ Gottes in Abrede gestellt zu sehen, ist der atheistische Gedanke vollends stumpf geworden. Nicht, dass er darum unwahr sein müsste; angekränkelt sein mag der Gedanke eher davon, dass er gleichsam schon zu lange wahr ist. Denn die langen und zu langen Wahrheiten werden selbstzufrieden, träge und muffig. Wer jetzt noch als Künstler kein frommer Mann sein möchte, hat der Sache eine andere Wendung zu geben. Der Geist, der wühlt, hat nicht allein die Kruzifixe und Buddhas ins Rutschen zu bringen, sondern auch sich selbst.
Er muss fähig sein zur Subversion eines saturierten und darüber dumm gewordenen Atheismus, ohne auf den faulen Ausweg zu verfallen, den Leuten wieder die alten Gewissheiten unterzujubeln. Es ist diese entschiedene Unentschiedenheit, die Alfred Brendel in seinem neuen Gedichtband Spiegelbild und schwarzer Spuk wagt: „Es gibt uns / Das ist immerhin etwas / Wir fassen uns an / Nase Mund und Kinn / Keine Frage / wir sind vorhanden / Nun noch den Hosenschlitz / hier zu zweifeln wäre glatter Wahn / Hingegen Engel und Teufel / die gibt es auf gar keinen Fall / Wir Erwachsenen wissen dies / Den Weltenlenker / das Rumpelstilzchen / die ganze Götter- und Geisterbrut / davon kann doch bei klarem Verstand / nicht die Rede sein / Eigentlich ein starkes Stück / uns so auf dem Trockenen / sitzen zu lassen / mit uns selbst”.
Lieber Gott, böse Blicke
Mit durch Skepsis gebrochenen Blicken in diverse Gefilde der Seligen, Mahlers teils trügerisches, teils als Trug kenntlich gemachtes Idyll radikalisierend, eröffnet Brendel den Band. An den religiösen Bildern treibt er eine Bizarrerie hervor, von welcher der Leser nur verblüfft bemerken kann, dass sie ihnen immer schon innewohnte. Was sich als ‚höher denn alle menschliche Vernunft’ nahm, erscheint aus Brendels verfremdenden Blickwinkeln grotesk und mehr als einmal auch komisch. Es ergeht dem lieben Gott unter ihnen gerade so, wie Brendel des Allmächtigen Schicksal in der Kunst jener „Kleinmaler” beschreibt, bei denen er, wie die Rede geht, „im Detail wohnt”: „Nicht auszudenken / wie Gott aus den Details / in denen er steckt /jemals wieder herausfinden soll”.
Nicht Gott allein freilich widerfährt solches, sondern auch dem, wie Brendel aufgegangen ist, längst zum lauen Dauerbrenner des Kulturbetriebs abgesunkenen Tode Gottes; ihm hat der Autor am Ende des Abschnitts über „Götter und Monstren” eine (dem Sachverhalt angemessen makabre) Eventkritik in des Wortes voller, schauerlicher Bedeutung gewidmet, die definitiv sein dürfte.
Was aus Kultur wird, wo sie Betrieb ist, weiß Brendel, der vielleicht erfolgreichste Pianist seiner Generation, von innen. Der Musikmarkt vergleicht, was er im selben Atemzug als unvergleichlich ausschreit, und wechselt aus, was er als unersetzlich bewirbt. Das bemerkt auch der Außenstehende. Doch erst aus Brendels Innenschau erhalten Bilder wie das des Beschenktwerdens mit einem Klon auf offener Bühne oder des Schrumpfens eines erwachsenen Künstlers zum Wunderkind ihre alpdruckhafte Gewalt. Vielleicht unvermutet hat Brendel aber auch entdeckt, was vom Alpdruck befreit, nämlich weder der liebe Gott noch die Revolution noch Psychotherapie, sondern, wenn es denn mit einem Wort zu benennen wäre: Quatsch.
In ihm findet Brendels an Swift, Lichtenberg und Canetti geschulter kaustischer Witz ganz zu sich selbst. Die Kraft der Albernheit, in der Literatur seit Dada meist durchs Schielen auf ein Wogegen vorwiegend zu Krampf verurteilt, entfaltet sich in Brendels Gedichten zu schönster Verspieltheit. Dass sie in dieser harmlos werden müsse, kann nur wähnen, wer meinte, Spielen sei als solches harmlos – worüber, nebenbei, bereits der Pianist Brendel seit einigen Jahrzehnten eines Besseren belehrt. Für Albernheit freilich lässt das klassische Repertoire, dem sich der Musiker Brendel widmet, wenig Raum; doch wer in seinen literarischen Mephisto-Walzern darum das bloßeAblassen im Hauptberuf unterdrückter Energien vermutete, unterschätzte sie. Wie Brendels ebenso abgründiger wie surrealer Humor den ersten und letzten Dingen, Religion, Kunst und Liebe, auf den Leib rückt, ist keinen Moment lang abzutun als kompensatorisch luxurierende Spitzbüberei einer in Ehren ergrauten Eminenz des Wahren, Guten und Schönen.
Allerdings gilt es zu verdauen, dass ein Musiker, welcher den Werken der Wiener Klassik in so unvergleichlichem interpretatorischem Respekt begegnet, seine Leser, sobald er Gedichte schreibt, die in Wahrheit Aphorismen und intellektuelle Vexierbilder sind, dazu anhält, den „altersblöden Haydn / im Jenseits / seine leeren Augenhöhlen / zum Himmel aufschlagen” zu sehen, und Ironisches notiert von „Symphonien mit Schlußchor / da weiß er wo Gott wohnt”.
Doch die Einheit beider Momente liegt gerade in ihrer Paradoxie: erst der Respekt desjenigen zählt ohne Abzug, der des respektlosen Gedankens mächtig ist. Der Skeptiker ist der gründlichere Verehrer. Wer stattdessen nachlesen will, dass ein Mensch, der die Kunst liebt, ein edles Herz haben muss, mag mit den Memoiren Yehudi Menuhins aufs Angenehmere bedient sein. Brendel schult den bösen Blick, der sich lachenden Auges selbst zu sehen weiß. Im Spuk, nirgends sonst, erscheint das Spiegelbild.
ANDREAS DORSCHEL
ALFRED BRENDEL: Spiegelbild und schwarzer Spuk. Gesammelte und neue Gedichte. Carl Hanser Verlag, München 2003. 288 Seiten, 19,90 Euro.
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.diz-muenchen.de

Das schwarze Gelächter des Lyrikers Alfred Brendel
Daß es Teufel / im Grunde gar nicht gibt / hat uns kürzlich / der Leibhaftige selbst verraten / Wir haben dies / betrübt zur Kenntnis genommen / und beschlossen / in Zukunft / uns selbst an die Wand zu malen." Musik sei eine heilige Kunst, heißt es, uns läutern und erheben soll sie, auf daß die Tonkunst bessere Menschen generiere. Und alle platonische Musikästhetik und -erziehung, ganz zu schweigen von der Musiktherapie, geht davon aus, daß im Reich der Töne das, gar der Böse keine Chance habe: Musik mache eben einfach nur gut. Musiker selber freilich sind davon schon weit weniger überzeugt, so roh, ungebildet, wenn nicht bösartig können sie sein. Und haftete nicht Paganini Schwefelgeruch an, beschworen nicht Berlioz und Liszt, auch Busoni immer wieder Höllisches, zumindest entsprechend Schwieriges, auf jeden Fall Mephistophelisches, kultivierten nicht Skrjabin und Prokofjew Satanisch-Diabolisches und Ligeti wie Kagel Teufeleien sinisterster Art? Nicht nur als Pianist ist Alfred Brendel demnach bei Beelzebub in bester Gesellschaft, auch der Geist, der stets verneint, fühlt sich in seiner allernächsten Nähe pudelwohl.
Und so gewiß der scharfsinnige musikalische Analytiker und textkritische Philologe weiß, daß der Teufel im Detail steckt, so bereitwillig gewährt er den großen und vor allem kleinen Höllenkerlen in seinen Gedichten Raum - doch stets auf des schmalsten Messers Schneide zwischen Glaube und Unglaube. Der eingangs zitierte selbstverfertigt-selbstreferentielle Teufelsbeweis ist ein schönes Beispiel solch wahrhaft diabolischer Verunsicherungslogik. Und wer weiß: Wenn Brendel Beethovens Diabelli-Variationen einmal das größte Klavierwerk überhaupt nannte - ob da nicht auch ein klitzekleiner sprachspielerischer Anklang ans Finsternis-Blendwerk mit im Spiel war? Das "Wörterbuch des Teufels" von Ambrose Bierce jedenfalls kommt einem bei Brendels lyrischen Diablerien schon in den Sinn: "Satanische Verse", einmal anders.
Mit dem Lutherischen "Und wenn die Welt voll Teufel wär'" hält es Brendel indes kaum. Zu seiner skurrilen Diabologie gehört nämlich nicht minder die Anglologie - wobei ihm das nächtliche Reich als Literaturverweis auf Mario Praz' "Liebe, Tod und Teufel" anscheinend lieber ist als die Engel-Affirmationen von Peter Handke oder Wim Wenders: "Nur bei den Raffael-Englein bitten wir um Milde / eigenhändig hat Mamà / sie übers Bett genagelt." Brendels Umgang mit den Helfern aller Frommen hat also durchaus sein Frivoles. Sarkastisch, zumindest zynisch jedoch ist er nicht, zu sehr liebt er das Zwischenreich, wo Glaube und Unglaube ineinander changieren. Zumal für einen Musiker ist dies nicht unverständlich. Denn bei aller Skepsis gegenüber wundergläubiger Transzendenz-Versessenheit gehört es doch zu den Mirakel-Phänomenen, wie aus dem schlichten zweidimensionalen Zeichensystem der Notenschrift und einem mechanisch-akustischen Gerät wie dem Klavier das Sublimste und Spirituellste, eben große Musik, erwachsen kann. Aber mit dem plakativen Vertrauen ins schlechthin "Höhere" hat es Brendel nicht. Eher fürchtet er, daß die Engel überhandnehmen, zu einer Art höherer Kaninchenplage ausufern. Da wird er zum schrulligen Schabernack-Scholastiker der Engels- wie Teufelsbeweise - etwa nach der Devise: "Ich glaub' zwar nicht an Hexen - aber geben tut sie's doch." Gerade in latenter Scheiterhaufen-Nähe sind Brendel immer wieder hübsch schräge Katastrophen-Kabinettstücke gelungen.
Vielleicht muß man gerade höchster Versenkung in die Mysterien Mozarts, Beethovens oder Schuberts fähig sein, um sich mit solcher Lust mitunter wahrhaft riesigen Lachbagatellen hingeben zu können. Dabei kann Brendel auch böse sein, und die fremdenfeindlichen Tiraden der österreichischen Jörg-Haider-Welt kriegen durchaus ihr Fett weg, auch wenn die manisch austriaphobische Verbitterung Thomas Bernhards seine Sache nicht ist. Auf den "schwarzen" Wiener Ton, das süße Gift heimatlicher Heimtücke, versteht er sich schon, nur vermag er den Ingrimm immer noch mit understatement zu relativieren: Ganz unbeeinflußt vom schwarzen britischen Humor ist der Wahl-Londoner keineswegs. Und vielleicht schärft die gelegentliche Heimkehr aus der Fremde in die Fremde das Ohr besonders für die Hinterhältigkeiten echt wienerischer Gemütskünstler. Denn daß es nicht Salieri war, der den Götterliebling Mozart giftmeuchelte, ist nun seit Brendel endgültig bewiesen. Beethoven nämlich war der Unhold, und nicht nur das: Ein Neger war er überdies. Und höchstwahrscheinlich war es Mozarts halblaute Bemerkung zu Süßmayr nach einem Beethovenschen Klaviervortrag: "Für an Nega spülta netamoi schlecht", die den vor Eifersucht rasenden c-Moll-Versessenen zu der Untat animierte.
Am schönsten sind Brendels Sprach-Capriccios in ihrer perfekt scheinlogischen Lakonik: "Als Einstein / im Himmel angelangt / sah / daß Gott würfelte / drehte er sich um / und sagte / Wo geht's hier zur Hölle." Im kaleidoskopischen Absurdistan fühlt er sich besonders wohl, und wo er Literatur, Kunst und Musik in grotesken Anspielungen zur Verflüchtigung bringen kann, da tönt sein schwarzes Gelächter besonders hell. Brendels Gedichte sind Finger-Denk-Zeige eines Pianisten, der nichts so sehr haßt wie das schlichte Schwarz-Weiß. Daß die Klaviertastatur diesem Schema entspricht, muß er allerdings billigend in Kauf nehmen.
Alfred Brendel: "Spiegelbild und schwarzer Spuk". Gesammelte und neue Gedichte. Hanser Verlag, München 2003. 287 S., zahlr. Abb., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Von diesem Band mit Gedichten des Pianisten Alfred Brendel aus den vergangenen zehn Jahren scheint Michael Braun ziemlich begeistert zu sein. Er stellt fest, dass Brendel in seinen Arbeiten auf eine in der "Moderne wenig genutzte" lyrische Gattung zurückgreift, nämlich auf den "komödiantischen Vers". Die Gedichte sind von seltsamen Tieren wie dem "Speckschwein", einem Dromedar mit Dackelbeinen oder einem "schnarchenden Hund", aber auch "Klavierteufeln", Engeln und Gespenstern belebt, so der Rezensent amüsiert. Er stellt fest, dass Brendel kein Interesse an "spracheexperimentellen Konstruktionen" hat, sondern unverdrossen dem Wortwitz, dem Kalauer und der Anarchie huldigt, wobei er die "Lesbarkeit" seiner Gedichte "nicht als Skandal empfindet", wie der Rezensent eingenommen betont.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Kaustischer Witz, Spukbilder der Albernheit: Die Gedichte des Pianisten Alfred Brendel." Andreas Dorschel, Süddeutsche Zeitung, 15.01.04
"Sprach-Capriccios in einer perfekt scheinlogischen Lakonik." Gerhard. R. Koch, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10.01.04
"Der Autodidakt zündet ein Feuerwerk an skurrilen Absonderlichkeiten, denen eines gemeinsam ist: Sie treffen immer ins Schwarze." Hilmar Bahr, Frankfurter Neue Presse, 05.02.04
"Kein Zweifel, der Pianist Brendel hat nicht nur Töne, sondern auch Sprache und vor allem Humor. Manchmal beisst dieser hinterlistig, wie Emil, wenn er hungrig die Zähne ins Dichtermark schlägt. Manchmal lächelt er auch nur verschlagen engelhaft und teuflisch." Der Bund, 17.04.04
"Sprach-Capriccios in einer perfekt scheinlogischen Lakonik." Gerhard. R. Koch, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10.01.04
"Der Autodidakt zündet ein Feuerwerk an skurrilen Absonderlichkeiten, denen eines gemeinsam ist: Sie treffen immer ins Schwarze." Hilmar Bahr, Frankfurter Neue Presse, 05.02.04
"Kein Zweifel, der Pianist Brendel hat nicht nur Töne, sondern auch Sprache und vor allem Humor. Manchmal beisst dieser hinterlistig, wie Emil, wenn er hungrig die Zähne ins Dichtermark schlägt. Manchmal lächelt er auch nur verschlagen engelhaft und teuflisch." Der Bund, 17.04.04