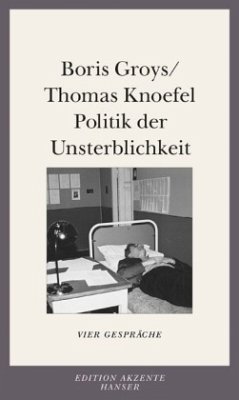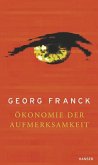Spätestens seit seinem großen Essay Über das Neue zählt Boris Groys zu den meistdiskutierten Autoren der zeitgenössischen Kunst und Philosophie. Seine Bücher handeln von Fragen der Medientheorie, der Ökonomie und der Ästhetik genauso wie von Problemen des Totalitarismus oder der Religion und sind das Ergebnis einer intellektuellen Experimentierlust, wie man sie nur selten in theoretischen Debatten erleben kann. Ganz unmittelbar lässt sich dieser Denkstil in vier ausführlichen Gesprächen mit Thomas Knoefel nachvollziehen. Sie verknüpfen zentrale Begriffe von Groys' Denken: das Begehren, der Verdacht, der Tod und die Macht. So werden nicht nur versteckte Bezüge zwischen Groys' bisherigen Arbeiten sichtbar, vielmehr zeichnet sich auch der intellektuelle Horizont ab, auf den sich sein Denken in den unterschiedlichsten Richtungen zubewegt.

Boris Groys genießt die
trägen Freuden der Unsterblichkeit
Schon die antike Mythologie hatte ihren Helden den Weg zur Unsterblichkeit nicht einfach gemacht. Gemessen an den zwölf Arbeiten des Herakles mag es eine leichte Übung sein, sich zu verewigen, indem man etwa ein Urinoir ins Museum stellt. Doch nur in wenigen glücklichen Momenten, analysiert der Kunsttheoretiker Boris Groys, gab es die Chance, Kultur „ohne Schweißgeruch” zu erzeugen – das Athen zu Diogenes Zeiten etwa, als es ausreichte, am hellen Tage mit einer Laterne auf den Marktplatz zu treten, um Menschen zu suchen. Der Rest ist Arbeit: „Ich fühle mich schon gar nicht mehr als Intellektueller”, so Groys, „ich fühle mich wie ein Arbeiter aus dem neunzehnten Jahrhundert. Denn was ich tatsächlich tue ... ich schreibe, ich tippe. Ich produziere Buchstaben, Stunden um Stunden.” Wer also unsterblich werden möchte, arbeitet schon zu Lebzeiten an seinem Grabmal: „Die Bücher sind die Grabkammern des Philosophen – oder vielmehr ihre Mumien.”
Wozu der Aufwand? Aus welchem Antrieb entstehen kulturelle Leistungen? Groys grenzt sich polemisch – und argumentativ nicht sonderlich ausgeführt – gegen soziologische oder rezeptionsästhetische Theorien ab, um Kunst aus allen Bezügen der Produktion und Rezeption zu lösen, die sie in ihrer Zeit oder in Hinsicht auf ihr Publikum verstehen wollen. Kunst entsteht, so die These, wo andere Gewissheiten auf das Erreichen von Dauer versagen, dann etwa, „wenn man nicht ernsthaft an eine außerkulturelle, außergeschichtliche, ontologische Garantie der Unsterblichkeit glaubt ... Wer aber in Bezug auf die ontologische Garantie der Unsterblichkeit zum Skeptizismus neigt und trotzdem für die Unsterblichkeit optiert, der beginnt, die Politik der Unsterblichkeit oder zumindest die Politik der langen Dauer zu praktizieren.” Der beginnt, mit anderen Worten, selbst an einer „künstlichen, artifiziellen Unsterblichkeit” zu arbeiten.
Konsequenterweise können nicht die Zeitgenossen den Maßstab für gelungene Kunst abgeben; die eigentlich kulturelle Instanz sind die Toten: „Als Philosophen oder als Künstler stehen wir vor allem im Wettbewerb mit den Toten. Im Grunde wollen wir, dass Hegel oder Kant uns lesen und sagen: Auf diese Idee bin ich nicht gekommen, wie wunderbar hast du das gemacht. Unsere eigentlichen Leser sind die Toten.”
Nur das erste der vier in dem Band zusammengefassten Gespräche konzentriert sich unter der Überschrift „Der Leichnam des Philosophen” auf Anmerkungen zu einer sich in Umrissen abzeichnenden Metaphysik der Kunst. Die übrigen Gespräche streifen im Plauderton von der Theorie der russischen Avantgarde aus dem frühen „Gesamtkunstwerk Stalin” bis zu den medientheoretischen Überlegungen aus „Unter Verdacht” Groys’ Lesern bekannte Motive. Dazwischen finden sich Aperçus wie das von Hitler und Stalin als „Dekonstruktivisten an der Macht” oder zu einer „genetischen Avantgarde”, die uns möglicherweise in der Zukunft zu „interessanteren Körpern” verhelfen werde – gesprochen, wie uns der Herausgeber versichert, mit einem „nach innen gerichteten Lachen”.
Hinter dem Porträt des Intellektuellen als Arbeiter wird man sich Boris Groys also als einen durchaus entspannten Menschen vorstellen dürfen: „Was ich unter Genuss verstehe, ist die Möglichkeit, nachdem man sein Grab gebaut hat, darin ruhig zu liegen und dieses Grab zu genießen, noch bevor man tot ist. Dann tritt eine gewisse Entspannung ein, die Bereitschaft zur ungezwungenen Plauderei – eben ein bisschen angenehmes Leben im Tode. Die Grabstätte ist da, man ist schon begraben, aber lebt noch und genießt diese Zeit.”
SONJA ASAL
BORIS GROYS: Politik der Unsterblichkeit. Vier Gespräche mit Thomas Knoefel. Hanser Verlag, München 2002. 208 Seiten, 14,90 Euro.
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.diz-muenchen.de

Boris Groys liegt auf dem Ofen und erwartet, widerlegt zu werden
Das kann er doch nicht ernsthaft vertreten. Der titelgebenden These zufolge ist Philosophieren Streben nach Unsterblichkeit durch Selbstpositionierung im philosophischen Feld. "Im Grunde wollen wir, daß Hegel oder Kant uns lesen und sagen: Auf diese Idee bin ich nicht gekommen. Unsere eigentlichen Leser sind die Toten." Wohl betreibt Groys keine psycho- oder soziologistische Reduktion, es geht ja weder um Interessen hinter dem Autor noch um Erfolg beim gegenwärtigen Publikum. Auch das weite, der Kunst angenäherte Verständnis von Philosophie läßt sich verteidigen, insofern es Diogenes' Tonne und die aufgelöste Verlobung Kierkegaards als "Readymades" in den Raum des Argumentierens hereinzuholen erlaubt.
Aber daß wir über der aristotelischen Metaphysik uns die Haare raufen: "Gerade hatte ich dasselbe sagen wollen" - auf die Idee muß man erst einmal kommen. Vorab stellen wir uns den Autor kaum als Individuum vor, mit dem wir debattieren könnten. Wie sonst könnten wir "Sein und Zeit" oder den "Tractatus" studieren, obwohl ihre Verfasser sie bald für überwunden hielten. Auch sind gute Gedanken keine knappe Ressource. Im Gegenteil, je mehr ich lese, um so mehr fällt mir ein. Vor allem aber fehlt in der Überlegung der Bezug auf Wahrheit, die Groys in der Schrumpfform des "gut gemacht" immerhin kennt. Wir lesen ein Buch, weil wir aus ihm etwas lernen, weil es uns etwas zeigt. Und wir schreiben ein Buch, um uns etwas klarzumachen, was wir beim Lesen anderer Bücher nicht verstanden haben. Dabei hoffen wir auf zustimmende Leser oder fragen uns, was andere Autoren einzuwenden hätten, aber nur um uns zu vergewissern, daß wir nicht ins Blaue hinein gedacht haben. Als was wollten wir denn überhaupt von den Toten anerkannt werden, wenn nicht als Autor kluger Einsichten?
"Mir ist die Forderung verdächtig, die eigenen Theorien auf einen selbst anzuwenden." "Wenn ich andere beschreibe - warum soll ich mich selbst mit den gleichen Mitteln beschreiben?" In der Tat, wenige Sätze sind so oft und offenbar falsch wie Sätze des Typs "Ich bin ja jemand, der . . .". So wird man Groys die Selbstbeschreibung als fauler Russe, der am liebsten auf dem Ofen liegt und nur über Dostojewski, Stalin und die russische Avantgarde schreibt, weil das gut ankommt, kaum durchgehen lassen. Treffender wäre vielleicht das von ihm nicht zitierte Klischee des Russen, der sich unsterblich langweilt: Die Welt sei voller Wahrheiten und wunderbarer Projekte, die allesamt aber den Nachteil haben, daß sie einem ziemlich auf die Nerven gehen.
"Es passieren immer wieder unglaubliche Dinge - nur interessiert mich das alles, offen gesagt, nicht besonders. Mich interessieren die Beschreibungen des Raumes und die Strategien der Spieler, aber nicht das, was von ihnen jeweils geleistet wird. Wenn die Philosophie eine Lebensform und ein Wettbewerb ist, dann bedeutet die philosophische Haltung in bezug auf diesen Wettbewerb die Nichtteilnahme an diesem Wettbewerb." Da geht nun deutlich etwas durcheinander. Es gibt viele Wettbewerbe, im Trinken, im Weitspringen, und die Bestergebnisse im einen sind im anderen nichts wert. Auch ist es eine durchaus traditionelle Bestimmung der Philosophie, sich vom Leben zu detachieren und es als reine Form zu untersuchen. Aber der philosophische Wettbewerb ist dann einer um die richtige Beschreibung und nicht um das größte Detachement. Groys will nicht der Desinteressierteste sein, sondern die beste Beschreibung philosophischer Praxis geben. Deshalb muß seine Theorie auch auf ihn selber zutreffen. Er müßte recht darin haben, daß es auf das Rechthaben überhaupt nicht ankommt.
Vielleicht kommt es Groys überhaupt auf etwas ganz anderes an. Sein Stalin-Buch, klagt er, sei völlig mißverstanden worden, als ginge es dort um die Gleichsetzung von Avantgarde und Totalitarismus. Die Unterschiede beider sehe schließlich jeder Esel. Sein eigentliches Interesse habe vielmehr der Lage der späteren Dissidenten gegolten, angesichts der Vermengung der modernistischen mit der offiziellen Sprache über kein Medium der kritischen Abstandnahme mehr zu verfügen. Aber was wissen wir denn heute, "wie vergiftet und verpestet die Luft ist, die das Publikum täglich einatmet"?
Dem dialektischen Zusammenhang von Avantgarde und Stalinismus entsprechend, setzt Groys dann für die Gegenwart einen Zusammenhang von Metaphysik auf der einen und Technik, Ökonomie, Medien auf der anderen Seite. Das Unheilvolle sei nun, daß jeder Metaphysikkritiker doch nur von den toten Metaphysikern als einer der Ihrigen angesehen werden will und daß jede Technikkritik das Vertrauen in die selbstkritische Besonnenheit der Technik verstärkt. "Wenn man wirklich subversiv sein will, muß man einen konsequent affirmativen Diskurs entwickeln, der das latent vorhandene Mißtrauen mobilisiert."
Dies Verfahren hat in der spät- und postsowjetischen Kunst viel Gutes hervorgebracht; und leuchtende Fotos von deutschen Eigenheimsiedlungen und glücklichen Menschen können abgründig aussehen. Es bleibt ein ästhetisches Verfahren, in Theorie kaum umzusetzen. Groys macht einen hilflosen Versuch mit dem Traum, die Eugenik könne endlich den neuen Menschen erschaffen. Das Problem dürfte am Ende sein, daß er den kritisierten Metaphysikkritikern aufsitzt in der Vorstellung, die Metaphysik oder die Technik gäbe es im Singular. Husserl redet zum Teil über dasselbe wie Platon und zum Teil über etwas anderes. Wo er über dasselbe redet, hat er zum Teil dieselbe und zum Teil eine andere Meinung. Und für diese andere Meinung hat er teils gute, teils nicht so gute Gründe. Auf die Sachen und auf die Argumente kommt es an.
Die Haltung, die demgegenüber das Ganze zu ihrer Sache macht, ist in der Tat die Langeweile und die ihr zugehörigen eschatologischen Dämmerträume: "Mir kommt alles vollkommen banal vor." "Es muß doch irgendeine Hoffnung dasein." Was nun nicht heißt, daß dieser Langeweile nicht viele Einsichten zufallen können - zur Alltagskultur, in der alles irgendwie ähnlich ist, weil der erst in Identität und Differenz aufgespannte Raum des Vergleichs fehlt, zu Wittgenstein, der den Weg ins Fliegenglas sucht, zu Derrida, dem Autor von Büchern über den Tod des Autors, oder zu den neuen Russen, die spielen, richtige Kapitalisten zu sein.
GUSTAV FALKE
Boris Groys: "Politik der Unsterblichkeit". Vier Gespräche mit Thomas Knoefel. Edition Akzente. Hanser Verlag, München, Wien 2002. 208 S., br., 14,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Boris Groys ist von Langeweile geplagt - diese These vertritt Gustav Falke in seiner Rezension eines Interview-Bandes mit dem russischen Philosophen. Falke meint, Groys vertrete nahezu provokativ bestimmte Thesen, die nur darauf warteten, widerlegt zu werden. "Das kann er doch nicht ernsthaft so meinen?", fragt der Rezensent wiederholt und angesichts von Groys' Behauptung, "Philosophieren sei Streben nach Unsterblichkeit", da es dem Philosophen doch bloß darauf ankäme, die toten Philosophen zu widerlegen. Überhaupt, findet Falke, gerät Groys allzu viel durcheinander, doch inwiefern Groys' dazu zitierte Textpassage verworren sein soll, wird in Falkes - seinerseits sehr wohl wirren - Ausführungen nicht klar. Fazit des Rezensenten: Es fallen Groys und seiner eschatologischen Langeweileposition auch einige Einsichten zu, die dieses Buch trotz aller Zweifel lesenswert machen, interessante Stellen zu Derrida, zur Alltagskultur, zu Wittgenstein und den neuen Russen, "die spielen, Kapitalisten zu sein".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH