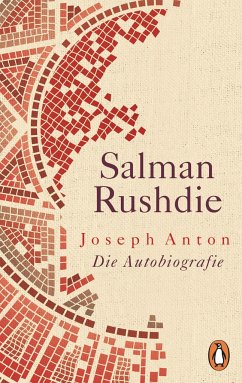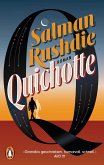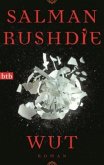"Gerade jetzt muss man Salman Rushdies Autobiografie lesen. Sie lehrt, dass man den Mob widerstehen muss." Welt am Sonntag
Was bedeutet es für einen Schriftsteller, über neun Jahre lang mit einer Morddrohung zu leben? Wie fest hat die Verzweiflung sein Denken und Handeln im Griff? Zum ersten Mal erzählt Salman Rushdie seine beeindruckende Geschichte; es ist die Geschichte eines Kampfes: dem Kampf um die Meinungsfreiheit. Rushdie erzählt vom teils bitteren, teils komischen Leben unter bewaffnetem Polizeischutz; von den engen Beziehungen, die er zu seinen Beschützern knüpfte; von seinem Ringen um Unterstützung und Verständnis bei Regierungen, Verlegern und Schriftstellerkollegen; und davon, wie er seine Freiheit wiedererlangte.
Salman Rushdie erhält den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2023 »für seine Unbeugsamkeit, seine Lebensbejahung und dafür, dass er mit seiner Erzählfreude die Welt bereichert.« (Aus der Begründung der Jury
Was bedeutet es für einen Schriftsteller, über neun Jahre lang mit einer Morddrohung zu leben? Wie fest hat die Verzweiflung sein Denken und Handeln im Griff? Zum ersten Mal erzählt Salman Rushdie seine beeindruckende Geschichte; es ist die Geschichte eines Kampfes: dem Kampf um die Meinungsfreiheit. Rushdie erzählt vom teils bitteren, teils komischen Leben unter bewaffnetem Polizeischutz; von den engen Beziehungen, die er zu seinen Beschützern knüpfte; von seinem Ringen um Unterstützung und Verständnis bei Regierungen, Verlegern und Schriftstellerkollegen; und davon, wie er seine Freiheit wiedererlangte.
Salman Rushdie erhält den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2023 »für seine Unbeugsamkeit, seine Lebensbejahung und dafür, dass er mit seiner Erzählfreude die Welt bereichert.« (Aus der Begründung der Jury
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Schadenfreude bekennt Nils Minkmar nach der Lektüre dieses Buchs: Schadenfreude mit den Islamisten, die Rushdies Kopf nicht bekamen und Rushdies Leben nicht zerstörten, obwohl sie auf dem besten Wege waren und bis heute nicht nachlassen. Dennoch: dass Rushdie dieses Buch schreiben konnte, ist für Minkmar "das schönste Scheitern der Islamisten". Minkmar liest "Joseph Anton" nicht nur als Erinnerung an die dunklen Jahre der Morddrohung: Es ist für ihn ein Panorama unserer Gegenwart, in der sich die Bedrohung des Islamismus immer dunkler über dem Himmel des Westens und seiner Werte zusammenzog. Rushdie selbst erinnert an das Bild der Vögel in Hitchcocks gleichnamigen Film und daran, dass man den ersten Vogel, der sich auf das Klettergerüst bei den spielenden Kindern setzt, erst im Nachhinein als "Vorboten" erkennt. Auch als unbequeme Lektüre schildert Minkmar "Joseph Anton", denn Rushdie scheut sich nicht, all jene namhaft zu machen, die in den Jahren der Fatwa moralisch versagten. Deutsche Politiker gehörten dazu.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Salman Rushdie erzählt in seinen Memoiren „Joseph Anton“ die Geschichte seines Lebens unter der Fatwa:
Er tut es sachlich, beinahe bescheiden und voller Begeisterung für den literarischen Betrieb
VON THOMAS STEINFELD
Zwei Geschichten sind zu erzählen. Die eine ist weltumspannend, kompliziert und grausam, weil sie von religiösem Fanatismus handelt, von Politik und von einem Todesurteil, das gegen einen Schriftsteller vollstreckt werden sollte, irgendwo auf der Welt, weil ihm eines seiner Bücher als Gotteslästerung ausgelegt worden war. Die andere Geschichte ist einfach, viel privater und bei aller Bitterkeit sehr menschlich, weil sie davon erzählt, wie sich dieser Schriftsteller ein Jahrzehnt lang verbergen und vor der Öffentlichkeit hüten musste, wer ihm dabei half und wer ihn dabei im Stich ließ, wohin seine Wege führten und wie er geschützt wurde und wie er dann doch überlebte. Die eine Geschichte rührt an einen der großen Konflikte dieser Zeit, an den islamischen Fundamentalismus und seinen Feldzug gegen alles, was er für blasphemisch halten will. Die andere ist eine Lebens-, Liebes- und Abenteuergeschichte aus der Welt der berühmten Schriftsteller, und wenn der Held auch immer wieder in existenzielle Bedrängnis gerät, so steht er doch am Ende wieder auf einem Trottoir in London, ohne Polizeischutz, und winkt ein Taxi herbei.
Salman Rushdies Buch „Joseph Anton“, am Dienstag dieser Woche in fünfundzwanzig Ländern gleichzeitig erschienen (C. Bertelsmann Verlag, 24,99 Euro), enthält in der deutschen Fassung 720 Seiten und die Geschichte der Jahre, in denen er, nachdem Ayatollah Khomeini im Februar 1989 „sämtliche Muslime“ aufgefordert hatte, ihn hinzurichten, einen falschen Namen tragen, in geheimen Wohnungen leben, unter ständiger Bewachung leben musste. „Die Autobiografie“ heißt dieses Buch im Untertitel. Aber um eine solche zu sein, hätte das Buch aus einer anderen, inneren Perspektive geschrieben sein müssen. Autobiografien erzählen davon, wie einer wurde, was er ist. Das aber tut dieses Buch nicht. Salman Rushdie berichtet stattdessen, was ihm in diesen Jahren widerfuhr, was er tat und was andere taten, wer starb und welche Personenschützer engagiert wurden. Immer wieder bemerkt der Leser, dass ein an den tatsächlichen Ereignissen entlang geführtes Tagebuch diesem Werk zugrundegelegen haben muss. Ein Buch der „Memoiren“ hat Salman Rushdie geschrieben, und dazu gehört, dass die Gesellschaft darin viel wichtiger ist als das „Ich“.
Die Bindung an die Gesellschaft ist der Grund, warum Salman Rushdie von sich selbst in der dritten Person Singular erzählt: „Er“ tat dies, „er“ tat jenes. Selbst die Ausflüge in die Vorgeschichte des Protagonisten, an die Kindheit in Bombay, die Schulzeit an der Rugby School, das Studium in Cambridge, an die Jahre als Werbetexter und scheiternder Literat sind aus der Perspektive des „Er“ geschrieben. Das tut dem Buch gut: Salman Rushdie liefert keine Rechtfertigungen, und er erhöht sich nicht zum Helden demokratischer Tugenden. Er beschwört keine Dialoge, und er führt keine Wertedebatten. Er entpuppt sich als aufmerksamer, redseliger, zuweilen sogar selbstironischer Zeitgenosse, der keine großen Unterschiede zwischen persönlichen, beruflichen und öffentlichen Angelegenheiten macht und die Aufmerksamkeit eines großen Publikums genießt.
Und weil das Buch nicht einmal den Versuch macht, große Dichtung zu sein, funktioniert es gut als Literatur. Der Leser kennt das Kapitel Weltgeschichte, das mit Salman Rushdie verknüpft ist, und wenn der Schriftsteller von diesen zehn Jahren im Ton der Gewöhnlichkeit erzählt, wirkt selbst der gemeinsame Auftritt mit Bono auf einem Konzert der Band „U2“, als wäre da jemand mit einer Sopran-Ukulele unter dem Arm in eine Monstershow geraten – und dabei auf lauter andere Menschen mit Ukulelen unter den Armen gestoßen.
Diese Gewöhnlichkeit ist das Glück des Schriftstellers Salman Rushdie, wobei diese Gewöhnlichkeit zwei Seiten hat: Die eine ist der erstaunliche künstlerische und soziale Aufstieg eines entlaufenen Werbetexters, dessen größtes Verdienst die Erfindung von Wörtern wie „irresistibubble“ für eine mit Luft gefüllte Schokolade war. Die andere ist die Aufnahme in eine Art Weltgesellschaft der berühmten Literaten und ihrer Verbündeten in Politik, Film, Publizistik und Musik. „Gemeinsam mit Andrew und Camie Wylie“ lautet ein Satz, der, mitsamt dem ihm innewohnenden leichten Beben des Stolzes, in diesem Buch in vielen Varianten vorkommt, „fuhren er und Elizabeth in deren Haus in Water Bill auf Long Island, wo Ian McEwan, Martin Amis, David Rieff, Bill Buford und Christopher und Carol Hitchens zu ihnen stießen.“
Diese Weltgesellschaft der Literatur besteht aus vielleicht zwei- oder dreihundert Menschen, deren Namen im sorgfältig geführten Register des Buches verzeichnet sind, und zusammen bilden sie offenbar, im buchstäblichen Sinne, ein globales Dorf. Würde diese Gesellschaft aus Autoren und Agenten nur an- oder aufgerufen: Es wäre schiere Angeberei und nicht zu ertragen. Aber Salman Rushdie ist offenbar so froh darüber, hier angekommen zu sein, und diese Gesellschaft scheint sich in den Jahren seiner Bedrohung unter dem Strich so anständig verhalten zu haben, dass der Leser ihm fast noch ein paar berühmte Freunde mehr wünschen möchte.
Viele der kleinen und mittleren Händel, die den literarischen Betrieb ausmachen, stehen nach Verkündigung der Fatwa unter einer fremden Prämisse: Wie erscheint dieses oder jenes Gespräch, diese oder jene Verabredung, dieser oder jener Vertrag nun im Lichte der Drohung? Dabei geht es um Konsequenz in Fragen der Meinungsfreiheit, um moralische Integrität und schließlich auch – was Salman Rushdie wichtiger als alles andere zu sein scheint – um persönliche Loyalität. Die Liste der Menschen, von denen sich Salman Rushdie enttäuscht sieht, ist lang. Sorgfältig verzeichnet er jeden Namen, und dazu gesellen sich die Namen habgieriger Hausbesitzer und gelegentlicher Geliebter.
So entstehen Helden, der norwegische Verleger William Nygaard zum Beispiel, der im Oktober 1993 vor seinem Haus von einem Attentäter schwer verletzt wurde, oder auch Günter Grass, der eine Art öffentlicher Bürgschaft für Salman Rushdie übernahm. Und es entstehen Opportunisten und Verräter, allen voran John Le Carré, der Salman Rushdie für einen blasphemischen Autor hielt und Blasphemie bestraft sehen wollte, oder der britische Außenminister Douglas Hurd. Und schließlich gibt es Menschen wie den amerikanischen Verleger Sonny Mehta, der erst Freund, dann Verräter und zuletzt wieder Freund ist. Wobei Salman Rushdie keinen Hehl daraus macht, wie sehr er sich darüber freut. Blickt man zurück auf die mehr als dreiundzwanzig Jahre, die seit Ayatollah Khomeinis Befehl, diesen Schriftsteller „hinzurichten“, vergangenen sind, erscheint diese Fatwa wie der Anfang einer langen, grausamen Geschichte, die seitdem nicht mehr aufhören will. Salman Rushdie erklärt in seinem Buch immer wieder, dass man seinen Roman „Die satanischen Verse“, wäre er denn gelesen worden, unmöglich als Gotteslästerung hätte verstehen können. Das Argument ist ein wenig hilflos. Denn Interpretationen spielen keine Rolle, wenn es einem fundamentalistisch gewordenen Glauben darum geht, der Welt mit Gewalt zu demonstrieren, dass sein Gott und dessen Prophet nicht der Freiheit der Meinung und der Kunst unterliegen. Und in der Wirkung macht es, zumindest in islamischen Gesellschaften, nur einen geringen Unterschied, ob man zu Unrecht der Lästerung verdächtigt wird oder ob man die Blasphemie sucht, wie es der dänische Karikaturist Kurt Westergaard betrieb oder es in diesen Tagen die Autoren des amerikanischen Schmäh-Videos taten.
Als die Führer der islamischen Revolution Salman Rushdie zu ihrem Feind erklärten, wussten sie, was sie taten. Der Autor war damals das literarische Versprechen einer neuen, bunten, multikulturellen Welt - und er war es geworden, weil er seine indische Herkunft mit dem Roman, einem westlichen Medium, verbunden hatte. Die Fatwa zielte deshalb auf Größeres als auf einen Schriftsteller: Sie sollte trennen, sie sollte scheiden, sie sollte das Gemischte auseinandertreiben. Und so kam es dann auch, und ärger wohl noch, als es die islamischen Führer hatten vorhersehen können. Oder anders gesagt: Wer gewinnt etwas, wenn man, mit voller Absicht, ein Schmähvideo wider den Islam ins Internet stellt? Der Islam? Die Meinungsfreiheit?
Salman Rushdie erzählt in seinen Memoiren die Geschichte eines pakistanischen Films, in dem eine Figur, in der er sich wiedererkennen musste, zuerst von einer islamischen Guerilla gejagt und dann von einem göttlichen Blitz verbrannt wird. Die britische Film-Prüfstelle hatte ihn gefragt, ob der Streifen verleumderisch sei und eventuell nicht auf den Markt kommen dürfe. Salman Rushdie sprach sich für die Freigabe aus. Man solle, schreibt er, „selbst die verwerflichste Aussage“ veröffentlichen. Selbstverständlich hat er recht. Und nach der Veröffentlichung kann man nach Gründen suchen, die Lage analysieren, erklären. Salman Rushdie muss das nicht selber machen. Er reicht aus, wenn er sagt, was war. Das ist gut für ihn, und das ist gut für seine Leser.
Weil diese Erinnerungen nicht
versuchen, große Dichtung zu
sein, werden sie Literatur
Die Weltgesellschaft der
Literatur ist hier ein globales
Dorf im wörtlichen Sinne
Hier gibt es Helden und
Schurken, Freunde und Verräter
– aber dies ist kein Roman
Als Salman Rushdie von der Polizei in ein Leben im Verborgenen abgeholt wurde, musste er sich einen neuen Namen geben: Er wählte „Joseph Anton“, nach seinen Lieblingsautoren Joseph Conrad und Anton Tschechow.
FOTO GILLES PERESS / MAGNUM PHOTOS
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de

Fatwa, Frauen, frühes Kalifat - der britische Schriftsteller schont in seiner Autobiographie niemanden, am wenigsten sich selbst
Ein Schriftsteller kann nicht beides haben: ein vollendetes Leben und ein vollendetes Werk.
Stell dich, weißer Mann, deine Stadt ist umzingelt", hieß es 1984 auf einem Graffito in Alice Springs, in der Mitte des australischen Outback. Salman Rushdie hatte den Satz während einer Reise mit Bruce Chatwin in seinem Notizbuch festgehalten. Als sich Rushdie fünf Jahre später an das Graffito erinnert, ist er selbst umzingelt und Chatwin gerade an Aids gestorben. Nur, und das macht hier einen Unterschied, ist Rushdie kein weißer Mann. Oder, was vielleicht wichtiger ist, hat sich bis dahin nicht als solcher gefühlt.
Der Tag der Erinnerung an Australien ist jener Tag im Februar 1989, an dem der Ajatollah Chomeini sein Todesurteil, die sogenannte Fatwa, über Salman Rushdie verhängte und mit einem Kopfgeld von drei Millionen Dollar anreicherte. Rushdie war an diesem Tag auf dem Weg in die griechisch-orthodoxe Kathedrale der heiligen Sophia der Erzdiözese von Thyateira und Großbritannien, um an einem Gedenkgottesdienst für Chatwin teilzunehmen. Und als er dem "in sonorem, salbungsvollem Griechisch" abgehaltenen Ritual in der Kirche folgt, versteht er nur Bahnhof. "Bla, bla, bla Bruce Chatwin, intonierten die Priester, bla, bla Chatwin, bla, bla."
Das ist sein generelles, fast möchte man sagen: konstitutionelles Handicap - Rushdie hat kein Ohr, findet keinen Zugang zur Praxis der Religionen in ihren Ritualen. Das ging ihm schon als kleiner Junge so, als ihn sein Vater einmal in Bombay am Tag des Ramadanfestes auf den Gebetsplatz mitgenommen hatte. Und das war auch in Australien so, als er mit Chatwin den Ayers Rock, den heiligen Berg der Aborigines, bestiegen hat. Dafür begann er in Australien aber zu verstehen, wie "Die satanischen Verse" geschrieben werden konnten, das Buch, welches Chomeinis Zorn erregte, weil es eine Überlieferungsvariante der Texte des Propheten literarisch durchspielt, die mit der kanonischen Fassung des Korans kollidiert. Dass das literarische Gedanken- und Traumspiel um die Verehrung oder Nicht-Verehrung dreier einst in Mekka in Stein gehauener Göttinnen als Blasphemie aufgefasst werden könnte, war Rushdie während des Schreibens nie in den Sinn gekommen. Dementsprechend unvorbereitet trifft ihn die Heftigkeit der Reaktion der muslimischen Orthodoxie. Was ihm in der griechisch-orthodoxen Kathedrale aber sofort klar wird, ist sein tiefsitzender Affekt gegen den mysteriösen Wortreichtum der religiösen Rituale.
Umzingelt von Paparazzi, Journalisten, Polizisten und Schriftstellerkollegen wie Paul Theroux, wird ihm das Unverständliche der Religionen verständlich. Die Religionen sind kein Sprachspiel, sie sind ein Kampf um Leben und Tod, und dem muss er, Salman Rushdie, sich jetzt stellen. Das ist der Ausgangspunkt seiner jetzt in 27 Ländern gleichzeitig erscheinenden Autobiographie mit dem Titel "Joseph Anton" - ein fünfzehnseitiger Prolog, der einem in seiner Welthaltigkeit den Atem verschlägt. Kein Satz ist hier Luft, Pause. Es folgt Information auf Assoziation, Australien auf Bombay, ein Mann vom "Daily Telegraph" auf Paul Simon. Darin wird auch noch das Leben seiner ersten beiden Frauen im Kurzporträt ohne Kitsch oder Häme, aber auch ohne Schonung erzählt.
Es ist der Prolog zu einem Buch, in dem Salman Rushdie versucht, sich selbst Aufschluss über seine Grundlagen zu geben. Rushdie weiß dabei um seine Fähigkeiten, er würde aber nie auf die Idee kommen, dass er einem Stoff oder Thema schon deshalb gewachsen sei, weil er, Rushdie, es behandelt. Das unterscheidet ihn radikal vom nicht nur unter Schriftstellern grassierenden aktuellen Ich-Darwinismus. Alles, was er kann und tut, seine Themen, seine Affekte, seine Lektüren resultieren aus Beziehungen zu anderen Lebewesen. Deshalb ist auch nur logisch, dass er von sich nur in der dritten Person spricht. Er, Rushdie, hat dieses Buch geschrieben und nicht irgendein Ich-Idiot. Ein Buch, das schon in seinen ersten Worten Rushdies Ambivalenz gegenüber den Welten des Mysteriösen zeigt, so dass es unmöglich wird, den Text nur unter der verhärteten Frontstellung zwischen Aufklärung und Religion zu lesen.
"Die erste Krähe" ist der Prolog überschrieben, und die Krähe ist hier das beseelte Böse in Tiergestalt. Man kann auch Chomeini zu ihr sagen, und natürlich bleibt sie nicht lange allein. In Scharen fallen sie in einen Schulhof in Kalifornien ein und singen das Lied vom stolzen muslimischen Volk, das das Todesurteil über Salman Rushdie verhängt. Man kann diese Krähe als Verbeugung vor den Aborigines, den wichtigsten Vertretern eines aktuellen, lebendigen Animismus, lesen. Zum anderen stehen die übel besetzten Krähen aber auch für Rushdies Abschied vom Osten, von Asien. Asien ist der einzige Kontinent, auf dem Krähen in der Mehrzahl der Gründungsmythen als Schöpfungs-, Weisheits- oder Glücksvogel positiv besetzt sind. Ihre üble Konnotation als Todesvogel oder Ungeziefer erfahren sie erst auf dem Weg in den Westen.
Ein Weg, den Rushdie mit dreizehn Jahren ganz freiwillig beschreitet. Von Bombay geht er nach England, auf ein Internat in Rugby. Dort lernt er den allgegenwärtigen britischen Rassismus kennen. Er weiß sich zu wehren und bringt sich mit Tricks, die er selbst als machiavellistisch bezeichnet, in die Lage, einen englischen Mitschüler im Handel um einen Ledersessel übers Ohr zu hauen. Später wird er diesen Schüler dann als Politiker der rassistischen National Front in einer Zeitung wiederentdecken. Rushdie wird auf der Schule trotz des Rassismus nicht zum Rebellen. Er entdeckt für sich die Möglichkeit der freien Entfaltung seiner Gedanken unter dem Regime der konservativen Form. Ein Prozess, der sich im Geschichtsstudium in Cambridge am King's College fortsetzt. Weil sich zu der Zeit die Professoren um jedes Thema kümmern mussten, solange sich auch nur ein Student dafür interessiert, kommt er zu seinem Lebensthema: Mohammed, der Aufstieg des Islam und das frühe Kalifat.
Arthur Hibbert, einer der drei am College für Geschichte zuständigen Professoren, wird dabei in seinem Habitus zu einem der bedeutendsten Vorbilder des Schriftstellers Rushdie. Hibbert gehörte einer schon damals aussterbenden Generation von Gelehrten an. Er veröffentlichte wenig, war außerhalb des College völlig unbekannt, dafür aber ein herausragender Lehrer. "Sie dürfen erst über Geschichte schreiben, wenn Sie die Menschen reden hören", ermahnt er Rushdie und lässt ihn seine Forschungen über Mohammed treiben. Und was dabei herausgekommen ist, ist die Sensation dieses Buches. In der kurzen Passage, sie umfasst sechs Seiten, in der er vom frühen Leben Mohammeds und den Gründen seines Erfolgs erzählt, wird Rushdie in der Literatur zu dem, der Spinoza in der Philosophie ist. So wie sich Spinoza endgültig selbst aus der jüdischen Gemeinde herausgeschrieben hatte, indem er die Bibel als ein Buch wie jedes andere las, so schreibt sich Rushdie schon in Cambridge aus der Welt des Islam, indem er die Geschichten um Mohammed materialistisch liest.
Wie tief er dabei in die Geschichte eingestiegen ist, zeigt er durch die Erwähnung des marxistischen Orientalisten Maxime Rodinson. Rodinson war ein in Paris lehrender Historiker, Sohn russisch-polnischer Juden, die in Auschwitz ermordet wurden, der über das Verhältnis von Islam und Kapitalismus forschte und früh erkannte, dass in dem Verhältnis ein paradoxes Problem liegt. Denn am Gründungsvater, am erfolgreichen Händler Mohammed, kann der grundlegende Antikapitalismus des Islam nicht gelegen haben. Rushdie baut die Überlegungen Rodinsons so fließend in seine Geschichte um den Händler Mohammed ein, dass einem beim Lesen der Sprengstoff des Konflikts fast entgeht. Ganz entgehen kann er einem nicht, weil man von der Fatwa weiß, aber Rushdie schafft im Buch etwas sehr Schönes. Ihm gelingt es, in Ton und Farben der sechziger und siebziger Jahre einzutauchen, den wirklich säkularen Jahrzehnten, bevor in den achtziger Jahren die Religion zurückkam.
Und das ist eine andere Linie dieser Erinnerungen: Rushdies tiefe Verwicklung in die Popkultur des Westens. Er gehört zwar zu den oft intellektuell suspekten Leuten, welche die Rolling Stones besser finden als die Beatles. Dafür kennt er aber Captain Beefheart und hört Velvet Underground. Musik, die man gut beim Lesen hören kann, weil sie genauso antidialektisch gemacht ist, wie Rushdies Buch gedacht ist. Rushdie schont und schützt nämlich außer seinen Kindern niemanden. Sich selbst am wenigsten. Wenn er sich wieder einmal freut, dass er mehr verdient als andere, schreibt er das auch. Ebenso wenig verschweigt er seinen Stolz, wenn ihn die Bewunderung anderer Männer für seine vierte Frau, ein bildschönes Model, erregt. So eine Frau kriegt eben nur Rushdie. Vor der Scheidung auch dieser Ehe schützt aber auch das nicht. Ein Schriftsteller kann nicht beides haben: ein vollendetes Leben und ein vollendetes Werk. Er muss sich entscheiden. Rushdie hat sich für das Werk entschieden und dabei schmerzlich bemerkt, dass das Werk nicht autonom ist. Das Werk ist das, was durch seinen Autor hindurchgegangen ist, und wenn es als Werk da ist, ist es der Welt ausgeliefert, die in das Werk eingegangen ist. Welthaltiger im ganzen Sinn des Wortes hat das noch nie jemand so beschrieben wie Rushdie. Konnten bisher Bücher wie "Don Quijote" oder "Moby Dick" aus dem lokalen Kontext zur Weltliteratur werden, so bildet diese Autobiographie zumindest die Prolegomena zu einer künftigen, wirklichen Weltliteratur, weil in den Autor schon eine große Welt eingegangen ist.
CORD RIECHELMANN
Salman Rushdie: "Joseph Anton. Autobiografie". Übersetzt von Bernhard Robben und Verena von Koskull. Bertelsmann, 720 Seiten, 24,99 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"Salman Rushdie hat sein bestes Buch geschrieben, eines der größten über unsere so schwer zu deutende Zeit, ein Meisterwerk." Nils Minkmar, Frankfurter Allgemeine Zeitung