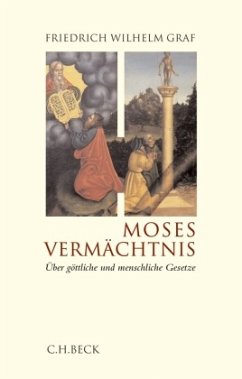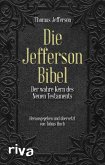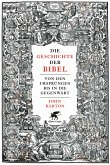Der renommierte Theologe und Religionswissenschaftler Friedrich Wilhelm Graf erläutert in seinem eleganten Essay, wie die Vorstellungen vom göttlichen Gesetz entstanden sind, welche Ausprägung sie in den verschiedenen Religionen erfahren haben und warum sie bis heute so machtvoll sind, daß sie immer wieder - und in letzter Zeit verstärkt - zu gewaltsamen Konflikten führen.
Die Diskussionen um die religiöse Verankerung von Verfassungen und Amtseiden, um das Kopftuch im öffentlichen Dienst und das Kruzifix in Schulen, um den Schutz ungeborenen Lebens oder den Verfassungsauftrag zur "Bewahrung der Schöpfung" zeigen, daß die Vorstellung vom "Gesetz Gottes" trotz Aufklärung und Säkularisierung eine nahezu ungebrochene Suggestivkraft entfaltet. Diese geht für manche religiöse Gruppen wieder so weit, daß sie das göttliche Recht dem staatlichen Recht vorordnen und damit die Geltungskraft des "positiven Rechts" unterminieren. Friedrich Wilhelm Graf bringt daher auch die Strategien zur Konfliktvermeidung und Beschränkung des göttlichen Gesetzes zur Sprache, die die Religionen selbst entwickelt haben.
Die Diskussionen um die religiöse Verankerung von Verfassungen und Amtseiden, um das Kopftuch im öffentlichen Dienst und das Kruzifix in Schulen, um den Schutz ungeborenen Lebens oder den Verfassungsauftrag zur "Bewahrung der Schöpfung" zeigen, daß die Vorstellung vom "Gesetz Gottes" trotz Aufklärung und Säkularisierung eine nahezu ungebrochene Suggestivkraft entfaltet. Diese geht für manche religiöse Gruppen wieder so weit, daß sie das göttliche Recht dem staatlichen Recht vorordnen und damit die Geltungskraft des "positiven Rechts" unterminieren. Friedrich Wilhelm Graf bringt daher auch die Strategien zur Konfliktvermeidung und Beschränkung des göttlichen Gesetzes zur Sprache, die die Religionen selbst entwickelt haben.

Bei allem Unterscheidungsspaß nicht unkorrekt: Friedrich Wilhelm Graf beobachtet Himmel und Erde
Am Ende, wenn die Bücher aufgetan werden, wird alles klar und deutlich vor Augen stehen. Denn dann wird Gott zu erkennen geben, nach welchem Recht er in Wahrheit zu richten gedenkt. Es wird sich zeigen, was richtig und falsch, was gut und böse war. Zuvor bleibt nur die - in Toleranz ertragene oder durch Aggression verdrängte - Unsicherheit der Gläubigen, ob denn ihr Gottesgesetz das wahre sei, ob sie den echten Ring tragen. Und es bleibt die Möglichkeit, den Theologen als Kulturwissenschaftler zu befragen. Denn dieser überschaut den Konflikt zwischen religiös-absolut begründeten Normen einerseits und Rechtsfindung im freiheitlichen und multikulturellen Staat andererseits - und mahnt zu gewaltfreier Konfliktfähigkeit.
Friedrich Wilhelm Graf spricht mit seinem Essay in einer Situation, die in der medialen Öffentlichkeit als Wiederkehr des Religiösen und als zunehmend konfliktträchtige Auseinandersetzung zwischen verschiedenen religiös begründeten Norm- und Ethossystemen untereinander und mit dem weltanschaulich neutralen Staat wahrgenommen wird. Der Absolutheitsgestus zumal der drei monotheistischen Weltreligionen, ihr Anspruch nicht nur auf das Glauben, sondern auch auf das Handeln ihrer Anhänger, verträgt sich, so scheint es, nicht mit der für das friedliche Zusammenleben unabdingbaren Selbstrelativierung, ja dem Verzicht. Graf hütet sich vor einseitigen und vordergründigen Schuldzuweisungen. Er schreitet mit der oft wiederholten Denkfigur "Einerseits - andererseits" bekennend voran.
Wider klerikale Spezialmoral
Mit Sympathie liest man, der Autor "verachte klerikale Moralrechthaberei" und "sehe in individueller Freiheit das höchste innerweltliche Gut". Der Bezug auf Kant ist ebenso deutlich erkennbar wie eine protestantische (freilich nicht die protestantische) Lesart des Wirklichen, die zwischen zwei Reichen zu unterscheiden weiß und zu einer Entkoppelung von Glaube und Moral tendiert. Die Unterscheidung von Legalität und Moralität wehrt der (für Amerika als Faktum ausgemachten) Entwicklung zu einem "Sittenstaat".
Den Religionen wird gleichwohl ein hoher funktionaler Wert zuerkannt, indem sie "den in ihnen vergemeinschafteten Frommen" helfen, "die elementaren Negativitätserfahrungen endlichen Lebens als sinnerfüllt zu deuten". Dem Rechtstaat wird empfohlen, religiöse Lernprozesse hin zu vernünftiger Religion zu "stimulieren, indem er als Kulturstaat durch gelassene Liberalität verhindert, als Kulturkampfstaat erlebt zu werden". Gleichwohl soll und kann der Staat nicht Erzieher sein. Das Gegen- und Schreckbild sind "positiver Kirchenglauben" und vom Autor wahrgenommene "Ansätze kontraproduktiver Klerikalisierung der ethischen Konfliktdiskurse". Fragt man weiter, wo denn konkret in der Bundesrepublik der Klerus sein Haupt erhebt, wird man auf die "klerikale Spezialmoral" in der "Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und anderer Gerichte bis in die 1960er Jahre hinein", auf den religiös zu einseitig besetzten nationalen Ethikrat und - natürlich - auf Bischof Huber und Kardinal Lehmann mit ihrer Mahnung zu "zivilreligiösen Glaubensbekenntnissen" verwiesen. Graf sieht noch oder wieder für die Gegenwart die Gefahr, Deutschland könne als "tendenzchristlicher Konfessionsstaat" wahrgenommen werden. Solche bedenklichen Entwicklungen mag man in Bayern sensibler registrieren als in Brandenburg. Doch das Rettende wächst schon, in Gestalt der wahrgenommenen "Pluralität religiöser Ethosformen" und einer Stärkung der relativen "Autonomie weltlichen Rechts".
Innerhalb der so abgesteckten Grenzen darf der protestantische Bundespräsident durchaus "Gottes Segen" zum neuen Jahr wünschen, doch Kreuz und Kopftuch gehören nicht zur Berufskleidung von Richtern und Staatsanwälten. Die Grenzziehung zwischen "religionssymbolischer Zurückhaltung" der staatlichen Repräsentanten und Religionsfreiheit, die auch "subjektiv erlebbar" sein soll, bleibt also schwierig. Denn die Schaffung religionssymbolfreier öffentlicher Räume habe, so lehre wiederum das Beispiel Amerika, den Konflikt nicht entschärft. Eine weitherzige und historisch informierte Bestimmung dessen, was alles zur abendländischen Kultur gehört, könnte wohl auch helfen.
Diese Bekenntnisse und Zuspitzungen, die etliches scharf erfassen und sich nur bisweilen und dem zweiten Blick ihrerseits als politisch recht korrekt erschließen, markieren natürlich ebenfalls eine explizite religiöse Option. Dennoch entgeht die Darstellung nicht immer der Versuchung, die religiöse und ethische Position des einzelnen oder der (immer minoritären) Glaubens- und Überzeugungsgemeinschaft zu kontrastieren mit dem sich im Recht manifestierenden Konsens des großen Ganzen. Die zur Problemanzeige geschilderten Konflikte um das Kopftuch der muslimischen Lehrerin an der staatlichen Schule oder um das Schächten sind ja in zwei Richtungen zu lesen: vom religiösen Individuum her, das sein Recht auf freie Religionsausübung gegen den Staat erstreiten will - und vom Staat her, der mit seiner Rechtssetzung und Rechtsprechung erheblich (manche meinen: immer mehr und jedenfalls zu viel) in die Lebensgestaltung des einzelnen eingreift.
Diejenigen, die nicht geduldig bis zum Jüngsten Tag warten mögen, blicken auf den Anfang, auf die Urszene des mit göttlicher Autorität ausgestatteten Rechts: Mose empfing am Sinai die Zehn Gebote auf steinernen Tafeln, so interpretiert Deuteronomium 4,13 die Sinai-Szene. Das ist für Graf, anders als vielleicht für Jan Assmann, keine Sündenfallgeschichte. Nein, für "Multikulti-Fröhlichkeit", "Poly-Götter", "Polygamie" oder "gruppenspezifische Ordnungsentwürfe" statt einer für alle gültigen Rechtsordnung ist der Autor nicht zu haben. Hinter der vordergründig eindeutigen Berufung von Judentum, Christentum und Islam auf Mose scheint aber eine vielfach (überwiegend aus der christlichen Tradition) illustrierte Geschichte der differenzierten Inanspruchnahme und Auslegung der Zehn Gebote auf. Diese ist geeignet, den Anspruch selbst zu relativieren und den Dekalog als "grandiose Projektionsfläche für unterschiedlich akzentuierte Normenentwürfe" zu erweisen. Das Gottesgesetz gibt es nur im Plural, die "fromme Fiktion" ist überaus geschichtsmächtig, gerade in ihren sehr unterschiedlichen Ausprägungen. Das "kluge Historisieren der Exegeten" hingegen, welche den Ursprung der Norm als historisch kontingent und gewachsen aufzeigt, erweist sich angesichts der Wirkungsgeschichte als kraftlos. Geschichte wird als Rezeptions- und Wirkungsgeschichte geschrieben; die Frage nach dem echten Ring ist irrelevant.
Bedenke das Ende!
Von seiner Warte erkennt der Theologe, daß andere Urszenen des Rechts den Konflikt nicht lösen: nicht die Berufung auf ein vorstaatliches Natur- oder Sittengesetz, nicht der Verweis auf Menschenrechte oder Werte oder gar eine gemeinsame kulturelle Prägung der Staatsbürger (Paul Kirchhof). Dies kann schon deshalb nicht gelingen, weil solche Verweise als "liberaler Legitimationsmythos" und mit "religiösen Pathosformeln" versehen die religiöse Urszene - und damit die ihr inhärenten Konflikte - beerben. Auch als notwendiges Postulat scheint Graf das "Aeternitätsparadox moderner Verfassungsgebung" nicht der Ausweg. Denn sub specie Dei leben wir unausweichlich im Vorletzten. Der Autor beschreibt besonnen, wie im Vorletzten die Berufung auf das Unbedingte auszuhalten sei.
Doch kennt die christliche Tradition eine Urszene, die Grafs Essay nur eben streift: Die Predigt auf dem Berg in Galiläa ist ja nicht nur Fortschreibung der "traditio legis" (Gesetzesübergabe); und der Bergprediger verkündet anderes als den Dekalog. Durch Feindesliebe und Rechtsverzicht als Zentrum einer eschatologischen Moral entwickelt das Fleisch gewordene Gotteswort im politischen Raum subversive Kraft, welche die Göttlichkeit bestehender Ordnungen fundamental in Frage stellt. Christlicher Monotheismus ist, recht verstanden, keine Legitimation des Prinzips göttlicher Monarchie durch das Gottesrecht. Von solchem Ende der Gesetzes-Geschichte aus zu denken implizierte allerdings eine höchst positive Theologie.
HERMUT LÖHR
Friedrich Wilhelm Graf: "Moses Vermächtnis". Über göttliche und menschliche Gesetze. Verlag C. H. Beck, München 2006. 97 S., 22 Abb., br., 12,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Von Kopftüchern und Ewigkeitsklauseln: Friedrich Wilhelm Graf über göttliche und menschliche Gesetze
Der moderne freiheitliche Verfassungsstaat gibt der Religion Raum, ohne sich mit ihr zu identifizieren. Die ethische Neutralität des Staates und die Gewährung der Glaubens- und Weltanschauungsfreiheit sind zwei Seiten derselben Medaille. Bis dahin war es verfassungsgeschichtlich ein langer Weg, der in Deutschland von den mühsam errungenen Religionsfrieden von Augsburg 1555 und Westfalen 1648 über bestimmte Formen der Tolerierung und Gleichstellung im späten 18. und 19. Jahrhundert bis zur vollständigen Gleichberechtigung aller religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisse in der Weimarer Reichsverfassung führte. Noch länger dauerte es, bis die christlichen Kirchen die glaubensneutrale Grundrechtsdemokratie akzeptierten.
Doch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mochte es so scheinen, als ob hier eine gewisse Harmonie zwischen staatlichen Grundstrukturen einerseits, religiösem Selbstverständnis auf der anderen Seite eingetreten sei, als ob sich göttliche und menschliche Gesetze, um den Untertitel der Schrift des protestantischen Münchner Theologen Friedrich Wilhelm Graf zu zitieren, nicht in feindlicher Kollision, sondern in weitreichender Übereinstimmung befänden. Ein modus vivendi ergab sich auch deswegen leichter, weil die religiöse Homogenität ebenso hoch war wie der Organisationsgrad der Akteure.
Mit steigender religiöser Pluralität, häufig gepaart mit fundamentaler kultureller Verschiedenheit, nimmt der Konfliktstoff zwangsläufig wieder zu. Kopftuchtragende Lehrerinnen islamischer Religion, das Schächten von Tieren oder die Befreiung vornehmlich türkischer Mädchen vom Schwimm- und Sexualkundeunterricht bilden jedem Zeitungsleser geläufige Beispiele. Ihren Austragungsort finden die Streitfragen im Rechtssystem, das nach Grafs treffender Beobachtung wie ein Seismograph für Glaubensspannungen wirkt. Müssen wir nun angesichts der veränderten Religionslandschaft zu einer Neuvermessung der Grundkoordinaten für unser Verfassungsrecht schreiten, den Grenzverlauf zwischen der Freiheit religiös bestimmter Lebensführung und legitimer staatlicher Inpflichtnahme neu bestimmen?
Onanie und kreative Auslegung
Bevor der Autor sich in einer „Verfassungspredigt” dieser Frage widmet, schlägt er zunächst einen großen Bogen zurück. Die Urszene der Gesetzgebung, Moses Empfang der Gesetzestafeln auf dem Berge Sinai, steht im Mittelpunkt der Abschnitte über „Gesetzesauslegung” und die „Zehn Gebote”. Das ist schon deswegen gut gewählt, weil hier ein für die drei großen monotheistischen Weltreligionen gemeinsamer Bezugspunkt liegt. Doch welche Verschiedenheit! Plastisch und in einer die gesamte Schrift durchziehenden fulminanten - wenn auch zuweilen überbordenden - Rhetorik zeigt der Verfasser, wie unterschiedlich die zehn Gebote gezählt, ausgelegt und eingeordnet wurden.
Insbesondere in ihrer Bedeutung für die Sozialordnung wurden sie nicht nur in den großen Religionen unterschiedlich aufgefasst - wobei Graf manches Pauschalurteil über die „Gesetzesreligionen” zurückweist -, sondern bildeten insofern auch einen zentralen Differenzpunkt zwischen den christlichen Konfessionen. Das römisch-katholische Naturrecht versteht sich dabei von jeher stärker als eine umfassende Explikation verbindlicher Rechtsregeln, die ihren Ursprung im göttlichen Gesetz finden und ihre Validität von ihm ableiten. Dabei handelt es sich nicht nur um moralische Imperative, sondern um Normen höheren, überpositiven und in letzter Instanz auch die Politik bindenden Ranges.
Scharf arbeitet Graf hier die ungebrochene Tradition bis heute heraus und exemplifiziert ihre Relevanz an einem hochkontroversen Problemfeld, der Sexualmoral und der Bioethik. Dem neuen Katechismus der katholischen Kirche zufolge kennt das 6. Gebot („Du sollst nicht ehebrechen”) als Hauptsünden nicht nur Ehebruch und Vergewaltigung, sondern zudem Selbstbefriedigung, Pornographie, Prostitution und homosexuelle Handlungen; dafür, dass auch die künstliche Befruchtung als unsittlich gebrandmarkt wird, hält der Verfasser die spöttische Charakterisierung als „kreativhermeneutische Auslegung” bereit. Es ist ihm ein leichtes zu zeigen, wie anders man etwa im Judentum darüber denkt.
Und die Protestanten? Sie „wollen keinen Papst, und sie brauchen kein Lehramt, das ihnen verbindlich Gottes Gesetze auslegt”. Graf zitiert das erstaunliche Luther-Wort, wonach der Christ neue Dekaloge machen dürfe. Die zehn Gebote sind nicht Quelle eines ganzen Normenkosmos, der das moralische Gesetz in uns ebenso determiniert wie die staatliche Ordnung, sondern eher ethische Haustafel - mehr Fixpunkt eigener Reflexion als starre Regel, um die sich immer dickere Normschichten legen. So ist denn nicht länger die Unwandelbarkeit und der Ewigkeitsgehalt des Gottesgesetzes entscheidend, sondern die von Graf „Selbsttätigkeitssemantik” genannte Umstellung auf Innerlichkeit und Liebesgesinnung. Das weltliche Recht wird so stärker freigesetzt, entbehrt allerdings eines stets zur Hand befindlichen Korrektivs, dessen es vielleicht auch deshalb weniger bedarf, weil auf ihm als pragmatischem und unvermeidlichem Mittel der Aufrechterhaltung sozialer Ordnung kein Abglanz des Göttlichen mehr ruht. Eine gewisse augustinische Grundgleichgültigkeit gegenüber der Welt wirkte stark relativierend, vielleicht gerade deshalb auch modernisierend.
Gepflegte Dissenskultur
Freilich haben selbst die massiv antiklerikalen französischen Revolutionäre auf Anleihen aus dem Bildprogramm der göttlichen Gesetzgebung nicht verzichtet, und desgleichen sind manche Tendenzen zur Sakralisierung des Grundgesetzes nicht zu verkennen, zumal dessen Ewigkeitsklausel zu metaphysischen Überhöhungen einladen mag. Aber das sind letztlich keine dominanten Tendenzen, und auch die Interpretation Gottes in der Präambel des Grundgesetzes stellt den Verfassungsjuristen nicht vor unlösbare Probleme. Schwieriger ist schon die Frage zu beantworten, ob der Staat auf die Herausforderung religiöser Pluralisierung mit ihrem erhöhten Konfliktpotential durch stärkere Restriktion der Glaubensfreiheit reagieren sollte.
Natürlich hat Graf hier kein Patentrezept zur Hand, wie er auch für den instruktiven Fall der kopftuchtragenden muslimischen Angestellten eines kommunalen Kindergartens keinen Lösungsvorschlag anbietet. Doch lehnt er verstärkte Interventionen des Staates schon deshalb ab, weil das eine diesem nicht zukommende Kompetenz zur Glaubensdeutung voraussetzen würde. Auch der Umprägung bestimmter religiöser Zeichen und Symbole zu bloßen historischen Kulturfaktoren begegnet der Autor skeptisch. Letztlich setzt er auf ein Konzept forcierter Pluralisierung. Ohnehin scheint Vielfalt das unterschwellige Leitmotiv des gedankenreichen und zum Weiterdenken einladenden Büchleins zu sein. Das beginnt damit, dass man von dem Islam ebensowenig sprechen könne wie von dem Juden- oder Christentum, führt über die Betonung der produktiven Rolle der glaubensspaltenden Reformation und endet beim Diktum, dass es Gottes Gesetz nur im Plural gebe.
Durch die Akzeptanz des Wettstreits der Religionen und Konfessionen in einer gepflegten Dissenskultur sowie der Unterschiedlichkeit dogmatischer Deutungen und Lebensführungsformen soll sich zugleich die Rolle des Staates stärken, nicht schwächen. List der Vernunft - die Pluralität der religiösen Deutungen demonstriert ihre Partikularität und befördert so die relative Autonomie des weltlichen Rechts. Unabhängig davon wäre schon viel gewonnen, wenn allgemein anerkannt würde, dass das Recht nur das „ethische Minimum” (Georg Jellinek) gewährleistet und es keinen Anspruch darauf geben kann, die eigenen Überzeugungen und Wertvorstellungen ungeschmälert zum für alle geltenden staatlichen Gesetz zu erheben. Recht und Moral sind im freiheitlichen Verfassungsstaat eben nicht identisch.
HORST DREIER
FRIEDRICH WILHELM GRAF: Moses Vermächtnis. Über göttliche und menschliche Gesetze. Verlag C. H. Beck, München 2006. 99 Seiten, 12 Euro.
Christliche Freiheit bedeute, dass wir gegenüber dem mosaischen Gesetzesglauben immer „neue Dekaloge machen”, schrieb Martin Luther 1535. Hier hantiert Ben Kingsley in dem TV-Film „Die Bibel : Moses” aus dem Jahre 1996 mit den Normen des Alten Testaments.
Foto: Cinetext
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Eine Dienstleistung der DIZ München GmbH
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Lobend äußert sich Rezensent Uwe Justus Wenzel über dieses Buch des Theologen und Theologiehistorikers Friedrich Wilhelm Graf, das sich mit dem komplexen Verhältnis von Religion und Politik befasst. Er betont, dass Graf den Schwierigkeiten des Themas nicht aus dem Weg geht. Im Gegenteil: Graf sondiere die Vielschichtigkeit der religionspolitischen Lage der Gegenwart und registriere Überlagerungen und Verwerfungen in den vielfältigen religiösen Traditionen und verschiedenen politischen Formationen. Wenzel sieht Grafs Position von einem liberalen Kulturprotestantismus geprägt, mit dem er durchaus sympathisieren kann. Auch Grafs Plädoyer für eine "gelassene Liberalität" des Staates im Umgang mit den Religionen erscheint Wenzel überzeugend.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH