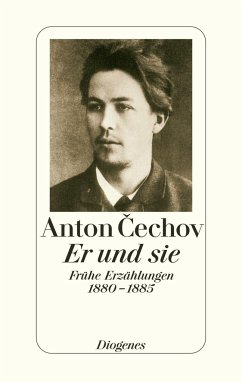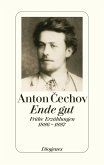Ein Geschenk für die Leser: Die Erzählungen des jungen Cechov sind jetzt erstmals in deutscher Sprache erschienen. Der Melancholiker zeigt sich in ihnen als Spötter und Spaßvogel.
»Früher habe ich geschrieben, wie mir der Schnabel gewachsen war. Ich setze mich hin und schreibe. Ich überlege nicht, wie und worüber. Es schrieb sich von selbst Ich lachte und brachte die Umwelt zum Lachen. Ich nahm das Leben und zauste es, ohne darüber nachzudenken.«
»Früher habe ich geschrieben, wie mir der Schnabel gewachsen war. Ich setze mich hin und schreibe. Ich überlege nicht, wie und worüber. Es schrieb sich von selbst Ich lachte und brachte die Umwelt zum Lachen. Ich nahm das Leben und zauste es, ohne darüber nachzudenken.«

Alle Kirschgärten sind noch verriegelt: 118 kurze Geschichten des genialen Anfängers Anton Tschechow
Das ist ein Anfang. Eine kurze Geschichte mit dem verheißungsvollen Titel „Der Denker”. Und dies sind die ersten drei Zeilen: „Heller Mittag. In der Luft keine Geräusche, keine Bewegung ... Die ganze Natur gleicht einem sehr großen, von Gott und den Menschen verlassenen Landsitz.”
Das ist ein Anfang. Aber vielleicht ist dieser Anfang auch schon ein Abgesang. Eine Geschichte fängt an – und ist schon nach den ersten Worten erschöpft, beinahe am Ende. Es dauert dann auch nur noch weniger als vier Seiten, bis die kurze Geschichte vom „Denker” den Zustand der totalen Gedankenfinsternis erreicht hat. Bis einer sagt, was leider jetzt gesagt werden muss: „Alles auf dieser Welt ist überflüssig”.
Anfänge, mit denen nichts anfängt. Anfänge, die schon ein Ende sind. Damit beginnen viele der 118 frühen Erzählungen Anton Tschechows, die Peter Urban, der nimmermüde Übersetzer, der grandiose Tschechow-Forscher und - Prophet jetzt im Diogenes-Verlag präsentiert, die meisten davon zum ersten Mal auf deutsch. Geschichten fangen an, aber oft beginnen sie gleichsam ohne Bewegung. Sportlich gesagt: ein Fehlstart. Poetisch gesagt: Die Welt steht still und schweiget.
Mit den Schlüssen sieht es nicht besser aus als mit den Anfängen. Nun weiß der Liebhaber Tschechows (der gewöhnlich ein Liebhaber des Tschechow- Theaters ist), dass dieser Dichter ohnehin das ganz große, das opernhafte Finale eher meidet. Aber immerhin: Einen Schluss haben die meisten dieser Stücke schon. In der „Möwe” erschießt sich ein junger Dichter, im „Kirschgarten” werden krachend die alten Bäume abgeholzt. Der Tod tritt auf – und macht einigen Lärm.
In den frühen Erzählungen ist der Schluss oft nur am Punkt zu erkennen, der die Erzählung beendet. Für diesen Punkt muss man dankbar sein. Denn so viele Geschichten enden im Grau, im Nebel, im Nichts! So viele hören auf, bevor sie überhaupt richtig angefangen haben. Und zwischen Anfang und Ende: kaum eine unerhörte oder wenigstens interessante Begebenheit.
Manchmal immerhin klingt der Schlusssatz wie ein fast lautloser, aber gerade noch hörbarer Ton. Keine Axt und kein Pistolenschuss machen ein Ende. Die Geschichten hören auf, als würde eine Tür geschlossen. Und das nicht einmal laut. Als würde ein Faden reißen. Nicht der grause Tod tritt auf, sondern bloß sein grauer Stellvertreter auf Erden: das so genannte Leben. Das natürlich „weitergeht”, aber niemand will wissen, wohin. Fortsetzung folgt? Fortsetzung fehlt.
„Gute Erzählungen”, so hört eine Erzählung auf, „enden immer mit einer Hochzeit”. So gesehen, gibt es unter den 118 Geschichten nicht viele gute. Und unter den wenigen guten sind die meisten auch eher schlecht: Weil Tschechows Hochzeiten gewöhnlich nur die guten Anfänge böser Geschichten sind.
Eine der vielen Erzählungen ohne Schluss heißt sogar ausdrücklich: „Erzählung ohne Schluss”. Und das ist keine kokette Pointe, sondern die karge Wahrheit. Tschechow, so weit man sehen kann, sagt immer die Wahrheit. Unter allen Dichtern ist er derjenige, der am schlechtesten lügen kann. Seinen Überschriften und Titeln also kann man immer trauen. Heißt eine Erzählung „Überflüssige Menschen”, dann meint sie es auch so. Wird ein „läppischer Fall” annonciert, folgt dem tatsächlich ein läppischer Fall.
Das totale Tschechow-Rätsel aber ist und bleibt (auch nach dieser Edition), wieso man den mageren Wahrheiten dieses Dichters noch lieber zuhört als den üppigsten Lügen seiner Kollegen. Das Königsdrama zum Beispiel, eine schöne Sache! Aber wie schnell und wie gern lässt man die Könige links liegen, wenn so ein Tschechow-Mensch die Szene betritt. Wenn uns wieder mal einer dieser Langweiler eine dieser läppischen Geschichten auftischt und dabei nicht einmal weiß, wie er anfangen und wie er aufhören soll, es ist eine Zumutung.
Zwei Bände, 118 Geschichten. Wer mit der ersten anfängt, wird vor der letzten nicht aufhören.
Einer der nüchternsten Dichter
Wer, das große Tschechow-Theater im Kopf, die Welt dieser frühen Erzählungen betritt, den erwartet ein Wiedersehen, aber kein gemütliches. Sondern ein Schock.
Es sind die bekannten Gestalten, auf die man trifft: die Provinzler, die Säufer, die Schwätzer, die Langweiler. Die müden Pilger und schmutzigen Landstreicher. Die verkrachten Künstler. Die Pechvögel und Jammerlappen der Liebe. Es sind die selben Geschichten wie später, aber sie haben ein anderes (kälteres) Klima und einen anderen (härteren, stumpferen) Klang.
Auch wenn es der Dichter niemals gewollt hat, auch wenn es ihn, den Propheten der Nüchternheit und den Erzfeind des Kitsches, vermutlich erschreckt oder zum Lachen gebracht hätte: Längst gehören die berühmten Tschechow-Figuren zu unserer „Familie”. Die klassischen Tschechow-Orte zu unserer „Heimat”. Auch wenn die Kirschgärten längst abgeholzt sind, so gehen wir doch noch immer mit Vergnügen in ihnen spazieren.
Jetzt aber, in den Erzählungen aus den Jahren 1880 bis 1887, betreten wir die Zeit, als unser liebster Klassiker noch ein Rohling, ein Anfänger war. Schnellschreiber, Zeilenschreiber, Zeilenschinder. Noch nicht Dichter, sondern Prosalieferant, bestenfalls Zeitungsschriftsteller. Zwanzig Jahre alt, als er beginnt, Student der Medizin, Ernährer der Familie. Wofür seine Stücke später vier Akte oder vier Stunden Zeit haben, oder was ein Roman auf vielen hundert Seiten ausschweifend erörtern darf, das muss hier auf vier bis zehn Seiten abgewickelt werden. Das verlangt vom Autor weniger Poesie als brutale Ökonomie. Das macht die Sätze kurz und die Gefühle knapp. Manchmal braucht es nur drei Zeilen für die Beschreibung einer ganzen Welt – und dann drei Seiten nur für ihren Untergang.
Es gibt einige Oster- und Frühlingsgeschichten, wo der Dichter fast wie ein Heiliger spricht, wie ein jüngerer Bruder Tolstojs oder Dostojewskijs. Es gibt einige Männer-, Jagd- und Saufgeschichten, wo das Elend des russischen Menschen und der Ekel des Betrachters den Autor ganz hart und gehässig werden lassen. Aber in gut hundert Erzählungen lässt sich der junge Tschechow weder erweichen noch bitter machen. Zwingt er sich zu einer schier übermenschlichen Nüchternheit beim Anblick seiner meist doch nur trostlos berauschten Geschöpfe.
Viel später, in den großen, traurigen Komödien, ist er sich seines Abstands wohl nicht mehr so sicher. Lässt sich, wenn auch wider Willen, doch hineinziehen, hineinlocken in die eigene, fatale, aber eben auch einzige Welt. Die der Anfänger oft noch aus weiter Ferne und großer Höhe studiert hat. Während der späte Tschechow (ein alter Meister von gerade mal vierzig Jahren) dann doch seinen Figuren immer näher rückt und ähnlicher wird – als sei auch der notorisch nüchterne Dichter am Ende angesteckt von der Krankheit namens Leben, von der Seuche, die man Liebe nennt.
Beim Anfänger Tschechow ist die Ironie noch die dominierende große Schwester der Melancholie. Nicht einmal die Natur kann den Poeten bestechen und zur poetischen Ausschweifung verführen. „Wäre ich ein Meister der Naturbeschreibung”, schreibt Tschechow plötzlich, „so würde ich den Mond beschreiben”. Weils aber nicht so ist, tut er es nicht.
Die Natur ist keineswegs, wie die Dichter immer wieder schwärmend behaupten, der schöne Widerspruch zum leider hässlichen oder früh hässlich gewordenen Menschen, schon eher ist sie sein Spiegelbild. Auch die Natur hat meistens schlechte Laune: „Die Luft ist grau und unfreundlich”, der Himmel „graublau, mürrisch”. Immer wieder sieht die Erde selber aus wie ihre menschlichen Bewohner – verkatert, ernüchtert, verschmutzt. „Der Natur wird übel”, heißt es dann, und „der Regen murrt”.
Zu Tschechows bewährtesten Zaubermitteln gehört also die Kunst der Entzauberung. Eine Uhr schlägt nicht gemütlich, sondern „hustet”. Ein Flüstern im Zimmer klingt nicht geheimnisvoll, sondern bloß eklig, „wie das Zischen in einer Bratpfanne”. Augen sind keine Sterne, im Gegenteil: „Seine Äuglein sind ölig bis zum Erbrechen”.
Und dennoch geht von allen diesen unerquicklichen frühen Tschechow- Menschen eine Kraft aus, ja ein Zauber. Denn anders als ihre wehen und welken Nachfolger im Spätwerk haben sie eine noch ganz unverbrauchte, animalische, ja bestialische Kraft. Das Leben mag ja traurig sein – aber leben, das will man, dass muss man und das kann man!
Es ist eine Welt der wilden Kerle und Kerlinnen, der Egomanen und Menschenfresser, nicht der müden Herzen oder toten Seelen, nicht der elegischen Kirschgartenmenschen, in die der Dichter seinen Leser verschleppt. Er tröstet ihn nicht, er schlägt ihn lieber vor den Kopf. Aber manchmal, immerhin, bringt er ihn auch zum Lachen. Wie in der wundervollen Erzählung „Der dumme Franzose”, in welcher ein französischer Clown ein russisches Restaurant besucht und dort vom Schrecken heimgesucht wird. Weil er mit ansehen muss, wie (und vor allem wie viel!) diese russischen Menschenbestien essen und natürlich trinken können.
„Diese Wilden!”, denkt der empfindsame Franzose, und beim grausigen Anblick des stärksten Essers ist er vollends überzeugt: „Dieser Mensch will sterben”. Dann aber muss er erfahren, dass dieser Mensch keinesfalls sterben, sondern eben bloß essen möchte. Ein wenig nur, zwischendurch. Denn was der arme Franzose für ein Gelage hält, das ist für den starken Russen nur eine Zwischenmahlzeit. Worauf der Clown (und wir, die Tschechow-Leser) nur noch fassungslos sagen können: Russland, „oh Land der Wunder!”
Eines der besseren Paare
Die Liebe, um auch hiervon noch zu reden, ist keine Himmelsmacht. Sondern, im lieblosen Normalfall, ein ziemlich irdischer Handel. Unter den Geschäften, die der Mensch zu tätigen hat, ist sie jedenfalls eines der härtesten und bittersten. Ein Kampf, bei dem kaum einer auf die schmutzigen Griffe verzichten mag. Geht jemand auf Brautschau, dann hat er meistens ein Problem: „Aber kann ich ihr meine Liebe gestehen, wenn ich sie gar nicht liebe?” Oft also ist schon vor dem Anfang einer Ehe alles gelaufen – und zwar falsch.
Im besseren (also komischen und rührenden) Falle geht eine Geschichte dann so wie die Geschichte „Ende gut”. Der Ober-Kondukteur Styckin, schon 52 Jahre alt, möchte es endlich auch einmal so gut haben wie die anderen Menschen. Weshalb er nun eine Kupplerin, „eine würdige, aus feinstem Weizenmehl gebackene Dame von um die Vierzig” konsultiert und mit ihr, in aller Sorgfalt, die Heiratsmarktverhältnisse bespricht. Hässliche Frauen machen keine Freude, schöne Frauen meistens Ärger, reiche Frauen sind ein Problem, arme Frauen natürlich erst recht. Was also tun? Zumal auch die Courtage für die Maklerin ein herber finanzieller Schlag wäre.
Der gewitzte Kondukteur weiß einen Rat: Plötzlich zu allem entschlossen, macht er nun der reifen Kupplerin selber einen Antrag, in einer tollen Verbindung von romantischem Überschwang und knochiger Raffgier. Und die Dame lässt sich gern erobern. Was danach kommt, erzählt der Dichter nicht mehr. Aber unter den Tausenden von Tschechow-Paaren werden diese beiden bestimmt eines der besseren sein.
Ganz anders, nicht boshaft und drollig, sondern tatsächlich herzzerreißend, verläuft die letzte aller Geschichten: „Erzählung der Frau NN”. Sie beginnt als Romanze im Sommerregen und ist, nur wenige Sätze und Seiten später, am Ende aller Endspiele angelangt. Zwei, die sich liebten, die eine Chance hatten zur Liebe, haben die Chance schwächlich und ängstlich verpasst. Und die Zeit vergeht, und mit ihr vergehen und verwelken die sommerlichen Gefühle. Bis es Zeit ist für das Fazit: „Mein Gott, mein Gott, das Leben ist dahin”.
So ist diese letzte frühe Erzählung eine späte, eine endgültige Erzählung geworden. Ein klassisches Tschechow-Theater, in Prosa. Der Dichter ist jetzt 27 Jahre alt, und er wird in diesem Jahr 1887, mit dem „Iwanow”, seine erste Uraufführung erleben. Ein Weg hat angefangen, an dessen Ende ein Kirschgarten liegt.
BENJAMIN HENRICHS
ANTON TSCHECHOW: Er und sie. Ende gut. Frühe Erzählungen in zwei Bänden 1880-1887. Diogenes Verlag, Zürich 2002. 1152 Seiten, 45,90 Euro.
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.diz-muenchen.de
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
""Auf über tausend Seiten kann man die Werkstatt eines Junggenies der Nüchternheit durchwandern!" schreibt niederkniend Rezensent Gerhard Stadelmaier und berichtet von herrlichen Streifzügen durch das "Desillusionserzähltheater" des jungen Autors. Aus den Logen des zwanzigsten und einundzwanzigsten Jahrhunderts könne man zuschauen, "wie böse uns das neunzehnte noch immer spiegelt". Begeistert streift der Chefkritiker durch die kleinen Geschichten, die er alle "irgendwo mitten im Leben" anfangen und dort auch wieder aufhören sieht und die kurzen Texte glitzern "wie Splitter im Licht". In seinen späteren Dramen habe Tschechow dem verklingen der Lebenshoffnungen länger nachgehört. Hier haue er sie kurz und schmerzlos in die Pfanne und grinse seinen "Depressionsfigürchen" höhnisch zu. Immer wieder ist Stadelmaier entzückt über diesen "rezeptlosen Doktor" und seinen Diagnosen, die er mit einem "italianisierend verschlenkerten" 'A. Tschechonte' unterschrieben fand. Lediglich dem Übersetzer der rund einhundertzwanzig Erzählungen verübelt er eine "slawische Umschrift-Marotte". Denn die nötigten ihn oft zum mühevollen Zurechtbuchstabieren ansonsten unlesbarer Namen.
© Perlentaucher Medien GmbH"
© Perlentaucher Medien GmbH"

Münzkunst der Libelle: Der junge Anton Tschechow erzählt die kleinen Splitter der großen Depression / Von Gerhard Stadelmaier
Die Leute, die in den sechziger Jahren aufgebrochen waren, um für mehr Freiheit, mehr Gerechtigkeit und ein "Bewußtsein des Volkes" zu kämpfen und dazu auch schon mal ein paar Steine oder gar Bomben geworfen haben, sind jetzt in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft hübsch am Drücker, haben aber, vollkommen angepaßt ans Reaktionäre, ihre alten Ideale längst verraten, halten große Reden, trinken Champagner, rauchen teure Zigarren, essen Gänseleber oder Eierchen vom Stör "an Blinys", kleiden sich beim besten Herrenschneider ein, schreien aber immer noch herum, krakeelen von "Reform!" und "Anstand!" und "Ausgleich!"
Doch sie schreien, süffeln, futtern und rauchen nur drinnen. Draußen geht schon lange nichts mehr. Das Land, eines der bedeutendsten und eigentlich zukunftsträchtigsten Europas, ist wie gelähmt in einer großen Depression. Eine große Reform täte not, ist aber seit zwanzig Jahren tot. Zugleich aber sind auch die großen Formen tot. Die gewaltigen Romane, die das Land noch einmal in seinem ganzen Wesen, seinen Träumen, Schmutz und Glanz erfaßten, sind längst geschrieben. Die Alten der Literatur sind tot oder verstummt. Neues ist nicht in Sicht oder tobt sich - trotz oder gerade wegen des allgemeinen Stillstands - als Spaßkultur aus. Alle leben schlecht und langweilig. Aber alle halten sich für ungeheuer wichtig und bedeutend. Und sind unsagbar schwermütig. Von der Literatur aber erwarten sie, daß sie ihnen "Richtung", "Visionen", "Meinungen" verschaffe. Man bittet also herzinnig um Lügen.
Wenn jetzt - wir befinden uns im Rußland von 1880 - ein Wind käme! Der da aber hochgelobt kommt im Namen des Windes und urplötzlich frisch und frech "in St. Petersburg Mode ist" und die Kritiker bezaubert, ist ein zwanzigjähriger Medizinstudent. Er schreibt unaufhörlich, im Bad, beim Essen, beim Spazierengehen, "mechanisch, überaus leichtsinnig, sorglos, unbesonnen, ohne an den Leser zu denken oder an mich". Seine Produktion ist massenhaft. Sechshundert Geschichten, Novellen, Erzählungen in kürzerster Zeit. Sofort aber hat er seinen Ton: die kürzeste Note, swingendes Staccato; seine Modulation: trockenwitzigste Knappheit; seine Melodie: aude sapere. Das heißt, übersetzt: Er läßt sich nichts vormachen. Er schreibt, "wie Reporter über Feuersbrünste schreiben": das, was er sieht, nicht das, was er träumt.
Der junge Mann gibt keine Richtung, keine Meinung, keine Ideologie vor. Er schwirrt wie eine schwerelose Libelle um alle und alles, erfaßt es und prägt es neu auf Papier. Seine kleinen Geschichten, die alle sehr kurz sind (im Durchschnitt zwölf bis sechzehn Druckseiten), haben keine Moral, meistens nicht einmal einen richtigen Schluß. Sie fangen irgendwo mitten im Leben an und hören dort auch wieder auf. Sie erscheinen in Zeitschriften, die wunderhübsche Namen tragen wie "Budilnik" (Der Wecker) oder "Oskolki" (Splitter) oder "Rasfletschenji" (Zerstreuung) oder "Strekosa" (Die Libelle) oder einfach "Sritel" (Der Zuschauer). Und sie rasseln denn auch höhnisch wie Wecker, schwirren wie Libellen, glitzern wie Splitter im Licht. Unterschrieben sind sie mit einem italienisierend verschlenkerten "A. Tschechonte".
Zehn bis zwanzig Jahre später wird er, todkrank, als Anton Tschechow berühmte Dramen schreiben, in denen er die Leute auf ihren verschuldeten Gutshöfen um 1900 dazu zwingt, sich selber zuzuschauen, wie sie ihr verfehltes Leben in kleinster Münze verscherbeln und verklingen lassen, sich aber immer nach dem großen Betrag sehnen. Das ist unsagbar traurig. Und seltsam komisch. Tschechow hört da dem verklingenden Silberklang länger nach. In seinen frühesten Erzählungen haut er die von ihm frisch geprägten Münzen kurz und schmerzlos auf den Tisch und in die Pfanne. Und über den Ton, den sie dabei machen, lächelt er kalt und schonungslos. Über den Ton des Stumpfsinns, der Langeweile, des falschen Lebens.
"O, wie alt und häßlich Sie geworden sind!" rufen in den späteren Dramen empfindsame, ältere lebenssüchtige Damen, wenn sie einem Mann begegnen, von dem sie alles erwarten würden, wenn sie nicht wüßten, daß sie nichts mehr von ihm erwarten dürfen. Der dramatische Mitfühler Tschechow läßt da den Verlust spüren.
"O, wie jung und häßlich Sie geworden sind!" scheint der junge Erzähler Tschechow allen seinen Depressionsfigürchen höhnisch zuzugrinsen: den in ein Gefühl, eine Karriere, ein Amt, eine Ehe oder nur in ein Wirtshaus aufbrechenden Minimalrevoluzzern. Sie wollen etwas verändern, und seien es nur ihre Finanzen oder ihre Kehle, ziehen sich aber mit eingezogenen Schwänzen wieder in die alte Hütte zurück, in der sie Kinder verprügeln, an ihren Frauen leiden oder an der Langeweile sterben. Und wenn sie auf die Jagd gehen, eines der Lieblingsmotive Tschechows, dann treffen sie nichts außer eine große Leere an, die sie vorzugsweise mit Alkohol auffüllen.
In den großen Dramen stirbt die Liebe komisch. In den kleinen Erzählungen sterben vorzüglich Komiker. Im "Kirschgarten" reißt irgendwo ein Seil in einem Bergwerk. Und man kann es als Riß im Leben nehmen. In der Erzählung "Ein Komiker" zerreißt "etwas" in des Komikers Brust. Er wird sterben. Aber alle seine Kollegen füttern ihn mit guten Worten und Rizinusöl. So stirbt der Komiker nicht komisch, sondern grausam, aber nebenbei. Tschechows Lakonie gibt dem Tod nicht mehr Raum als die Feststellung, daß er eben eintritt. Keine weiteren Anmerkungen.
Unter den Titeln "Er und sie" und "Ende gut" hat Peter Urban rund einhundertzwanzig der frühen Erzählungen Tschechows aus den Jahren 1880 bis 1887 versammelt, darunter viele bisher ins Deutsche nicht übersetzte. Auf über tausend Seiten kann man die Werkstatt eines Junggenies der Nüchternheit, eines literarischen Medizinalassistenten der russischen und der bürgerlichen Gesellschaft überhaupt durchwandern. Es ist kühl und frisch dort. Manchmal schaudert es einen ein bißchen. Immer aber ist man entzückt über den rezeptlosen Doktor: Er stellt die Diagnosen. Und die häufigste heißt: Lebens- oder Liebeslüge. Eine Therapie aber stellt er nicht in Aussicht.
Ein heiratswilliger Junggeselle, fett und geizig, verliebt sich in die Heiratsvermittlerin und wird sie unter seine Haube kriegen. Ein Eheunwilliger findet sich plötzlich in den Armen einer Frau, die er eigentlich verabscheut. Gescheite junge Männer werden dumm um ihre Mitgift geprellt. Männer schenken ihren Mätressen ein Lotterielos, um sie loszuwerden. Und das Los gewinnt dann Zehntausende von Rubeln. Das alles sind wenig mehr als Anekdoten, in deren Kern ein Drama, Dramen, deren Tragik ein Witz ist.
Darin macht die Stimmung nicht den Dialog, sondern der Dialog die Stimmung. So sind es nicht erzählte, es sind sozusagen gesprochene Erzählungen, Zungenübungen eines geborenen Dramatikers. Die Stimmung auf der Jagd, im Theater oder in der Ehe, den drei großen Illusionsspielplätzen par excellence, endet regelmäßig in einer großen Desillusion: Das Theater führt zur Schäbigkeit, die Ehe zur Einsamkeit, die Jagd zur entleerten Natur. Und der Mensch darin als größter Störfaktor.
Den Doktor zum Beispiel, der am Sterbebett des kleinen fiebrigen Jungen steht, der vielleicht sein Sohn ist, aber dessen Mutter von noch zwei weiteren Herren Alimentenzahlungen für den Jungen erhält, interessiert nicht die tödliche Hirnhautentzündung des Kleinen. Ihn peinigt allein die Ungewißheit seiner Vaterschaft. Grotesk und bitter und dumm - und absurd. Aber zugleich völlig wahrscheinlich. Die Seele des Doktors bekommt von Dr. Tschechow keinen Schlupfwinkel zugestanden, um sich zu erklären oder auszuweinen oder zu erholen. (Später, in den Dramen, wird es solche Winkel schon geben.) Hier steht vor aller Winkelei ein "Es ist so, Herrschaften! Akzeptiert, daß ihr so seid! Lebt damit! Basta!" Der junge Dr. Tschechow ist kein Psychologe. Er ist Anatom. Und skelettiert Glaube, Liebe, Hoffnung als ganz komische und kuriose Feinde des Menschen. Die Hoffnung aber als den größten unter ihnen.
Wenn man über die slawische Umschrift-Marotte des darin notorisch gewordenen Herausgebers bei den vielen russischen Namen auch in diesen beiden Bänden wieder einmal mühsam sich hinweggearbeitet und zum Beispiel einen "Vasilij Ivanyc" als lesbareren "Iwanitsch" zurechtbuchstabiert hat, dann kann man durch dieses Desillusionserzähltheater herrlich streifen und aus den Logen des zwanzigsten und einundzwanzigsten Jahrhunderts zuschauen, wie böse uns das neunzehnte noch immer spiegelt.
Anton Tschechow: "Er und sie". Frühe Erzählungen 1880 - 1885. "Ende gut". Frühe Erzählungen 1886 - 1887. Herausgegeben von Peter Urban. Diogenes Verlag, Zürich 2002. 2 Bände im Schuber, zus. 1146 S., geb., 45,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Als Stilist ist Cechov unerreicht, und der künftige Literarhistoriker wird, wenn er über das Wachstum der russischen Sprache nachdenkt, sagen, diese Sprache ist von Puschkin, Turgenjew und Cechov geschaffen worden.« Maksim Gorkij