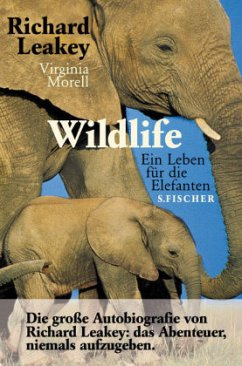In nur einem Jahrzehnt, von 1979 bis 1989, wurden dreiviertel aller Elefanten Kenias von gut organisierten Wildererbanden niedergemetzelt. Als Richard Leakey 1989 begann, den Kenya Wildlife Service aufzubauen, nahm er die größte Herausforderung seinesLebens an.
Die marodierenden Banden hatten die Naturparks Kenias fest in ihrer Hand. Ihnen gegenüber standen schlecht ausgebildete, teilweise korrupte Wildhüter, von denen der Großteil nicht einmal ein Paar Schuhe besaß. Doch Leakey gelang es, aus ihnen eine motivierte, schlagkräftige Truppe zu formieren, das Handelsverbot für Elfenbein durchzusetzen und so den Erhalt des Afrikanischen Elefanten vorerst zu sichern.
Seine packende Autobiografie erzählt die Geschichte dieses Engagements für die Naturschätze Afrikas, von seinen Siegen und Niederlagen und auch von dem Preis, den er dafür bezahlen musste: Bei einem Flugzeugabsturz, dessen Ursache nie geklärt werden konnte, verlor er beide Beine.
Richard Leakey ist ein Mann mit vielen Leben
Die marodierenden Banden hatten die Naturparks Kenias fest in ihrer Hand. Ihnen gegenüber standen schlecht ausgebildete, teilweise korrupte Wildhüter, von denen der Großteil nicht einmal ein Paar Schuhe besaß. Doch Leakey gelang es, aus ihnen eine motivierte, schlagkräftige Truppe zu formieren, das Handelsverbot für Elfenbein durchzusetzen und so den Erhalt des Afrikanischen Elefanten vorerst zu sichern.
Seine packende Autobiografie erzählt die Geschichte dieses Engagements für die Naturschätze Afrikas, von seinen Siegen und Niederlagen und auch von dem Preis, den er dafür bezahlen musste: Bei einem Flugzeugabsturz, dessen Ursache nie geklärt werden konnte, verlor er beide Beine.
Richard Leakey ist ein Mann mit vielen Leben

Richard Leakey, ein mutiger Mann mit vielen Talenten, kämpfte für das Überleben des afrikanischen Elefanten, fiel nieder, war verletzt, stand wieder auf und ging in die Politik
Sorgsam übereinander gestapelt, türmten sich die Stoßzähne sechs Meter hoch. Prachtstücke von alten Elefantenbullen waren bei den Wilderern ebenso konfisziert worden wie die kaum spannenlangen Zähnchen der Jungen. Am 18. Juli 1989 steckte der kenianische Präsident Daniel arap Moi diesen Berg aus Elfenbein in Brand. Mit einem speziellen Kunststoff überzogen, fingen die Stoßzähne bald Feuer. Eine Menge Benzin, Stroh und Holz taten ein Übriges, um sie vollends in Flammen aufgehen zu lassen.
Ehe Richard Leakey dieses feurige Fanal in Szene setzen konnte, musste er als frisch gebackener Leiter der Naturschutzbehörde viel Überzeugungsarbeit leisten. Warum das beschlagnahmte Elfenbein nicht lieber für gutes Geld verkaufen? Der vermutliche Erlös von einigen Millionen Dollar wäre den Nationalparks in Kenia gerade recht gekommen. Leakey fand die Infrastruktur in ebenso desolatem Zustand wie die Arbeitsmoral der Angestellten. Doch faule Kompromisse sind seine Sache nicht. Schließlich hat er das Direktorenamt nicht zuletzt deshalb angetreten, weil ihn die Sorge um die Afrikanischen Elefanten umtreibt.
Die Zahlen sind erschreckend: Während 1979 noch etwa 85 000 Elefanten durch Kenias Savannen streiften, tummeln sich dort zehn Jahre später nur noch rund 22 000. Wilderer metzeln ganze Herden nieder. Ihrer Stoßzähne beraubt, verwesen die Kadaver oft mitten in einem Nationalpark. Und in Kenia und anderen ostafrikanischen Ländern sind die Elefanten in Bedrängnis. Um sie vor dem Aussterben zu retten, fordert Leakey, muss der Handel mit Elfenbein gestoppt werden. Je eher die Preise mangels Nachfrage sinken, desto schneller dürften die Wilderer das Interesse an den Elefanten verlieren.
Mit dem spektakulären Scheiterhaufen für Stoßzähne stellt sich Kenia an die Spitze der Staaten, die ein völliges Verbot des Elfenbeinhandels fordern. Auf der folgenden Tagung über das Washingtoner Artenschutz- Übereinkommen kann sich diese Fraktion tatsächlich durchsetzen: Im Oktober 1989 kommt der Afrikanische Elefant, Loxodonta africana, auf die Liste der umfassend geschützten Arten. Da es für Elfenbein nun keinen legalen Markt mehr gibt, müssen die Produzenten von Kunst, Kitsch und Klaviertasten zu anderen Materialien greifen. Damit bricht auch für die illegale Ware der Absatzmarkt weg.
In Kenia macht den Wilderern aber nicht nur der Preisverfall zu schaffen. Als Direktor der Naturschutzbehörde nimmt Leakey den Kampf mit ihnen auf. Die Wildhüter erhalten nun eine ordentliche Ausrüstung: Geländewagen, Flugzeuge, Nachtsichtgeräte, halbautomatischen Waffen. Leakey rückt der grassierenden Korruption zu Leibe. Wer mit Wilddieben gemeinsame Sache gemacht hat, muss gehen. Binnen kurzem wird ein Gutteil der alten Belegschaft versetzt oder in den Ruhestand geschickt.
Um einen effizienten „Kenya Wildlife Service” aufzubauen, sind freilich nicht nur Durchsetzungskraft und Organisationstalent gefragt. Es gilt auch die finanziellen Mittel – Kredite und Spenden – aufzutreiben. Binnen weniger Jahre, so die optimistische Planung, soll sich die Naturschutzbehörde selbst finanzieren. Einnahmen sollen die Touristen bringen, die sich den Anblick von Giraffen, Löwen und Elefanten einiges kosten lassen.
Leakey ist fest entschlossen, den Kenya Wildlife Service zum Erfolg zu bringen. Auch Schicksalsschläge – durch einen Flugzeugabsturz verliert er 1993 beide Unterschenkel – können ihn nicht entmutigen. Auf der politischen Ebene wird er allerdings zunehmend mit Anfeindungen und Misstrauen konfrontiert. Dass die Aussicht auf Geld von der Weltbank Begehrlichkeiten weckt, wundert ihn zwar nicht. Dass man ihm regelwidrige Amtsführung, ja sogar staatsfeindliche Umtriebe vorwirft, kränkt ihn jedoch zutiefst. Als er sich völlig im Stich gelassen glaubt – auf Rückendeckung durch den Präsidenten hofft er vergeblich – tritt er 1994 enttäuscht von seinem Amt zurück.
Dass ausgerechnet David Western sein Nachfolger wird, kann Richard Leakey nicht versöhnlich stimmen. Seine Beziehungen zu diesem Ökologen sind seit langem von inniger Abneigung geprägt – über zeitgemäßen Naturschutz haben die beiden allzu unterschiedliche Vorstellungen. Leakey setzt vor allem auf die Nationalparks als Refugium für die heimische Tierwelt.
Für Western ist „Wildlife” etwas ganz anderes. Statt sich speziell um Elefanten und Nashörner zu kümmern, hat er das gesamte Spektrum der Fauna und Flora im Blick. Auch außerhalb der Schutzgebiete, die nur acht Prozent der Landesfläche ausmachen, will er der Tier- und Pflanzenwelt eine Überlebenschance sichern. Deshalb plädiert er für intensive Zusammenarbeit mit der einheimischen Bevölkerung. Nach seiner Überzeugung werden die Bewohner des Landes dessen natürliche Ressourcen schätzen und schützen, wenn sie davon einen handfesten Nutzen haben. So könnten zum Beispiel Zebraherden Fleisch und Felle liefern, von bestimmten Bäumen lassen sich Weihrauch und Myrrhe abzapfen, und an der Küste könnte man Seegurken als Delikatesse züchten, ohne die Umwelt zu schädigen.
Ob diese Rechnung aufgegangen wäre, muss dahingestellt bleiben. Selbst wenn David Western darauf verzichtet hätte, den Kenya Wildlife Service von Grund auf umzukrempeln, hätte er dort keinen leichten Stand gehabt. Sein Vorgänger war allzu populär. In Kenia geboren und aufgewachsen, ist Richard Leakey schon in jungen Jahren als Leiter des Nationalmuseums in die Fußstapfen seines Vaters getreten. Seine Eltern hatten sich einen Namen gemacht, als sie in Tansania und Kenia fossile Urahnen des Menschengeschlechts aufspürten. Ihr wissenschaftlicher Erfolg ebnete dem Sohn den Weg. Richard Leakey begann eine Karriere, bei der vor allem Manager-Qualitäten gefragt waren – für eine wissenschaftliche Ausbildung hat er sich nie erwärmen können. Als wahre Herausforderung erwiesen sich jedoch nicht die fossilen Knochen, sondern Gebeine neueren Datums, Überreste von gewilderten Elefanten.
Dass er sein Reformkonzept für Kenias Naturschutzverwaltung nicht zu Ende führen konnte, war für Leakey eine tiefe Enttäuschung. Um so größer mag seine Genugtuung gewesen sein, als er 1998 gebeten wurde, noch einmal die Leitung des Kenya Wildlife Service zu übernehmen. Und das, obwohl er sich mittlerweile in der politischen Opposition engagiert, ja sogar einen Sitz im Parlament errungen hatte. Ein gutes Jahr brauchte er, um die Naturschutzbehörde zu reorganisieren. Dann wechselte er erneut in die große Politik: „Heute kommt es mir vor, als seien die Elefanten – Mütter, Tanten und spielende Babys – weit weg. Aber vergessen habe ich sie nicht. Jeder Schritt, mit dem meine Kollegen und ich unserem Land zu mehr Demokratie und Wohlstand verhelfen, trägt auch zur Rettung der Elefanten bei.”
Dass diese Geschichte auch zwischen zwei Buchdeckeln sehr lebendig daherkommt, ist Virginia Morell zu danken. Notizen, Tagebücher und persönliche Gespräche dienten der versierten Journalistin als Grundlage für Leakeys Autobiografie. Mit viel Sympathie zeichnet sie das Bild einer tatkräftigen Persönlichkeit, die sich unbeirrbar für eine gute Sache einsetzt. Kämpferisch und keineswegs zimperlich, eckt Leakey mitunter an. Doch sein rückhaltloser Enthusiasmus gepaart mit taktischem Geschick nötigt auch seinen Kritikern Bewunderung ab.
DIEMUT KLÄRNER
RICHARD LEAKEY, VIRGINIA MORELL: Wildlife. Ein Leben für die Elefanten. Aus dem Englischen von Sebastian Vogel. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2002. 415 Seiten, 24,90 Euro.
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.diz-muenchen.de

Im Abenteuerland: Die Autobiographie des kenianischen Naturschützers und Politikers Richard Leakey / Von Andreas Obst
Für seine bisher letzte Aufgabe im Dienst des kenianischen Staats hatte Richard Leakey ein großes Büro im State House von Nairobi bezogen, im selben Gebäude wie der Präsident. Das Zimmer war karg möbliert, die Klimaanlage keuchte asthmatisch, und das Beeindruckendste der Einrichtung waren die acht Telefonapparate in seiner Reichweite. Fünf standen vor ihm, drei neben dem Videorekorder. An jenem Morgen saß Leakey aufrecht hinter seinem Schreibtisch und begrüßte die Besucher mit der Bemerkung, seine Zeit sei begrenzt. Sein Lächeln war kaum breiter als ein Bleistiftstrich. Er trug ein blaues Hemd und eine rote Krawatte mit einem Muster aus winzigen blauen und gelben Elefanten, und sein Gesicht war gerötet.
Freimütig sei Leakey, bestimmend, bisweilen auch grob und unhöflich, heißt es über ihn seit je in Kenia, und kaum einen Unterschied gibt es in den Einschätzungen von Freunden und Feinden. Auf beiden Seiten schwingt stets Respekt mit. Sogar, wenn er über sich selbst spricht, bestätigt er die Klischees. Er trage das Herz auf der Zunge, sagt er, und daß ihm Grübelei zuwider sei. Gewohnt sei er es, Entscheidungen zu treffen und danach zu handeln.
Wie kaum ein anderer kennt Richard Leakey die unterschiedlichen Ebenen des öffentlichen Lebens in Kenia aus eigener Anschauung und ganz unterschiedlichen Blickwinkeln. Der heute Siebenundfünfzigjährige, weißer Kenianer der dritten Generation, begann seine Karriere als Mitarbeiter seines Vaters, des Paläontologen Louis S. Leakey. Doch dem Sohn war es vorbehalten, gestützt auf Schädelfunde an den Ufern des Turkanasees im Norden Kenias und in Äthiopien, den Nachweis zu führen, daß der Mensch aus Afrika stamme und nicht, wie zuvor angenommen, aus Asien. Über seine Theorien, die er immer wieder durch aufwendige Feldforschungen bestätigen konnte, schrieb er zahlreiche Bücher. Sie begründeten seinen Ruf als Experte für die Frühgeschichte der Menschheit.
In den siebziger und achtziger Jahren leitete Leakey das kenianische Nationalmuseum in Nairobi, 1989 ernannte ihn Präsident Daniel arap Moi zum Direktor der staatlichen Naturschutzbehörde. Indem er den Kenya Wildlife Service als unabhängige Institution abseits der Gespinste kenianischer Verwaltung formte, gegen die Wilderer in den Nationalparks ebenso unerbittlich vorging wie gegen Schlamperei und Korruption innerhalb der eigenen Behörde, geriet er schnell mit Mois absolutistischer Clique aneinander. Nach fünf Jahren trat er von seinem Posten zurück, engagierte sich in der Oppositionsbewegung und zog weiteren Unmut der Mächtigen auf sich. Dennoch berief ihn Moi neuerlich an die Spitze des Kenya Wildlife Service, und im Sommer 1999 machte er ihn sogar zum Ständigen Sekretär, Staatssekretär und Leiter des öffentlichen Dienstes. Als Chef einer halben Million Beamter bekleidete er den zweitwichtigsten politischen Posten im Lande. Es war die Zeit im State House mit den acht Telefonen. Sie endete fast auf den Tag genau vor einem Jahr. Diesmal gab Leakey keinen Grund für den Rücktritt an.
In der Zeit, die seitdem vergangen ist, schrieb er seine Autobiographie. So jedenfalls wird das Buch mit dem Titel "Wildlife - Ein Leben für die Elefanten" vom Verlag angekündigt. Daran ist zweierlei falsch. Leakey ist nicht der Autor des Buches. Die eigentliche Kärrnerarbeit des Erzählens übernahm die amerikanische Journalistin Virginia Morell, die schon früher als Autorin für Leakey gearbeitet hatte. Ihren Stil - oder das, was in der deutschen Fassung daraus geworden ist - würde man nicht unbedingt als elegant bezeichnen, das Buch liest sich über weite Passagen mühsam, stellenweise langweilt es durch Redundanz.
Zum anderen wird enttäuscht, wer von diesem Buch die Lebensgeschichte Richard Leakeys erwartet, die tatsächlich gleichwohl die Handlung eines Abenteuerromans abgeben könnte. Wenig davon ist hier zu finden. Es geht fast ausschließlich um seine Zeit als Leiter des Kenya Wildlife Service. Erzählt wird in allen Einzelheiten, wie er den Wilderern in den Nationalparks durch eine neue, militärisch gedrillte und ausgerüstete Truppe das Handwerk legte, wie gleichzeitig auf seine Initiative hin der internationale Handel mit Elfenbein geächtet, kurz darauf sogar verboten wurde. In Kenia, das immerhin kann einem durch die Lektüre bewußt werden, hat Leakeys Entschiedenheit die Elefanten wohl vor dem Aussterben bewahrt. Von 85 000 Tieren im Jahre 1979 waren bei Leakeys Amtsantritt nicht mehr als 22 000 übriggeblieben, die anderen hatten organisierte Wildererbanden des Elfenbeins wegen erschossen.
Was vor und nach seiner Zeit beim Kenya Wildlife Service geschah, nimmt nicht mehr als ein Zehntel der reichlich vierhundert Seiten in der deutschen Fassung ein. Leakey konzentriert sich für dieses Buch ganz auf seine erste Amtszeit an der Spitze der Behörde. Es ist eine eigenartige Form der Erinnerung, mitunter geradezu detailsüchtig, ohne wirkliches Augenmaß für tatsächlich Entscheidendes; selbstreferentiell, was in der Natur seines beständigen Gegen-Mauern-Anrennens liegen mag, jedoch immer wieder aufgefangen von einer Art der Distanzierung, die offenkundig den Eindruck zu vermeiden sucht, hier trete der Erzähler vor die Sache, von der er erzählt. Damit wird seiner Geschichte freilich auch immer wieder die Dynamik ausgetrieben. Den Eindruck stellenweiser Leblosigkeit vermag auch nicht die angloamerikanische Tricktechnik biographischen Erzählens zu korrigieren, die sich bemüht, den bisweilen doch eher zähen Fluß der Erinnerung durch eingeschobene Dialoge und die Beschreibungen beschleunigter Bewegungen aufzulockern. Daß die Dialoge hier oft die doch eher formelhafte Gestalt von Grundsatzaussagen, ja Slogans annehmen, macht sie nicht unbedingt glaubwürdiger.
Wer die Karriere Richard Leakeys mit ihren hoch aufragenden Meilensteinen bereits vor dieser Autobiographie verfolgt hat, kennt die dramatischen Höhepunkte seines Lebens aus anderen Zusammenhängen. Wem das Schicksal dieses Mannes fremd war, der wird womöglich lange vor dem Ende das Buch enttäuscht aus der Hand legen. Zu unentschieden, gelegentlich gar geschwätzig nimmt die Chronologie seines Kampfs für die Fauna Kenias und gegen die Unvollkommenheit der Menschen ihren Fortgang, zu unterkühlt bleibt seine persönliche Beteiligung. Bei der Lektüre nimmt man ihm die Leidenschaft nicht ab, die seine Karriere in manche Sackgasse geführt hat, ihn selbst mehrfach sogar in Lebensgefahr.
Vielleicht war die Erwartung an das Buch als Schlüsselbericht aus dem Epizentrum kenianischer Machtentfaltung zu hoch. Diesen Anspruch hatte nicht zuletzt Leakey selbst erzeugt, durch sein über Jahre mitunter fast starrsinniges Beharren auf einem Gerechtigkeitsbegriff, der in unserer Zeit, zumal im Afrika der Despoten nach den Ungerechtigkeiten der Kolonialzeit, eigenartig unmodern erscheinen mag. In diesem Sinne hat Leakey etwas von einem romantischen Helden, und genau so ist er vor allem im Ausland immer wieder porträtiert worden. Zum Titanenkampf um allerletzte Dinge stilisiert wurden seine Konfrontationen mit Moi, der, beugt er nicht noch im letzten Augenblick die Verfassung, in diesem Jahr seine letzte Amtszeit beenden muß - nach mehr als zwei Jahrzehnten an der Macht. Sogar Beobachter mit weniger Pathos haben gelegentlich angemerkt, daß Leakey zuzeiten immerhin auch eine willfährige Figur des gewieften Taktierers Moi abgegeben hat: Indem er sich in hohe Ämter komplimentieren ließ, stellte er seine eigene Integrität in den Dienst des Staates.
Was Leakey in seinem Buch als Heldenerscheinung letztlich ganz und gar untauglich macht, ist die unbedingte Loyalität zu Kenia, seinem Land, wie er einmal ganz nebenbei bemerkt. Diese Loyalität hält er auch dem Präsidenten gegenüber aufrecht, der ihn einst als "entschieden" und "integer" pries, später als "Rassisten" und "Neo-Kolonialisten" beschimpfte. Der Verlauf von Leakeys Karriere hat keinen Zweifel daran gelassen, daß sich der Unbeugsame oft genug in greller Opposition zum Präsidenten und seiner Clique befand. Vielleicht war dies tatsächlich immer so offensichtlich, daß Leakey nun, da sich ihm die Gelegenheit bietet, darauf verzichten kann, genau das über Moi niederzuschreiben, was der Leser erwarten würde. Auf der letzten Seite des Buchs bedankt er sich sogar bei dem Präsidenten - dafür, "daß er mir 1989 die Gelegenheit gab, den Kenya Wildlife Service aufzubauen".
Richard Leakeys Autobiographie endet im Frühjahr des vorigen Jahres, nach seinem Rücktritt als Leiter des öffentlichen Dienstes. Heute komme es ihm vor, "als seien die Elefanten weit weg. Aber vergessen habe ich sie nicht", schreibt er noch. Er werde sich aus dem politischen Geschäft zurückziehen, ließ er unlängst verlauten, er habe keine Ambitionen mehr. Auf seiner Farm im Rift Valley wolle er sich nun ganz dem Weinanbau widmen. Vielleicht macht ja der Hollywood-Film über sein Leben, von dem seit Jahren immer wieder die Rede ist, Richard Leakey zu dem Helden, der er womöglich wirklich ist.
Richard Leakey, Virginia Morell: "Wildlife". Ein Leben für die Elefanten. Aus dem Englischen von Sebastian Vogel. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2002. 415 S., geb., 24,90
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Als Chef der Tierschutzbehörde in Kenia leistete Richard Leakey unter schwierigsten Bedingungen hervorragende Arbeit, und machte aus dem maroden, korrupten Betrieb in kurzer Zeit eine moderne, effiziente Naturschutzbehörde, berichtet Rezensent Michael Bitala. Das Buch, das der Sohn des berühmten Anthropologenpaars Louis und Mary Leaky, nun geschrieben hat, findet Bitala enorm spannend. Dennoch zeigt er sich enttäuscht. Grund dafür ist, dass Leakey sich ganz auf die fünf Jahre seiner Zeit als Chef der Tierschutzbehörde in Kenia konzentriert. Dabei gehört gerade Leakys Zeit nach 1994 für Bitala zu seinen spannendsten und ungewöhnlichsten Lebensabschnitten: Nachdem Daniel arap Moi, despotischer Präsident Kenias, Leakey aus dem Amt befördert hatte, weil er die Korruption in den eigenen Reihen zu effektiv bekämpfte, engagierte sich Leakey in der Opposition, wo er von Moi mit harten Bandagen bekämpft wurde. Überraschenderweise ernannte ihn Moi 1999 in einer neuen Wendung zum zweitmächtigsten Mann im Land, und betraute ihn mit der Aufgabe, den völlig korrupten Staatsdienst aufzuräumen - ein aussichtsloses Unterfangen, weiß Bitala. Für "ziemlich bizarr" hält Bitala daher Leakys milde Beschreibung von Moi als "väterlichen Herrn, dem das Wohlergehen seines Landes dringlichste Aufgabe sei."
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH