Das Jahr 1914 beginnt für Iwan Bunin ruhig und produktiv. Auf Capri beendet er Erzählungen wie diejenige über den alten Diener Arsenitsch, der im Hause seiner ehemaligen Herrschaft Geschichten von Heiligen erzählt, die die Kinder schaudern machen, oder die über einen ceylonesischen Rikschafahrer - eine Abrechnung mit kolonialen Verhältnissen, wie er sie während seiner Ceylon-Reise erlebt hatte. Auch die Galerie seiner Porträts vom Land setzt Bunin fort - etwa mit der Waise Klascha, die nach dem Tod der Pflegemutter deren Landgasthof retten möchte. Der Kriegsausbruch im Sommer 1914 lässt Bunin fast verstummen.Doch 1915 entstehen zwei seiner berühmtesten Erzählungen: die »Grammatik der Liebe« und »Ein Herr aus SanFrancisco«, die facettenreiche, beklemmende Erzählung vom Tod eines reichen Amerikaners auf Capri. Sie gehörtzu den besten Novellen der Weltliteratur.

Klarsichtig: Iwan Bunins Blicke in berstende Gesellschaften
Gelassenheit. Höchste poetische Genauigkeit, die hie und da ganze Ketten malerischer Adjektive nach sich ziehen kann. Große Bögen des Erzählens, in denen ein Satz sich auch schon mal über einen langen Absatz hinzieht, ohne dass beim Lesen ein Gefühl der Überfülle oder der Atemlosigkeit entstünde. Ganz im Gegenteil: Ruhe und Ökonomie sind bei dem russischen Autor Iwan Bunin alles, im Gegensatz zur Zeit, in der er lebte. Geboren 1870 in Woronesch, emigrierte er 1920 nach Paris und starb 1953 im französischen Exil.
Was Bunin sich zu erzählen vornimmt – und das können die unterschiedlichsten Begebenheiten und menschlichen Beziehungen aus verschiedenen Gesellschaftsschichten und Ländern sein –, fließt vordergründig federleicht dahin, obwohl es in den Geschichten zumeist um Leben und Tod geht.
Sieben Erzählungen aus den Jahren 1914 und 1915 versammelt der Band „Ein Herr aus San Francisco“, und obwohl von der vorrevolutionären russischen Freiheitsbewegung nur in einem Fall – unter dem ironisch trügerischen Titel „Eine Geschichte für die Weihnachtszeit“ – ausdrücklich die Rede ist, spürt man es im gesellschaftlichen Gefüge hier schon knacken und krachen. Noch scheinen die Verhältnisse zwischen Oben und Unten festgefügt, wie die Herrschaftstradition es will, doch haben die Figuren zugleich schon ein viel zu scharf umrissenes Bild von ihrer Position, deren Bedingungen und Folgen, als dass alles noch auf längere Zeit in Bewegungslosigkeit verharren könnte.
Es ist Iwan Bunins Meisterschaft geschuldet, dass selbst zeitlich wie gesellschaftlich Entlegenes hier augenblicklich nah heranrückt, in seiner Komik wie in seiner Tragik, vor allem aber in seiner Sinnlichkeit. Und so folgt man selbst der Geschichte über einen alten russischen Bettler und einen verkommenen ehemaligen Bauern, die sich zu Beginn des vorigen Jahrhunderts zufällig irgendwo auf dem flachen Land in einem Wirtshaus treffen, miteinander zu reden und zu trinken beginnen, rasch mit angespanntem Interesse – dass diese Begegnung nicht gut ausgehen wird, ist bald zu ahnen. Doch wer am Ende das Opfer sein wird, bleibt im scheinbar balancierten Kräfteverhältnis bis kurz vor Schluss offen.
Auch die kuriose, nachgerade verschrobene Erzählung über einen früheren Bediensteten auf einem russischen Gut, der den beiden kleinen Söhnen der Herrschaft abends verbotenerweise blutrünstige, ganz und gar nicht jugendfreie Geschichten von nachmaligen Heiligen erzählt, nimmt uns sofort gefangen – krachende Knochen, abgeschlagene Köpfe und wilde Hurerei werden vom alten Arsenitsch in grellen Farben ausgemalt, während gleich nebenan die feine Gesellschaft einen Ball mitsamt üppigem Bankett genießt.
Zwei Geschichten aber ragen noch einmal besonders heraus, und wohl nicht zufällig sind beide außerhalb Russlands angesiedelt, an Orten, die Iwan Bunin, Russlands erster Literaturnobelpreisträger von 1933, bereist hatte: Er, der einen so liebevollen wie unerbittlichen Blick auf das Land hatte, das er aus politischen Gründen 1920 verließ, sah sein Land immer im Welt-Zusammenhang. Die Erzählung „Brüder“ spielt auf Ceylon, die titelgebende Erzählung des Bandes dann auf Capri, und beide handeln vom bevorstehenden Ende der herrschenden Klasse.
So trifft in Colombo ein in Geschäften umherreisender Engländer auf einen jungen Rikscha-Kuli, und was zunächst wie das übliche Herr-Knecht-Verhältnis wirkt – der Engländer, ein ehemaliger Oberst der britischen Kolonialmacht, lässt sich einen Tag lang von dem schönen, zähen Wilden durch die Hitze der Stadt chauffieren –, entfaltet nach und nach zwei höchst gegensätzliche Lebensdramen. An deren Ende tötet sich der Kuli mittels einer Giftschlange, nachdem er seine Braut als Prostituierte in einem herrschaftlichen Haus erkannt hat. Der Engländer aber gesteht nach seiner überstürzten Abreise einem Schiffskapitän die zahllosen Toten, die er während seiner Dienstzeit auf sein Gewissen geladen hat.
„Ein Herr aus San Francisco“ schließlich führt in ein Szenario, das an den „Tod in Venedig“ denken lässt – mit Thomas Mann’schem Behagen an der hochmögenden Verkommenheit der Privilegierten ist die Geschichte vom reichen, ältlichen Amerikaner denn auch erzählt, der mit Frau und Tochter auf eine zweijährige Europareise geht und, im Luxushotel auf Capri angelangt, nach einem zweimal wiederholten „Es ist furchtbar!“ plötzlich stirbt. Sichtlich findet Bunin Vergnügen daran zu zeigen, wie sofort darauf das eben noch devote Verhalten der Hotelangestellten Frau und Tochter gegenüber in sein Gegenteil umschlägt: Nicht einmal einen Sarg will man dem Toten noch zugestehen, er wird in eine Sodawasserkiste getan.
Auf die Frage, weshalb er denn trotz seines Alters unbedingt noch viele Jahrzehnte leben wolle, hatte Bunin Arsenitsch, seinen Erzähler der schaurigen Heiligen-Legenden, antworten lassen: „um zu leben, zu schauen, Gottes Welt zu bestaunen“. Derselbe Wunsch hat offenbar den Autor selbst zum Schreiben bewegt – und der gibt ihn umstandslos an seine Leser weiter.
FRAUKE MEYER-GOSAU
Erzählungen vom Ende
einer manchmal glanzvoll
herrschenden Klasse
Iwan Bunin: Ein Herr
aus San Francisco.
Erzählungen 1914/1915.
Aus dem Russischen von Dorothea Trottenberg.
Dörlemann Verlag,
Zürich 2017.
239 Seiten. 25 Euro.
E-Book 18,99 Euro.
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Die Erzählungen, die der Exilautor und erste russische Nobelpreisträger Iwan Bunin zwischen 1913 und 1915 verfasst hat, versammeln Geschichten aus der russischen Provinz, so Rezensent Ulrich M. Schmid. Die Schilderung des bäuerlichen Milieus empfand Schmid als besonders authentisch. Bunin spreche die großen gesellschaftlichen Missstände wie Korruption, Alkoholismus, Gewalt und Inzest an, meist gekleidet in die einfachen Deutungskategorien, die seinen bäuerlichen Helden zur Verfügung stehen, so Schmid. Dass der Autor trotz reduzierter Sprache und Verzicht auf Innensicht Bewusstseinszustände transportieren könne, hat den Rezensenten besonders beeindruckt. Er freut sich, dass der Dörlemann-Verlag diesem "Meister in der höchst expressiven Darstellung der Condicio humana" in edlen, dunkelblau eingebundenen Bänden ein Denkmal setzt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Dass unsere Literaturlandschaft so vielfältig ist, verdankt sich engagierten Kleinverlagen, die bei ihren Büchern auf Qualität und Originalität setzen. Drei aktuelle Beispiele.
Wir befinden uns in den "heiligen Tagen", jener Zeit zwischen Weihnachten und Dreikönigstag, in der sich die Russen traditionell unheimliche Geschichten erzählen. Und russische Zeitschriften solche Geschichten drucken. Deshalb verfasste Iwan Bunin schon im Sommer 1914 eine Erzählung, die dann ein halbes Jahr später veröffentlicht werden sollte. Da hieß sie schlicht "Eine Geschichte für die Weihnachtszeit", in späteren Buchausgaben sollte sie den Titel "Eine Archivsache" tragen. Das Unheimliche kommt hier auf leisen Sohlen daher: als ein Archivar namens Fissun, der sich seiner eigenen Bedeutung als Bewahrer allen Geschehens bewusst und doch unterwürfig ist - bis er sich einmal erdreistet, die den höheren Kreisen vorbehaltene Toilette im Verwaltungsgebäude zu benutzen. Die Folgen sind drastisch.
Bunins seltsame Weihnachtsgeschichte entstand unmittelbar vor Kriegsausbruch, als er noch allein für ein russisches Publikum schrieb. Das änderte sich nach dem Ersten Weltkrieg, und nicht nur deshalb, weil er als Gegner der Revolution ins französische Exil ging, sondern vor allem, weil seine 1915 verfasste Erzählung "Ein Herr aus San Francisco" fünf Jahre später international Furore machte. Sie führte den weltpolitisch prekären Moment ihrer Entstehung am Beispiel eines anonymen Amerikaners vor, und als Bunin 1933 als erster russischer Schriftsteller überhaupt den Literaturnobelpreis erhielt, würdigte Per Hallström, der damalige Sekretär der Schwedischen Akademie, diese Novelle in seiner Ansprache als "Vorzeichen des Untergangs einer Zivilisation, als Verurteilung der großen Schuldigen an einem Drama, das zum Teil durch die Dekadenz der Kultur verursacht wurde". Bunin verdankt seinen Nobelpreis entscheidend dieser Erzählung.
Nun gibt sie dem jüngsten Band seiner im Schweizer Dörlemann Verlag erscheinenden Werkausgabe den Titel: "Ein Herr aus San Francisco" versammelt jene Geschichten, die Bunin 1914 und 1915 schrieb; es sind nur sieben, weil ihn der Kriegsausbruch erschütterte und monatelang verstummen ließ. Aber sie bilden ein Septett, das in der Weltliteratur kaum seinesgleichen hat. Hier öffnet sich ein Meistererzähler, der sich zuvor literarisch nur für das russische Landleben und dessen Abgründe interessiert hatte, der Welt: "Brüder" von 1914 führt das traurige Schicksal eines ceylonesischen Rikscha-Fahrers mit dem eines englischen Kolonialherren zusammen, und "Ein Herr aus San Francisco" führt allegorische und philosophische Motive aus jener Erzählung ebenso weiter wie deren globalen Blick - Bunin fand seine Skepsis gegenüber Menschen und seine Naturbegeisterung nun auch jenseits der russischen Heimat.
Das Bemerkenswerte an dieser Ausgabe ist nicht nur, dass hier soweit möglich jeweils die Erstausgaben als Grundlage der Übersetzungen herangezogen werden - Bunin pflegte für spätere Nachdrucke Veränderungen vorzunehmen -, Dorothea Trottenberg findet auch den richtigen sachlichen deutschen Ton für die Buninsche Präzision, aus der die Naturbeschreibungen wie Glanzlichter erstrahlen. Wobei sich die Bunin-Begeisterung bei Dörlemann dem Erfolg eines winzigen Bandes verdankt, den der Verlag 2003 herausgebracht hatte: Swetlana Geiers Übersetzung der unscheinbaren, aber umso ungewöhnlicheren Liebeserzählung "Ein unbekannter Freund" aus dem Jahr 1923. Damit war Bunin plötzlich wieder auf Deutsch präsent, und mit der chronologisch geordneten Erzählungsausgabe, deren erster Band 2010 erschien, entsteht Stück für Stück die faszinierendste Klassikerausgabe, die wir haben - ein höchst ambitioniertes Langzeitprojekt für einen Kleinverlag, denn Bunin lebte und schrieb bis 1953, und schon die bis 1915 entstandenen Geschichten umfassen sechs Bände. Aber jeder lohnt sich, und der jüngste ist geradezu ein Wunder. Unheimlich in jeder Beziehung.
ANDREAS PLATTHAUS.
Iwan Bunin: "Ein Herr aus San Francisco". Erzählungen 1914/1915.
Aus dem Russischen von Dorothea Trottenberg. Dörlemann Verlag, Zürich 2017. 240 S., geb., 25,- [Euro].
Gleich zu Beginn fragt der Erzähler sich und seine Leser, was es eigentlich mit der Liebe auf sich habe, zitiert den einschlägigen Korintherbrief und den nicht weniger einschlägigen Jazz-Standard "You don't know what love ist", streift die griechische Mythologie und die Naturkunde, um dann rasch auf den historischen Kern des Romans loszusteuern: Es geht um einen Mord, der am 5. Juni 1901 in Tiflis verübt wurde. Das Opfer war eine knapp vierunddreißigjährige gebürtige Norwegerin namens Dagny Juel, die mit dem polnischen Schriftsteller Stanislaw Przybyszewski verheiratet und mit ihrem fünfjährigen Sohn Zenon und ihrem Liebhaber Wladyslaw Emeryk in die georgische Metropole gereist war.
Einen "Seelenvampir" nennt der Erzähler die Frau, die er zur Hauptfigur seines Romans macht, eine, die "sexuelle Angst in die zerstörerische Ästhetik des Fin de Siècle" verwandelt habe und dergleichen mehr. Was sich an Mythen um Dagny Juel rankt, die Affären mit zeitgenössischen Berühmtheiten wie Edvard Munch, August Strindberg oder dem Verfasser von "Quo Vadis", Henryk Sienkiewicz, unterhielt, greift er auf, spinnt die Fäden weiter, scheut keinen Umweg und landet schließlich in einer phantastischen Geschichte um das romantitelgebende "Fest der Liebe", einberufen in Tiflis von Schamanen, die die Katastrophen des zwanzigsten Jahrhunderts vorausahnen und verzweifelt versuchen, sie auf diese Weise zu verhindern. Eine Rolle spielen dabei das georgische Nationalepos, der Heilige Gral, ein ewiger Wettstreit zwischen Löwen und Leoparden, der Naturphilosoph Wascha-Pschawela, der junge Stalin und natürlich Dagny Juel.
"Unglücklicherweise ist das Liebesmahl von Tiflis gescheitert, durch Nachlässigkeit und einen schmutzigen Trick falscher Schamanen", schreibt der Erzähler verheißungsvoll ebenfalls zu Beginn des Romans. Dass wir einer höchst fragwürdigen Stimme lauschen, einem obsessionsgetriebenen Erzähler, der sich gern in Halluzinationen hineintrinkt, wird rasch deutlich, und aus der sich dadurch notwendig aufbauenden reservierten Haltung des Lesers und den immer neuen Volten des Erzählers, der offensichtlich um den Leser ebenso kämpft wie um ein Bild von Dagny, entwickelt der Roman einen eigenen Reiz.
Unterbrochen ist die Handlung, die im Juni 1901 in Tiflis spielt, durch Rückblicke auf Dagnys Leben, die erkennen lassen, welches verhängnisvolle Beziehungsgewebe zwischen ihr, ihrem Mann und ihrem späteren Mörder sowie einer Fülle weiterer Personen schon vor dem Aufbruch nach Georgien bestand, was zugleich immer wieder die Frage aufwirft, wie zwangsläufig die Entwicklung war, die dann zum Mord an Dagny führte.
Der georgische Autor Zurab Karumidze, geboren 1957 in Tiflis und ausgewiesener Jazzkenner, schrieb "Dagny" 2011 ursprünglich auf Englisch, so dass mit dieser Übersetzung das Buch kurioserweise auf Deutsch vorliegt, nicht aber in der Muttersprache des Autors. Vielleicht richtet es sich aber auch gar nicht so sehr an die Georgier selbst: Wer jedenfalls im Jahr des georgischen Gastlandauftritts auf der Frankfurter Buchmesse als Fremder einen Blick auf populäre Mythen und Gestalten der Geschichte des Landes werfen will, vermengt mit haarsträubenden, geradezu Sterne-haften Abschweifungen zur Sprache und Kultur, der findet davon hier reichlich.
TILMAN SPRECKELSEN.
Zurab Karumidze: "Dagny oder Ein Fest der Liebe". Roman.
Aus dem Englischen von Stefan Weidle. Weidle Verlag, Bonn 2017. 288 S., br., 23,- [Euro].
In der Kürze liegt die Würze - das gilt oft insbesondere für die roten Leinen-Bände des Wagenbach-Verlags, die schon manche Weltliteratur enthielten. Auf die Idee, umfangreiche Werke der Weltliteratur einzudampfen und nach Lust und Laune umzuschreiben, damit sie dem aktuellen Zeitgeist entsprechen, würde man in diesem Verlag aber wohl glücklicherweise nicht kommen. In der vorliegenden Satire des 1964 in Rom geborenen Antonio Manzini wird diese Idee dafür umso überspitzter ausgeführt: Da brüsten sich zwei vermeintliche Optimierer der Verlagsbranche damit, wie sie im Sinne einer neuen Lesbarkeit berühmte literarische Werke neu auflegen. Aus Tolstois "Krieg und Frieden" etwa wird kurzerhand der Krieg gestrichen, denn: "Man darf dem Leser keine Angst machen!", außerdem erscheint ihnen, man könne auch den französischen Anfang streichen, es geht auch "ohne Waterloo, kürzer. Nur dreihundert Seiten."
Für Iwan Gontscharows Antihelden Oblomow, den vielleicht größten Faulpelz der Literaturgeschichte, haben sie eine noch radikalere Kur: "Er macht Industrie, er wird Unternehmer und macht Liebe!" Die beiden Herren sind Vertreter eines neuen Mega-Verlagskonzerns, wirken indes wie ein Immobilienhai und ein russischer Inkasso-Eintreiber. Letzterer ist gerade auch dabei, Thomas Manns "Zauberberg" umzuschreiben. Sein Plan: "Weg mit Krankheit, weg Schwindsucht und Tuberkulose, rein Feen und Berggnome. Naphta und Settembrini zwei Elfen, was sonst für Zauberberg, sage ich?"
So unwirklich wie dem Leser erscheinen diese Spukgestalten der Buchindustrie zunächst auch der Hauptfigur der Erzählung: Die heißt Giorgio Volpe und wird als einer der bedeutendsten Schriftsteller Italiens vorgestellt. Er hat zu Beginn der Geschichte gerade ein Romanmanuskript abgeschlossen, das er für sein bestes hält, eine italienische Familiengeschichte aus der Zeit des Faschismus - und nun sitzen die beiden Optimierer mit aufgeklapptem Notebook auf seinem Sofa und wollen sie zur Veröffentlichung in einen Nazi-Porno umschreiben. Volpe hält das für einen Witz, doch als er versucht, seine Lektorin und seinen Verleger, Weggefährten über viele Jahre, zu erreichen, muss er feststellen, dass diese für seinen Verlag nicht mehr arbeiten, ja dass es diesen Verlag schon gar nicht mehr gibt. Stattdessen gibt es ein Unternehmen namens Sigma, in dem bestens manikürte, aber literarisch ahnungslose Rezeptionistinnen schalten und walten und in dem die neue Ober-Chefin die Traditionsautoren der geschluckten Verlage in "Produktcodes" verwandeln will: Das heißt, sie müssen fortan Kochbücher oder Fußballer-Biographien anstelle von Romanen verfassen. Im Zuge der Umstrukturierung des gesamten Buchmarkts wird italienische Literatur fortan durch den Begriff "Kommunikation in heimischer Mundart" ersetzt.
Als Volpe dieses kulturelle Horrorszenario fliehen will und versucht, seinen Roman bei einem noch unabhängigen Kleinverlag unterzubringen, nimmt die Geschichte eine thrillerhafte Wendung, die an Science-Fiction nach Art des "Circle" von Dave Eggers erinnert und in ein unheimliches Ende mündet.
Vieles an der Satire ist so krass überzeichnet, dass man sich tröstend sagen mag: So schlimm ist es ja noch nicht! Aber ihr Grundstoff ist eben doch der Wirklichkeit entnommen, einer Wirklichkeit, die nicht nur in Italien zu einer Konzernisierung der Verlagsbranche und zum Verschwinden editorischer Standards und belletristischer Traditionspflege führt, ja zum Verschwinden der Sprachpflege überhaupt. Die Karikatur der banalisierten und sensationalisierten Inhalte, die Manzini hier zeichnet, hat zudem nicht nur auf dem Buchmarkt, sondern besonders im (Online-)Journalismus schon heute traurigen Realitätsgehalt. Die Genese eines "Spitzentitels" immerhin, wie sie diese Erzählung am Ende beschreibt, vermag zu belustigen.
Wer es vielleicht einmal selbst versuchen will mit einem Spitzentitel, der findet in diesem Buch ein passendes Rezept: "Abenteuer ja. Krankheiten nein. Scheidung nein. Sex viel. Mit Tieren ja. Mann und Frau ja. Frau mit Frau ja. Mann mit Mann nein. Sie verstehen?" Wenn man sich so anschaut, was für Bücher heute massenhaft in den Schaufenstern der verbliebenen Buchhandlungen dekoriert werden, kann einem das Lachen aber auch im Halse steckenbleiben.
JAN WIELE.
Antonio Manzini: "Spitzentitel".
Aus dem Italienischen von Antje Peter. Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2017. 80 S., geb., 15,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

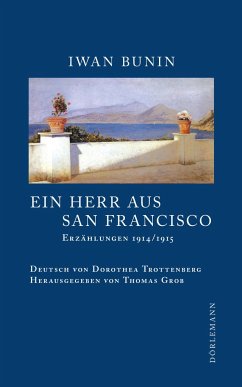





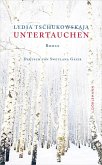

.jpg)