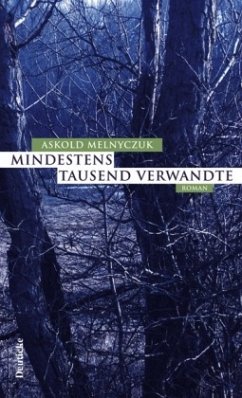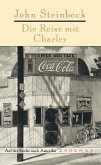In diesem großen Roman, der über mehrere Generationen und Kontinente hinweg die Geschichte einer ukrainischen Familie erzählt, treffen wir auf Zenon Zabobon und seine Frau Natalka, die an dem Tag heiraten, an dem der österreichische Thronfolger erschossen wird; auf ihre Tochter Slava, die auf der Flucht der Familie vor den Nazis ihren späteren Ehemann Arkady kennen lernt und schließlich in einer amerikanischen Vorstadt ihren Sohn Bohdan zur Welt bringt - und nicht zuletzt spielen auch "mindestens tausend Verwandte" eine tragende Rolle. Doch die Neue Welt ist kaum friedlicher als die Alte, und wieder stellen sich die ewig gleichen Fragen. Eine tief ernste Geschichte und gleichzeitig voll von Komik.

700 Jahre Einsamkeit: Askold Melnyczuks Roman „Mindestens tausend Verwandte”
In einem der traurigsten Momente seines ohnedies chaotischen und ziemlich freudlosen Lebens durchleidet Arkady Vorog, ukrainischer Emigrant im Nachkriegsamerika, eine Art Identitätskrise: „Manchmal wünschte er sich, er wäre als Jude, als Ire oder als Italiener geboren. Diese Völker genossen das Privileg, bemerkt zu werden. Bevor einen die Welt erblickte, das stand fest, benötigte sie das richtige Wort, um einen zu benennen”.
Arkady Vorog ist eine fiktive Figur, eine der wichtigsten in Askold Melnyczuks Roman „Mindestens tausend Verwandte” (das amerikanische Original heißt „What is told”). Arkady Vorog ist fiktiv, aber seine Krise ist es nicht: Der Name „Ukraine” gehörte noch vor nicht allzu langer Zeit, als Melnyczuk seinen ersten Roman schrieb, einem vollkommen „unsichtbaren Land” – einem jener Länder, die von Zeit zu Zeit verzweifelt versuchen, aus dem Schatten der Nichtexistenz herauszugelangen und dabei „Es gibt mich!” schreien, aber – um mit Melnyczuk zu sprechen – „was konnte man schon über ein Land sagen, das seine besten Tage vor 700 Jahren gesehen hatte?”.
Was die Vergangenheit vor 700 Jahren betrifft, flunkert Melnyczuk natürlich, vielmehr: er ironisiert. „Beste Tage” gab es in der Ukraine wohl auch damals nicht. Und doch kann es auch Vorteile haben, wenn ein Land unsichtbar, in einem fremden Schatten verborgen ist – vor allem für Erzähler von Geschichten. Das Land wird zu einem phantastischen Raum, in dem (aus dem?) man machen kann, was man will. Einem ausländischen Leser von der Ukraine erzählen, das ist zugleich hoffnungslos und unendlich verführerisch.
Askold Melnyczuk ist Amerikaner. Aber seine ukrainischen „roots” erlauben ihm den Versuch, von einem unsichtbaren (verborgenen) Land zu berichten. Fast unsichtbar und verborgen auch für ihn selbst, der „dieses Land” nur begrenzt auf die verzerrte häusliche Umgebung einer Emigrantenfamilie und eines ethnischen Gettos wahrnahm: ukrainische Schule am Samstag und sonntags Gottesdienst. Diese Ukraine war zu klein und eng, solche Ukrainen flieht man.
Wenn man aber Schriftsteller ist, dann kann man, wie der im Epigraph zitierte Nikos Kazantzakis sagt, auf ganz eigene Weise fliehen – indem man eine Legende schafft, die „wahrhaftiger als die Wahrheit” ist. Umso mehr, als es sich bei der Ukraine noch immer um eine Gegend handelt, wo die Legenden „wahrhaftiger scheinen, als die Berichte in den Zeitungen”.
„Wahrhaftiger als die Wahrheit” erzählend, verknüpft Melnyczuk zwei Stränge. Der erste ist ein mythologischer. Episoden einer Art „vorgeschichtlicher Prähistorie”, die Anfänge der erfundenen Stadt Rozdorizha irgendwo in der Mitte Europas und des tausendjährigen Geschlechts der Zabobons mit der Figur des Königs Toor im Zentrum, eines Riesen, der im Unterschied zu seinen Brüdern, den Bäumen, die Fähigkeit hat zu gehen und zu sprechen und der eine vollendete „Kampfmaschine” darstellt, ohne aufzuhören, ein vollendeter Baum zu sein. In diesen Episoden klingen auf wundersame Weise wirkliche Ereignisse aus dem ukrainischen Mittelalter an: die Schlachten gegen die Reitervölker aus der Steppe, alle möglichen „Tataren”, die Toor herablassend „Barbaren” nennt (und aus deren Schädeln er gerne seinen Wein schlürft); die gewaltsame Christianisierung und das Aufbegehren des Heidentums; die Kriegszüge übers Meer nach Byzanz und die Einführung der kyrillischen Schrift (benannt nach dem Heiligen Kyrill).
Der zweite Erzählstrang ist die Geschichte der Familie Zabobon (angeblich direkte Nachfahren von König Toor) im zwanzigsten Jahrhundert, dargestellt anhand der Schicksale der Brüder Zenon und Stefan, Söhne einesan Syphilis verstorbenen Priesters, sowie von Zenons Frau Natalka, ihrer Tochter Slava Lastivka, deren Mann, dem schon erwähnten Arkady Vorog, und von noch „mindestens tausend Verwandten”. Hier wird die mythologische zur realen Geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts, allerdings seltsam verfremdet.
Betont grotesk tauchen in Melnyczuks Chronik der Wiener Jugendstil, der Erste Weltkrieg und noch ein Krieg – der von den Ukrainern verlorene Krieg um die Unabhängigkeit 1918-20 auf, die vom kommunistischen Regime organisierte Hungersnot 1933 in der Ostukraine, die Okkupation durch die Nazis, Lager für Flüchtlinge, in der „zivilisierten Welt” displaced persons genannt, schließlich die Massenflucht dieser displaced persons mit Schiffen über den Ozean ins – wie es der Autor selbst sarkastisch nennt – Paradies auf Erden.
Dabei trägt jede der erwähnten Personen ihre eigene Metapher, oder vielmehr ihren eigenen Makel mit sich herum. Zenon Zabobon ist Aktivist der Nahtodgesellschaft, ein komischer Patriot, der die russische Okkupationsmacht mit Artikeln über altskythische Töpferei provoziert und, nachdem er im ersten Krieg dem Tod knapp entgangen ist, während des zweiten von den Nazis erschossen wird, weil er der jüdischen Nachbarsfamilie Unterschlupf gewährt hat; wobei er erklärt, sich „dem Grab näher als Deutschland” zu fühlen. Seine Frau Natalka hat die Fähigkeit, Radiowellen, „die zwischen den Weltstädten hin und her sausten”, zu empfangen; als sie am Ende ihrer Tage nach Amerika gelangt, fällt sie in einen seltsamen Schlaf, aus dem sie nur noch selten erwacht.
Stefan, sein Bruder, intellektueller Kommentator, Erotomane, „geheimer Berater Trotzkis”, etwas wie der „zynische Verstand” der Zabobons, schreibt sein ganzes Leben lang an zwei fundamentalen Abhandlungen – über die „Metaphysik der Ehe” und „Die Geschichte Rozdorizhas im Kontext der Weltgeschichte”. Er ist Autor einer großen Zahl treffend grausamer Aphorismen, etwa: „Der Punkt ist, dass wir alle Nebenfiguren sind, die von der Geschichte an die Peripherie der Ereignisse geschoben wurden. Unsere Sache ist doch lächerlich: Wer immer eines Tages unsere Geschichte erzählt, der muss die Jagd aus der Perspektive des Feldhasen beschreiben”.
Slava Lastivka, Zenons Tochter, Visionärin und Träumerin mit einem Faible für Rituale und das Musizieren, ist so eng mit dem Vater verbunden, dass sie noch lange nach seinem Tod mit ihm kommunizieren kann. Arkady Vorog, ihr Mann – Bauer aus dem ukrainischen Osten, ein Fremder in dieser Familie aus Galiziern, der nicht gelernt hat, die „mystische Natur” seiner eigenen Frau zu verstehen, obwohl auch er nicht ohne ukrainischen (ukrainisch-amerikanischen?) Traum ist – sieht sein Land von den Bolschewisten befreit und wird daher eines Tages zurückkehren und sich für immer im erstbesten Dorf bei Rozdorizha ansiedeln, um glücklich Gänse zu züchten.
Die genannten Personen schaffen, zusammen mit „mindestens tausend Verwandten”, die magisch-realistische Mischung dieses Romans voller Missverständnisse, bitterem Humor und unverfälschter, echter Verzweiflung: „Ukrainer zu sein, das war eine andere Bezeichnung für Einsamkeit”.
In der Geschichte seines zentraleuropäischen Macondo spielt Askold Melnyczuk ein gelungenes Spiel mit dem Leser und den Bedeutungen, zum Beispiel durch die Eigennamen. Einige übersetzt er, meist aber lässt er sie ohne Erläuterung stehen, ein Augenzwinkern ausschließlich für diejenigen, die Ukrainisch verstehen. Akribisch vermerkt er, dass „Zabobon” „Aberglauben” bedeutet und seine mythischen Flüsse Rozdorizhas „Himmel” und „Hölle” heißen. Zugleich aber erklärt er eine der zentralen Metaphern nicht: „Rozdorizha”, der „Scheideweg”. Auch erklärt er nicht, dass „Vorog” „Feind” heißt und der Name des russischen Okkupations-Gouverneurs, „Chuj”, eine vulgäre Bezeichnung für das männliche Geschlechtsorgan ist. Mehr noch – was den Namen Lastivka betrifft, legt er eine völlig falsche Spur (erstens gibt es so einen Namen in der Ukraine nicht, und zweitens bedeutet er keineswegs „Spatz”, sondern „Schwalbe”). Er ergötzt sich einfach an der Freiheit zu verwirren und der Welt Verborgenes zu enthüllen.
Ich erlaube mir zu bemerken, dass Melnyczuks Roman außerdem ein talentiertes Spiel mit den Konventionen des traditionellen Realismus darstellt, ihre konsequente Verspottung, eine Parodie auf realistische Familien-Sagas, auf das ukrainisch-erzieherische Ethos, das (nicht nur ukrainische) Emigranten-Epos. Der Romanstoff ist durchdrungen von unzähligen, ambivalenten Reminiszenzen (allein die „literarischen” Nachnamen der beiden Nazi-Offiziere – Walser und Stiller). Melnyczuks „Karpaten” liegen in ungewöhnlicher geographischer Nähe zu „Abu-Dhabi”, denn beide geographische Bezeichnungen sind bloß witzige Anspielungen.
Der Roman ist einfallsreich und zugleich einfach geschrieben, lustig und ernst, phantastisch und wahrhaftig, unbarmherzig und rührend. Wie gelingt ihm das nur – in dieser mit Texten übersättigten Welt durch einen Text zu berühren? Genau darin liegt wohl das Geheimnis Melnyczuks. Und ich habe nicht vor, es aufzudecken – so ist es interessanter.
Im zweiten, amerikanischen Teil des Romans taucht der Junge Bo auf, der in Amerika geborener Sohn Arkadys und Lastivkas, vielleicht der letzte Nachkomme der Zabobons, die in den „Korridor der Jahrtausende” geschleuderte Vollendung des Geschlechts, sweet child in time. Er ist dazu bestimmt, zu hören und aufzuschreiben „what is told”. Er träumt, dass nachts ein Baum-Mensch ans Fenster kommt, eben jener Riese mit starken Asthänden und Augen groß wie Monde: Der Kreis schließt sich, die Legende wird wahr, der Mythos Realität.
JURI ANDRUCHOWYTSCH
ASKOLD MELNYCZUK: Mindestens tausend Verwandte. Roman. Aus dem Amerikanischen von Martin Amanshauser. Deuticke Verlag, Wien 2006. 208 Seiten, 20,50 Euro.
„Bevor einen die Welt erblickt, benötigt sie das richtige Wort, um einen zu benennen”
„Wer unsere Geschichte erzählt, muss die Jagd aus der Perspektive des Feldhasen beschreiben”
„Die Karpaten liegen in ungewohnter geographischer Nähe zu Abu-Dhabi”
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Eine Dienstleistung der DIZ München GmbH

Lebensfülle: Askold Melnyczuk erzählt eine kurze Geschichte des Brühwürfels auf ukrainisch / Von Wolfgang Schneider
Ukrainische Literatur - das ist neuerdings ein Gütesiegel. Was der Türkei ein Orhan Pamuk, ist der Ukraine ein Juri Andruchowytsch: eine höchst westkompatible, charmant-kluge Vermittlerfigur. Dann gibt es junge Autoren wie Ljubko Deresch, die so frisch und radikal wirken, daß die auf wohltemperiertes Mittelmaß geschulten Abkömmlinge deutscher Schreibakademien dagegen alt aussehen. Und selbst mancher Bestseller hat einen ukrainischen Migrationshintergrund: Die Engländerin Marina Lewycka begeistert mit ihrer "Kurzen Geschichte des Traktors auf ukrainisch" inzwischen auch deutsche Leser; international erfolgreich war auch Oksana Sabuschkos Roman "Feldstudien über ukrainischen Sex". Fast scheint es, als hätte der Deuticke-Verlag einen Marketing-Fehler begangen, als er dem Roman von Askold Melnyczuk, der im Original "What is told" heißt, einen anderen Titel gab, dabei aber ein zugkräftiges Beiwort vergaß: "Mindestens tausend ukrainische Verwandte", das wäre es gewesen.
Wir schreiben das krisenträchtige Jahr 1914. Zenon Zabobon, Gymnasialprofessor für Kunstgeschichte in einem Kaff namens Rozdorizha, lehnt es ab, Kurator im Londoner Archäologiemuseum zu werden, weil er sich in eine Bäckereigehilfin verliebt hat und befürchtet, ohne seinen beherzten Zugriff würde das Mädchen vielleicht als Bardame enden. Zenons Bruder Stefan, ein routinierter Erotomane, der gerade ein bißchen in Wien herumstudiert und diverse literarische Plänen hegt, kann es nicht fassen. So beginnt eine ukrainische Familiengeschichte, die drei Generationen umspannt und in deren Zentrum zwei sehr verschiedene Brüder stehen.
"Wer immer eines Tages unsere Geschichte erzählt, der muß die Jagd aus der Perspektive der Feldhasen erzählen", so faßt Stefan Zabobon das historisch begründete Lebensgefühl der Ukrainer zusammen. Von den gierigen Großmächten wurde das Land schikaniert und vor allem als ergiebiges Beutestück betrachtet. Nach dem Ersten Weltkrieg verleibte die Sowjetunion es sich ein, die dann bei der Kollektivierung der Landwirtschaft sieben Millionen Ukrainer planmäßig verhungern ließ. Dann kamen die Deutschen auf der Suche nach Lebensraum - für die angestammte Bevölkerung wurde er zum Todesraum. Weil man sich aber zunächst die Befreiung vom Sowjetjoch versprochen hatte, wurde es den Ukrainern ab 1944 wieder mit besonderer Bedrückungskraft auferlegt. So ist die Ukraine zum Land geworden, aus dem bis heute die Menschen auswandern, wenn sich nur die Gelegenheit bietet.
Die Kapitel der Familienhistorie illustrieren und begleiten diese ukrainische Leidensgeschichte. Stefans Ausschweifungen in Paris werden im Wechsel mit gräßlichen Episoden der Hungerkatastrophe erzählt. Zenons Neigung zum politischem Idealismus - er versteckt eine jüdische Familie vor den Deutschen - bringt ihm einen frühen, gewaltsamen Tod. Seine Frau Natalka (die Bäckereigehilfin) kann sich mit der gemeinsamen Tochter Slava in ein Lager für "Displaced Persons" retten. Dort lernt Slava ihren künftigen Mann kennen, und bald besteigt die Restfamilie das Auswandererschiff nach Amerika.
In dieses kleine Buch geht viel hinein - nicht weniger als siebenhundert Jahre ukrainische Geschichte. Was vor den Schrecken des zwanzigsten Jahrhunderts geschah, wird mythologisch integriert, durch phantastische Szenen aus dem Leben von König Toor, einem mit den Bäumen verwandten Kampfriesen, der die Tataren abwehrt und die Christianisierung der Ukraine nicht aufhalten kann. Immer wieder spukt diese Sagengestalt in den Gedanken und Träumen der Zabobons herum, die sich in direkter, wenn auch sehr langer Linie von Toor herleiten.
Askold Melnyczuk wurde als Sohn ukrainischer Auswanderer 1954 in den Vereinigten Staaten geboren. Zum ersten Mal reiste er 1991 ins Land der Vorfahren. Mit diesem Roman eignet er sich den familienbiographischen Hintergrund in literarisch verfremdeter Form an. Manche eingeschaltete Belehrung klingt dabei ein wenig schulbuchmäßig, und einige Pointen wirken nach kurzer Lustigkeitsverpuffung ein bißchen schal: "Im Krieg waren es die Generäle, an die man sich hielt; in Friedenszeiten regierten die Genitalien." Trotzdem: Man bewundert dieses Buch für seine lakonische Lebensfülle. Zumindest bis zur Auswanderung sind die Kapitel über die Familie Zabobon komprimiert wie Brühwürfel, aus denen man lange Geschichten kochen könnte.
Bis zur Hälfte liest man das Buch mit dem Gefühl, es könnte sich vielleicht zum großen Wurf auswachsen. Die Amerika-Kapitel wirken dann jedoch verwässert und leiden an faden Dialogstrecken. Während die Figuren in der ersten Hälfte sehr plastisch geschildert werden, bleiben die hinzukommenden "tausend Verwandten" im Exil blaß und unergiebig. Zwar gibt es interessante Ausführungen über die Schrecken der amerikanischen Arbeitswelt, zwar erfährt man einiges über die Art und Weise, wie Ukrainer fern der Heimat derselben gedenken. Sie treffen sich einmal im Jahr in den "Karpaten" - gemeint ist ein "ukrainisches Resort in den Catskills" -, frönen dort ausgiebig dem "Emigrantentratsch" und der Folklore. Bohdan, Sohn von Slava und Arkady, Vertreter der jüngsten Generation und in manchen Zügen wohl das Alter ego des Autors, geht brav zu den ukrainischen Pfadfindern von New Jersey.
Nur leider kommt das alles nicht mehr in Zusammenhang mit einer schlüssigen Romanhandlung daher. Jahre vergehen, und wir erleben Slava Zabobon noch als Avon-Beraterin und ihren Schwager, den einstigen Hardcore-Don-Juan als Woolworth-Rentner beim Entenfüttern. Allerhand phantasmagorische Szenen - Sterbe- und Fieberdelirien - springen vor und zurück in der Familiengeschichte. Die letzten vierzig Seiten dauern schier endlos.
Ganz am Ende hat König Toor noch einen Auftritt. Obwohl das Leben in Amerika kein Zuckerschlecken ist, setzt er in New Jersey langsam Borke an und verwandelt sich zurück in einen Baum. Wer jetzt keine Wurzeln schlägt, hat keine mehr. Der Leser aber ist nicht gerührt, sondern froh, daß es vorbei ist. Schade um ein Buch, das so vielversprechend begonnen hat.
Askold Melnyczuk: "Mindestens tausend Verwandte". Roman. Aus dem Englischen übersetzt von Martin Amanshauser. Deuticke Verlag, Wien 2006. 208 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Juri Andruchowytsch hat sich nicht nur prächtig amüsiert mit dem Roman des Kollegen Askold Melnyczuk, sondern zeigt sich auch berührt von der mythologischen Geschichte der Zobobons und ihrer nach Amerika auswandernden Abkömmlinge. Die jüngste Vergangenheit erscheint Andruchowytsch dabei als völlig verfremdet und "grotesk" überzeichnet, was den Roman in die Gefilde des magischen Realismus rückt. Melnyczuks Roman sei auch eine Parodie der traditionellen Familiensaga und des klassischen Emigranten-Schicksals, konstatiert der Rezensent noch, der immer wieder Originalität und Witz des Romans preist, ohne dabei aber zu verraten, worin diese bestehen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Daß das Leben ein 'Idiotenspiel' ist, wie es einmal heisst, ahnte man schon vorher, aber nichts geht darüber, diese alte Erkenntnis unterhaltsam aufs Neue präsentiert zu bekommen...Askold Melnyczuk versteht es wunderbar, mit viel Humor und feinem Gespür für absurden Witz noch von düstersten Kapiteln der Historie zu erzählen." Knut Cordsen, BR 2 Kulturwelt, 06.11.2006 "Der Roman ist einfallsreich und zugleich einfach geschrieben, lustig und ernst, phantastisch und wahrhaftig, unbarmherzig und rührend." Juri Andruchowytsch, Süddeutsche Zeitung, 22.11.2006 "Wer sich auf dieses sehr ungewöhnliche Buch und seinen ganz eigenen Ton einlässt, unternimmt eine faszinierende Reise quer durch die Welt, die Alte und die Neue, durch Kontinente und Jahrhunderte." Radek Knapp, Der Standard, 21.10.2006