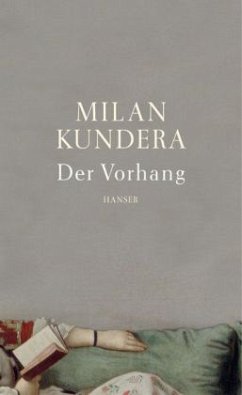Milan Kundera entwirft ein Bild Europas und der Welt durch die großen Romane der Weltliteratur. Die Liebesgeschichte der Anna Karenina und die habsburgerische Bürokratie bei Kafka und Stifter, das Paris von Flaubert und das von Proust - ein Buch voller Anekdoten und Analysen, Szenen und Bilder, in denen die Romane der Weltliteratur lebendiger als die Wirklichkeit selbst werden. Dargestellt mit der kritischen Ironie eines bedeutenden Erzählers.

Auch große Kulturnationen können provinziell sein: Milan Kunderas neue Essays sind eine Hommage an den "denkenden Roman" / Von Andreas Kilb
Ein Romanautor, der eine Theorie des Romans schreibt, hat etwas von einem Mann, der einen Witz erklärt. Ist nicht alles, was er über Sinn und Form von Romanen zu sagen hat, schon in seinen Büchern ausgedrückt? Und wenn es nicht darin ausgedrückt ist, was sagt das über die Bücher? Denn unvermeidlicherweise wird der theoretisierende Romancier auch auf sein eigenes Werk zu sprechen kommen, schon weil er es besser kennt als alle anderen literarischen Werke. Und selbst wenn er nur über die Romane anderer Autoren spricht, wird er dadurch immer auch seine eigenen Bücher kommentieren, eben weil das, was er schreibt, nicht denkbar ist ohne all das, was er gelesen hat.
Wie man es auch dreht und wendet - das Theoretisieren ist bei einem Schriftsteller stets ein Akt der Entzauberung und Selbstentblößung, es zerreißt den Vorhang, der sein Schreiben von der Welt der Thesen und Interpretationen trennt, es trägt seine Kunst auf den Marktplatz der Meinungen. Thomas Mann hat diese Klippe vor sechzig Jahren elegant umschifft, indem er seine Studie über "Die Entstehung des Doktor Faustus" als "Roman eines Romans" veröffentlichte und ihr damit von vornherein jeden germanistischen Beigeschmack nahm. Aber nicht jeder Autor besitzt die Selbstironie und die olympisch-heitere Eitelkeit eines Thomas Mann.
Im Fall von Milan Kundera und seinem neuen Essaybuch "Der Vorhang" kommt hinzu, daß dies bereits das dritte Bändchen ist - nach der "Kunst des Romans" von 1987 und den "Verratenen Vermächtnissen" von 1994 -, welches der in Frankreich lebende tschechische Schriftsteller der Romantheorie widmet. Oder soll man sagen: dem Reden über Flaubert, Broch, Kafka, Lyrik, Musik, Mitteleuropa, den Surrealismus, die Literatur der Tropen, den Kommunismus, die Filme Fellinis und die Fährnisse des modernen Flugverkehrs? Denn natürlich sind Kunderas essayistische Exkursionen keine Theorie im wissenschaftlichen Sinn. Es sind Bekenntnisse, Notizen, Gedankenspaziergänge eines Lesers, der vor dem gewöhnlichen Leser oder Denker den Vorsprung der praktischen Erfahrung hat. Kundera schreibt, worüber er spricht. Das gibt seinen Betrachtungen eine selbstverständliche Autorität, selbst dann, wenn er über Dinge redet, die seinem Gesichtskreis fernliegen.
So bemerkt er etwa über Federico Fellinis "Amarcord" von 1973, dies sei der letzte Film des italienischen Regisseurs gewesen, "über dessen lyrische Schönheit sich alle einig waren", während sich vom späten Fellini alle abgewendet hätten - "die Kulturszene, die Presse, das Publikum (und sogar die Produzenten)". Warum? Weil seine Poesie "antilyrisch", sein "Modernismus antimodern" geworden seien und seine letzten Filme "ein unerbittliches Porträt der Welt, in der wir leben", zeichneten.
Abgesehen davon, daß die These von Fellinis Alterseinsamkeit nicht stimmt (bis zum Schluß wurde der Regisseur von Produzenten hofiert und von Klatschreportern gejagt), klingt auch die Begründung reichlich merkwürdig. Sind "Casanova" und "Die Stadt der Frauen" unerbittliche Porträts der heutigen Welt, "Intervista" und "Die Stimme des Mondes" antilyrische Filme? Wahr ist, daß Milan Kundera vor vierzig Jahren einige Zeit an der Filmfakultät der Prager Universität unterrichtet hat; wahr ist aber auch, daß er im Kino (wie die meisten anderen Zuschauer) offenbar vor allem das wahrnimmt, was er wahrnehmen will. Und das gilt auch für seinen Blick auf die Literatur.
Der Vorhang" beginnt mit einer Anekdote: Kunderas Vater, Rektor der Musikhochschule in Brünn, hört eines Tages ein paar Akkorde von Beethoven im Radio. Es ist die Neunte Symphonie, aber er erkennt sie nicht. Jedoch erklärt er seinen Freunden voller Überzeugung, diese Musik müsse vom späten Beethoven sein, da sie eine ganz bestimmte typische Harmonienfolge aufweise. Die Anekdote, erklärt Kundera, handle vom "Bewußtsein für historische Kontinuität": von der Fähigkeit, den großen Werken der Kunst ihren Platz in der geschichtlichen Zeit zuzuweisen.
Aber mindestens ebensosehr handelt diese Anekdote von der Sehnsucht des Schriftstellers Milan Kundera, für seine eigenen Bücher und die Bücher der Autoren, die er liebt, einen festen Platz in der Geschichte der Menschheit zu finden. Sie handelt vom Wunsch, Teil und zugleich Hüter eines Kanons zu sein, dem keine Macht der Zeiten mehr etwas anhaben kann. Deshalb ist es kein Zufall, daß in den ersten Sätzen des Buchs nicht von Literatur die Rede ist, sondern von Musik. Denn der musikalische Kanon steht unverrückbar fest; kein wiederentdeckter Kleinmeister wird den Ruhm Beethovens je verdunkeln. Dieselbe Unantastbarkeit fordert Kundera wider besseres Wissen für die Meister des europäischen Romans. Zweihundert Seiten lang kämpft er mit allen rhetorischen Mitteln gegen die Windmühlenflügel der Banausie und des Vergessens, obwohl er weiß, daß er diesen Kampf verlieren muß. Darin liegt die tragische Größe und zugleich die donquichotteske Vergeblichkeit seines Buches.
Daß für Milan Kundera (wie für die meisten Theroretiker der Literatur) die Geschichte des Romans mit Rabelais und Cervantes beginnt und mit Fielding, Sterne, Balzac, Flaubert, Kafka, Musil, Hasek, Broch und Gombrowicz weitergeht, wissen wir spätestens seit der "Kunst des Romans", und die "Verratenen Vermächtnisse" haben es bestätigt. Warum wiederholt er es hier noch einmal? Die Antwort darauf findet man an jenen Stellen des Buches, an denen Kundera den Schutzraum der Klassikerbibliothek verläßt und sich unter das debattierende Leservolk begibt. So erzählt er von der Umfrage einer Pariser Tageszeitung, bei der die hundert wichtigsten französischen Bücher ermittelt werden. Victor Hugos "Die Elenden" gewinnt den Wettstreit, "Gargantua und Pantagruel" kommt auf Platz vierzehn, nach de Gaulles Kriegsmemoiren und vor "Rot und Schwarz" und "Madame Bovary". Da platzt unserem Autor der Kragen. "Rabelais nach de Gaulle!" Und - "ist es möglich?" - Balzac nur auf Platz vierunddreißig! Beckett und Ionesco erst gar nicht auf der Liste!
Für Milan Kundera beweist diese Umfrage zweierlei: daß die Franzosen einfach nicht begreifen, welche Bedeutung Ionescos Stücke für den Prager Frühling hatten; und daß große Kulturnationen auf ihre Art genauso provinziell sein können wie kleine. Dem Leser aber verrät dieser Zornesausbruch vor allem eines: daß Milan Kundera, obwohl er seit elf Jahren nur noch in der Sprache seines Gastlands schreibt, nicht aufgehört hat, ein tschechischer Schriftsteller im Exil zu sein. Seine Prosa kleidet sich französisch, aber da, wo es ernst wird, redet sie nicht von Proust oder Balzac, sondern von dem, was ihren Autor wirklich umtreibt: der Haß auf die "slawischen Ausdünstungen" Rußlands, die Liebe zur Dichtung und Musik Zentraleuropas - und die Leidenschaft für jene "denkenden Romane", die in der Zeit zwischen den Weltkriegen in Prag, Wien und Warschau entstanden sind.
Es gibt eine kleine, beiläufige Passage in diesem Buch, die alle seine Vorzüge auf den Punkt bringt. Sie handelt von einem tschechischen Roman, den in Deutschland vermutlich fast niemand kennt: Jaromir Johns "Knatternde Ungeheuer" von 1932. Der Held des Buches ist ein Herr Engelbrecht, dessen wohlverdienter Ruhestand vom Geknatter der neuen Automobile so nachhaltig gestört wird, daß er sich am Ende dazu entschließt, die restlichen Nächte seines Lebens in Zügen zu verbringen. Daß "Knatternde Ungeheuer" nicht zur Weltliteratur zählt, ist Kundera ausnahmsweise völlig gleichgültig. Der Autor John ist für ihn bedeutend, weil er in seiner Polemik gegen das Maschinenzeitalter eine tiefgreifende Umwälzung in der Geschichte der menschlichen Existenz festhält: "Er schrieb keine auf den Vorhang der Vorinterpretation gestickten Wahrheiten; er hatte den cervantesken Mut, den Vorhang zu zerreißen."
Denselben Mut hat auch Kundera, wenn er durch Flauberts Romane "die zarte Fee der Dummheit" schreiten sieht oder das von Bürokraten überschwemmte Dorf in Kafkas "Schloß" als düstere Antwort auf die ländliche Idylle von Stifters "Nachsommer" liest. Aber sobald er vom Detail aufs Allgemeine kommt, verwandelt sich dieser Mut in Rechthaberei. Dann tönt es hohl hinter dem "Vorhang" hervor: "Der Mann ohne Eigenschaften ist eine unvergleichliche Enzyklopädie der Existenz seines ganzen Jahrhunderts." - "Dostojewskij erzählt uns das Drama der Menschen, nicht das Drama der Jugend." - "Die Literatur ist dabei, sich durch unsinnige Vermehrung selbst umzubringen." - "Das Europa der Neuzeit ist nicht mehr da." Auch ein überreich mit Ironie begabter Autor wie Kundera ist, wie man sieht, gegen jene Gemeinplätze nicht immun, die er in seinen Romanen so gern auf die Schippe nimmt. Zum Glück hält die gehoben-apokalyptische Stimmung, in der er ganze Kulturepochen in einem Nebensatz verabschiedet, bei Kundera nie lange vor. Nach jedem Phrasengewitter blüht rasch wieder die zarte Blume des Aperçus.
Das letzte der vierundsiebzig kurzen Kapitel des "Vorhangs" heißt "Ewigkeit". In ihm ist abermals von Musik die Rede - diesmal von der Erfindung des Kontrapunkts im zwölften Jahrhundert, die zur Geburtsstunde der abendländischen Musik wurde. Damals hörte die Kunst auf zu imitieren, die Komponisten fingen an, ihre Werke zu zeichnen, der Künstler wurde zum Individuum. Dies alles, fürchtet Kundera, könnte einmal enden. Von Angst geplagt, stellt er sich den Tag vor, "an dem die Kunst aufhört, das Niegesagte zu suchen, und sich brav wieder in den Dienst des Gemeinschaftslebens stellt, der von ihr verlangen wird, daß sie die Wiederholung verschönt und dem Individuum hilft, in Frieden und Freude in der Uniformität des Seins aufzugehen". Aber hat Kundera diesen Tag, den Tag des sozialistischen Realismus, nicht viele Jahre lang in der einstigen Tschechoslowakei miterlebt? Und hat er nicht über ebendiese Erfahrung viele unvergeßliche Bücher geschrieben? Vielleicht sollte Milan Kundera mit sechsundsiebzig Jahren anfangen, als Hausmittel gegen die Angst seine eigenen Romane wieder zu lesen.
Milan Kundera: "Der Vorhang". Aus dem Französischen übersetzt von Uli Aumüller. Hanser Verlag, München 2005., 224 S., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Milan Kundera über die Kunst des Romans
Wie soll man beweisen, dass das Bartbecken, das Don Quijote in der Schenke auf dem Kopf trägt und das der Barbier zurückhaben will, kein Ritterhelm ist? Die ganze Seinsfrage der Gattung Roman offenbart sich in dieser Verlegenheit des Barbiers, denn die Kumpanen Don Quijotes haben in geheimer Abstimmung beschlossen: Das Becken ist ein Helm. Seit zwanzig Jahren erforscht Milan Kundera diese Frage. Er selbst schreibt keine Romane mehr. Mit „Die Kunst des Romans” (1986), „Verratene Vermächtnisse” (1993) und ganz besonders nun mit diesem neuen Buch, „Der Vorhang”, schuf er aber ein eigenes Genre, irgendwo zwischen Romanseitenzerpflücken, Blütenverlesen, Buchrändervollschreiben und unterhaltsamem Spazierenführen der Gedanken quer durch die europäische Literatur. Der Weg endet diesmal an einem Vorhang: jenem aus Legenden gewebten Vorhang, der mit steifem Faltenwurf Jahrhunderte lang nicht nur im Theater die heroischen, tragischen Menschengeschichten rahmte und der zur Zeit der Renaissance ganz undramatisch plötzlich riss.
Das Zahnweh Don Quijotes
Dass Distanzierung, Ironie und die komische Selbstrelativierung allen menschlichen Handelns bei Rabelais, Cervantes, Grimmelshausen in den Augen Kunderas zu den größten Erfindungen Europas gehören, ist aus seinen früheren Büchern bekannt. Hier achtet er vor allem auf jenen Moment, wo bei Cervantes der Vorhang sich zweiteilt und den armen Alonso Quijano hervortreten lässt, der sich zur Heldengeschichte eines fahrenden Ritters aufmacht, statt dessen sich aber in die Welt der Prosa, des prosaisch Konkreten, Alltäglichen, körperlich Banalen verliert. Don Quijote und Sancho haben beispielsweise immerfort Zahnweh - was kümmerten hingegen Homer die im Nahkampf ausgeschlagenen Zähne von Achill und Ajax? In Sternes „Tristram Shandy” versucht anderthalb Jahrhunderte nach den Fuchteleien Don Quijotes dann Vater Shandy mehrere Kapitel lang, mit der linken Hand das Taschentuch aus seiner rechten Tasche zu ziehen und gleichzeitig mit der rechten die Perücke abzunehmen. Bei Dostojewskij schlagen wieder ein Jahrhundert später die Uhren unablässig die Stunde und erinnern an die Eitelkeit allen Tuns. Und doch haben diese Belanglosigkeiten ihre eigene Schönheit.
In zahllosen Einzelbeobachtungen und Anekdoten stellt Kundera ihnen über kurze Kapitel nach und skizziert jene Welterfahrung, die allein der Roman zur Darstellung bringen kann, sei es durch szenische Ereignisverdichtung wie bei Scott, Balzac, Dostojewskij oder durch enttheatralisierende Ereignisauflösung ins Banale wie bei Flaubert. Die epische Kunst ist auf Handlung gegründet. Im Unterschied zum Heldeneposdichter weiß der Romanautor aber um die Fragwürdigkeit aller Handlung und lässt dieses Wissen bald als Farce, bald in der verfeinerten Form des Humors komisch durch seine Welt schimmern. Kunderas Idealgenealogie läuft entsprechend nicht vom emphatischen Victor Hugo zu André Gide oder Solschenizyn, sondern von Flaubert zu Kafka, Musil, Broch, Gombrowicz - und damit in jenes Zentraleuropa, das er in diesem Buch mit neuer Huldigung feiert.
Wiederholt hat Milan Kundera schon seine Untröstlichkeit darüber bekundet, dass Europa seine Literatur - anders als etwa seine Musik - nicht als historische Einheit zu denken vermochte. Die Romanliteratur ist national katalogisiert. Für Kundera ist das ein „nicht wieder gut zu machendes intellektuelles Scheitern”. Selten war seine Gegenskizze der großen europäischen Literaturräume aber so gelungen wie in diesem Buch. Der westeuropäischen, vorab französischen Entwicklung vom Klassizismus und Rationalismus zu den großen realistischen Romanen des neunzehnten Jahrhunderts stehe, so schreibt er, in Zentraleuropa beinahe symmetrisch der Weg vom ekstatischen Barock zu einem moralisierenden, episch wenig ergiebigen Biedermeier, gleichzeitig aber zur grandiosen Dichtung und Musik der Romantik gegenüber. Entsprechend seitenverkehrt sieht Kundera den Sprung in die Moderne. Führte sie im Westen antirealistisch in die lyrische Rebellion Baudelaires und Rimbauds, die auch der Wagnerschen Ekstase nicht abgeneigt war, so zielte sie zwischen Ostsee und Donau gegen die Tradition des Romantisch-Sentimentalen auf ironische Brechung, Luzidität, Distanz.
Das Schematische solcher Gegenüberstellung verschwindet, sobald Kundera sie mit Erfahrung durchtränkt. Beim Suchen etwa in den Salonunterhaltungen von Stendhals „Lucien Leuwen” nach Stichworten, die der zentraleuropäischen Erfindung des „Kitsch” am besten entsprächen, wird er schnell und überzeugend fündig: Ein vergleichbares Maß ästhetischer Missbilligung wie gegen die „Tyrannei der Operntenöre” im Kitsch erreicht im Westen nur das Wort „Vulgarität”. Doch stehen die beiden Erfahrungen einander fremd gegenüber. Als, so erzählt Kundera, in den ersten Wochen nach seiner Emigration ein Pariser Intellektuellenfreund ihm pathetisch mit den Worten „Verfolgung”, „Gulag”, „Polizeiterror” kam, habe er mit einer Geschichte von der Gängelung der Polizei in Prag durch kuriosen Wohnungs- und Frauentausch geantwortet. Sein Gesprächspartner fand das gar nicht komisch. Zwei nicht nur ästhetische Haltungen prallten aufeinander - „der gegen Kitsch allergische Mann traf auf den Mann, der gegen Vulgarität allergisch war”.
Dem Plädoyer für den Roman als Kunst- und Lebensform braucht man nicht in alle Konsequenzen zu folgen. Sollen wir die Genese eines Romanciers tatsächlich als „antilyrische Konversion” verstehen, in der ein Autorensubjekt aus der Befangenheit des auf sich selbst fixierten Dichter-Ichs erwacht? Wäre dem so, gäben wir auch dafür nicht viel, was hinter dem zerrissenen Vorhang episch zum Vorschein kommt. Die Welterfahrung der Dichtung ist oft weiter und offener als die des noch so ausufernden Romans. Das Buch „Hundert Jahre Einsamkeit” von Gabriel García Márquez sei eine schneidende Entgegnung auf die Romanverachtung der Surrealisten, schreibt Kundera. Mag sein.
Die Moral des Wesentlichen
Wo aber ist die Einsamkeit, die Kundera im Alterswerk Picassos, Fellinis, Beethovens - und gerade in keinem Roman - treffend evoziert, weltgesättigter aufgetreten als bei Rilke oder René Char? Die „Moral des Wesentlichen”, für die Milan Kundera in diesem Buch plädiert und die er mit seinem Verzicht auf nachgereichte Romanpublikationen seit Jahren auch vorbildlich praktiziert, ist bei den Dichtern höchstes Gebot. Als Lese- und Lebenssplitter bleibt jenes Wesentliche in diesem wunderlichen Buch, das im französischen Original noch den Untertitel „Essay in sieben Teilen” trug, wie in einem Vorhangsaum tausendfach hängen. Uli Aumüller hat es, mit Ausnahme eines logischen Fehlers auf Seite 127, in seiner Übersetzung sorgfältig eingesammelt und elegant übersetzt. JOSEPH HANIMANN
MILAN KUNDERA: Der Vorhang. Aus dem Französischen von Uli Aumüller. Carl Hanser Verlag, München, 2005. 224 Seiten, 19,90 Euro.
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Eine Dienstleistung der DIZ München GmbH
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Andreas Isenschmid bezeichnet es als ziemlich "riskant", dass Milan Kundera in seinem jüngsten Buch nun zum dritten Mal die "Theorie des Romans" zum Gegenstand eines Textes macht, doch beeilt sich der Rezensent zu bekräftigen, dass "Der Vorhang" äußerst frisch und mit viel "Leidenschaft" die Ansichten des Autors auf den Punkt bringt. Das Buch besteht aus Fragmenten, kurzen Texten von kaum je mehr als einer Seite, denen die Kapitelüberschriften zwar einen Anstrich von Systematik geben sollen, die aber "zum Glück" eher dem "Geist der Causerie" verpflichtet sind, so Isenschmid eingenommen. Eine Fülle von "überraschenden Beobachtungen" und "kleine schlagende Deutungen" hat der begeisterte Rezensent gefunden, der die "schönsten Effekte" in den originellen "Zusammenstellungen" gefunden hat, beispielsweise, wenn Kundera Hugos tragische Helden mit "Flauberts Entdeckung der Dummheit" konfrontiert. Dabei verdanke das Buch seinen "Charme" nicht zuletzt dem "Persönlichen", das Kundera einbringe, etwas wenn er die Biografie seiner Eltern anspricht, so der Rezensent anerkennend. In diesem Buch schreibt der Autor so "lustvoll und einfallsreich", dass einem die Tatsache, dass in seiner Romangeschichte die Gegenwart überhaupt nicht vorkommt und überdies Schriftsteller wie Thomas Mann, Nabokov oder Proust keine Erwähnung finden, "fast egal" ist, meint Isenschmid.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH