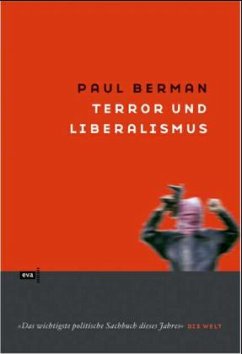Produktdetails
- Verlag: Europäische Verlagsanstalt
- Seitenzahl: 265
- Deutsch
- Abmessung: 210mm
- Gewicht: 341g
- ISBN-13: 9783434505792
- ISBN-10: 3434505792
- Artikelnr.: 12503121

Jede große Wende in der amerikanischen Außenpolitik hat ihren Geschichtsphilosophen. Und noch jeder dieser Geschichstphilosophen ist von den Europäern verächtlich abgetan worden. 1989 verkündete Francis Fukuyama das Ende der Geschichte. Samuel Huntington und Robert Kagan legten in den folgenden Jahren weitere weltpolitische Entwürfe vor. Jetzt jedoch, so meint eine ganze Reihe Kommentatoren, hat Amerika endlich auch den "Philosophen des 11. September" gefunden. Er heißt Lee Harris und ist, wenn man dem Klappentext glauben darf, eine Art Autodidakt, der sich schon an Kriminalromanen versucht und eine "Karriere als Glaser" hinter sich hat.
Sein Bestseller trägt den Titel "Die Zivilisation und ihre Feinde" und erwuchs aus einem Aufsatz in der neokonservativen Zeitschrift "Policy Review", in der auch Robert Kagan seine These von den martialischen Amerikanern und den verweichlichten Europäern zuerst vorgestellt hatte. Der Untertitel lautet "Die nächste Stufe der Geschichte". Diese werde, so Harris, ein Kampf auf Leben und Tod zwischen der liberalen Zivilisation Amerikas und den Terroristen sein, die den "American Way of Life" zerstören wollten. Dabei hätten die Liberalen von vornherein ein Handicap. Denn es seien gerade die Jahrhunderte währenden Zivilisationsleistungen, die im Westen zu einer fatalen Amnesie geführt haben. Liberale, so Harris, hätten vergessen, daß es in der Politik Feindschaft auf Leben und Tod geben könne.
Statt dessen klammern sie sich an Vorstellungen von politischer Gegnerschaft, nach denen sich der Feind schon auf die eine oder andere Weise zur Räson bringen läßt. So glauben sie zum Beispiel an Benjamin Constants Lehre, daß der Handel aus Kriegsgegnern wirtschaftliche Rivalen mache. Oder sie hielten sich an Fukuyama und den großen Hegelianer Alexandre Kojève, für die der Kampf um Anerkennung prinzipiell mit dem richtigen politischen System beendet werden könne.
Für Harris ist dies alles Wunschdenken, dessen Naivität allenfalls von liberalen Kosmopoliten wie Martha Nussbaum übertroffen werde. Denn ob es Todfeinde gibt oder nicht, entscheiden nicht die Liberalen: Man kann sich seine Feinde nicht aussuchen, die Feinde suchen einen aus. Doch eben weil der Westen diese Grundtatsache der Politik nicht mehr wahrhaben wolle, zerfalle die Welt heute in Menschen, die die Kategorie des Feindes aus ihrer moralischen Vorstellungswelt verbannt haben, und eine Minderheit von Fanatikern, die ihr ganzes Leben nach dem Feind ausrichten. Ginge es nach Harris, stünde dem Westen gewaltige Gedächtnisarbeit bevor.
Wie sein linker Antipode Paul Berman in seinem Buch über "Terror und Liberalismus" behauptet auch Harris, daß Bin Ladin und seine Gefolgsleute einer Art totalitärer "Phantasieideologie" anhingen und deshalb ideologische Abkömmlinge von Hitler und Mussolini seien. Dem Feind geht es also nicht um rational nachvollziehbare politische Ziele, sondern um apokalyptische Mythen zur Mobilisierung von Menschenmassen. Die Ideologie von Al Quaida, so Harris, habe denn auch weniger mit dem Islam zu tun als mit der Tatsache, daß die Araber aufgrund ihres Ölreichtums in einer feudalen Phantasiewelt lebten.
Wer vom Feind spricht, darf von Carl Schmitt nicht schweigen. Genau dies aber tut Harris, was um so verwunderlicher ist, als einige seiner Thesen dem Werk des deutschen Staatsrechtlers entnommen scheinen. So ist auch bei Harris souverän, wer über den Ausnahmezustand entscheidet, und auch die alte Hobbes-Frage steht im Zentrum: "quis iudicabit". Antwort: die Vereinigten Staaten von Amerika. Dies sollte jedoch nicht zu dem Schluß verleiten, den Alan Wolfe unlängst im "Chronicle of Higher Education" gezogen hat: daß nämlich nicht Leo Strauss, sondern Carl Schmitt die Inspirationsquelle für Amerikas Neokonservative sei.
Denn etwas überraschend optiert Harris am Ende für einen anderen deutschen Denker: Der Westen müsse einen Patriotismus wiederbeleben, wie er im Römischen Reich geherrscht habe, und Patriotismus lasse sich noch immer am besten mit dem Begriff der Sittlichkeit fassen - einem Hegelschen Schlüsselbegriff, den Harris kurzerhand mit "Teamgeist" übersetzt. Ein kosmopolitischer "Teamgeist", im Gegensatz zum angeblich illusionären "liberalen Kosmopolitismus", charakterisiere vor allem die Vereinigten Staaten, wo jeder, der sich an die Spielregeln hält, eine Heimat finden könne. Es gilt also, den Feinden der offenen Gesellschaft mit patriotischem Teamgeist entgegenzutreten.
Diejenigen aber, die noch am ehesten aus dem Team ausscheren, sind für Harris, wie könnte es anders sein, die Intellektuellen. Besonders postmoderne Denker tendierten dazu, das Team der Forderung nach unbegrenzter Freiheit unterzuordnen, und würden dadurch selber zur Gefahr, möglicherweise gar zu "Feinden der Zivilisation". Wer hätte gedacht, daß Hegels Philosophie und Weisheiten aus der Welt amerikanischer Selbsthilfebücher eine so illiberale Verbindung eingehen könnten, nach dem Motto: "Du bist nichts, dein Team ist alles."
Wenn auch die Intellektuellen sich wieder ins Team eingeordnet hätten, so Harris, könnte Amerika seine Rolle als weltweit einzig legitimer "Neo-Souverän" spielen. Denn die Vereinigten Staaten, so Harris, seien objektiv die einzige Macht, die die Terroristen mit ihrem "Willen zur Schrecklichkeit" - noch ein deutscher Begriff, den Harris mit "ruthlessness" übersetzt - in Schach halten könne. Carl Schmitt hätte diesen offensiv vorgetragenen, von keinem völkerrechtlichen Universalismus verschleierten Hegemonialanspruch sicher bewundert.
JAN-WERNER MÜLLER
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Paul Berman tritt an wie ein konservativer Berater der Bush-Regierung, und doch ist er eigentlich ein Liberaler, wundert sich Herfried Münkler. Berman geht es um die Verteidigung der Demokratie gegen die Bedrohung durch den Islamismus, und er greift auf ein beliebtes Mittel zurück, das Münkler als sehr ambivalent empfindet: das der historischen Analogie. Pausenlos vergleiche Berman die heutige Lage mit der Situation in den dreißiger Jahren, als die französischen Sozialisten aufgrund ihrer pazifistischen Grundüberzeugung ein Vorgehen gegen das nationalsozialistische Deutschland verweigerten. Ein solches Denken in historischen Analogien ist attraktiv, aber gefährlich, findet Münkler. Verführerisch sei es deshalb, weil es Orientierungshilfen in einer unüberschaubaren Situation biete. Riskant wiederum ist das Analogieverfahren, weil es falsche Schlüsse zulasse. Für Münkler ist die Analogisierung zwischen dem Kriegsende in Deutschland und der Befreiung des Irak ein solcher falscher Analogieschluss. Interessant ist Bermans Buch solange, räumt Münkler ein, wie sich der Autor als historischer Spurenleser verstehe. Ansonsten überwiege bei Berman ein Wunschdenken, das die Außenpolitik seines Landes frei von Realpolitik sieht.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH