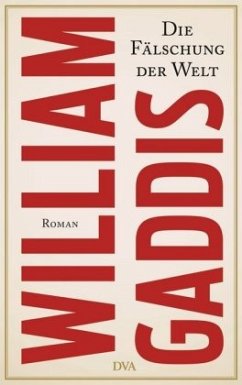Das satirische Porträt von nichts weniger als der gesamten modernen Welt - einer der wichtigsten Romane des 20. Jahrhunderts!
Wyatt Gwyon wächst als Priestersohn unter der rigiden Obhut seiner Tante in der Provinz Neuenglands auf und entwickelt ein zeichnerisches Talent. Schließlich landet er Ende der vierziger Jahre im New Yorker Greenwich Village, wo er aus Not zu einem genialen Kunstfälscher wird. Doch er kopiert nicht etwa die alten Meister, sondern erfindet neue »Originale« und arbeitet damit korrupten Händlern und Hehlern in die Hände. Um ihn herum gibt es ein ganzes Heer an Künstlern, Kunstexperten, Schriftstellern, Geistlichen, Forschern und Politikern, die sich alle in einem Netz aus Lügen an der Fälschung der Welt beteiligen. Mit diesem sprachgewaltigen, amüsant und wild wuchernden Epos, das 1955 in den USA erschien, ist William Gaddis ein großer Wurf gelungen, ein Zeitroman über eine bodenlose, auf Lug, Trug und Schein aufgebaute Welt, ein Paukenschlag von einem Buch, das zu den bedeutendsten Meisterwerken der Literatur zählt und als Schlüsselroman der Moderne gilt.
Wyatt Gwyon wächst als Priestersohn unter der rigiden Obhut seiner Tante in der Provinz Neuenglands auf und entwickelt ein zeichnerisches Talent. Schließlich landet er Ende der vierziger Jahre im New Yorker Greenwich Village, wo er aus Not zu einem genialen Kunstfälscher wird. Doch er kopiert nicht etwa die alten Meister, sondern erfindet neue »Originale« und arbeitet damit korrupten Händlern und Hehlern in die Hände. Um ihn herum gibt es ein ganzes Heer an Künstlern, Kunstexperten, Schriftstellern, Geistlichen, Forschern und Politikern, die sich alle in einem Netz aus Lügen an der Fälschung der Welt beteiligen. Mit diesem sprachgewaltigen, amüsant und wild wuchernden Epos, das 1955 in den USA erschien, ist William Gaddis ein großer Wurf gelungen, ein Zeitroman über eine bodenlose, auf Lug, Trug und Schein aufgebaute Welt, ein Paukenschlag von einem Buch, das zu den bedeutendsten Meisterwerken der Literatur zählt und als Schlüsselroman der Moderne gilt.
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Angela Schader findet William Gaddis' Meisterwerk "Die Fälschung der Welt", das jetzt in einer revidierten Neuauflage der deutschen Übersetzung vorliegt, nach wie vor überwältigend. Der 1200 Seiten umfassende Roman mit seiner nicht nacherzählbaren, überbordenden Geschichte um den genialen Fälscher Wyatt strotzt in ihren Augen nur so vor Witz und Wut, Anspielungen und Bezügen, mystischen, surrealen und grotesken Elementen. Sie liest das Werk als Spiegelbild der zeitgenössischen Kultur und als Gegenentwurf dazu, als so faszinierendes wie ätzendes gesellschaftliches und künstlerisches Panorama, als Werk, das die großen Themen Kunst, Religion und Wahrheitssuche eindrucksvoll verhandelt. Ausführlich widmet sich Schader den Anspielungen und Leitmotiven des Romans und geht in diesem Zusammenhang insbesondere auf das Spiegelmotiv von Selbsterekennen und Wiederkennen sowie auf die Faust-Thematik ein. Bedauerlich scheint ihr nur, dass der Verlag auf eine gleichzeitige Herausgabe von Steven Moores unverzichtbarem Kommentarband zum Werk verzichtet hat. Doch ändert dies nichts an ihrer Bewunderung für Gaddis' "Fälschung der Welt", einen Roman, der in ihren Augen, "Achtung und Achtsamkeit fordert, aber auch funkelt vor Witz und Humor".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Mr. Difficult oder Der gefährliche Pakt zwischen dem Autor und seinem Leser: Wie ich lernte, die Romane von William Gaddis zu lesen
Nachdem mein dritter Roman erschienen war, bekam ich eine Zeitlang viel zornige Post. Was die Schreiber irritierte, war nicht so sehr mein Roman - eine Komödie über eine Familie in der Krise - als die Tatsache, daß ich in der Presse gewisse undiplomatische Bemerkungen gemacht hatte. Ich wußte gleich, daß es falsch war, hierauf mit mehr als einem einzigen Satz von neutraler Höflichkeit zu antworten. Aber ich wollte ein wenig Widerstand leisten. In Anlehnung an Äußerungen eines meiner alten literarischen Helden, William Gaddis', der darüber geklagt hatte, daß das Publikum immer das Werk eines Autors und seine private Identität verwechselt, schlug ich vor, die Leute, die mir geschrieben hatten, sollten bitte lieber meine Romane lesen als sich um irgendwelche verzerrte Medienberichte über den Autor kümmern.
Einige Monate danach meldete sich eine der Briefschreiberinnen zurück, eine Mrs. M. in Maryland, und trat den Beweis an, daß sie mich tatsächlich gelesen hatte. Sie begann damit, dreißig ungewöhnliche Wörter und Ausdrücke aus meinem Roman aufzulisten, Wörter wie "Diurnalität" und "Antipoden", Formulierungen wie "elektropointillistische Weihnachtsmanngesichter". Dann stellte sie die fürchterliche Frage: "Für wen schreiben Sie eigentlich? Gewiß kann es nicht der Durchschnittsleser sein, der sich einfach gut unterhalten möchte bei der Lektüre." Und dann kam sie mit folgender Karikatur meiner selbst und meines vermutlichen Publikums daher: "Die Elite von New York, die Elite schöner, anorexischer, neurotischer, auskennerischer Nichtraucher, die dreimal jährlich abtreiben, vollkommen antiseptisch leben, in Lofts oder Penthouses wohnen - diese erhabene Form der Menschheit, die ,Harper's' und den ,New Yorker' liest." Es schien dabei vorausgesetzt, daß ein gewisser Grad von Schwierigkeit in einem Roman nichts anderes sein kann als ein Werkzeug gesellschaftlich privilegierter Leser und Schreiber, die verächtlich auf das Vergnügen "guter Unterhaltung" herabschauen und das hämische, künstliche Vergnügen vorziehen, sich anderen Leuten überlegen zu fühlen. Für Mrs. M. war ich ein "aufgeblasener Snob".
Ein Teil von mir (der Teil, der auf meinen Vater kommt - meinen Vater, der die Gebildeten wegen ihres Intellekts bewunderte und wegen ihres großen Wortschatzes und der selbst so etwas wie ein gebildeter Mann war) hätte Mrs. M. gerne im Gegenzug gesagt, was sie für mich ist. Doch ein anderer, ebenso stark ausgeprägter Teil meiner selbst war tief getroffen, als ich las, daß Mrs. M. sich durch meine Sprache ausgeschlossen fühlte. Sie hörte sich ein wenig an wie meine Mutter, die ihr Leben lang scharf antielitär argumentierte und Tiraden auf dem mythischen Begriff der "kleinen Leute" aufbaute. Sie hätte mich ebenfalls fragen können, ob ich Wörter wie "Diurnalität" wirklich gebrauchen mußte oder ob ich damit einfach angeben wollte.
Angesichts einer solchen Feindseligkeit wie der von Mrs. M. bin ich wie gelähmt. Und wenn ich nun genau hinschaue, wird mir klar, daß ich an zwei völlig verschiedene Modelle davon glaube, wie sich Fiktionen zu ihrem Publikum verhalten sollen. In dem einen Modell, dem Flauberts zum Beispiel, sind die besten Romane große Kunstwerke, ihren Verfassern gebührt höchste Achtung, und wenn der Durchschnittsleser das Werk ablehnt, dann deshalb, weil der Durchschnittsleser eben ein Philister ist. Der Wert eines jeden Romans ist ganz unabhängig von der Zahl derer, die ihn zu schätzen wissen. Wir können das als Statusmodell bezeichnen. Es gehört in einen Diskurs von Genialität und künstlerisch-historischer Bedeutung.
In dem entgegengesetzten Modell stellt ein Roman ein Bündnis zwischen Schriftsteller und Leser dar, bei welchem der Autor die Wörter liefert, aus denen sich der Leser ein angenehmes Erlebnis erschafft. Das Schreiben impliziert eine Balance zwischen Selbstverwirklichung und Kommunikation innerhalb einer Gruppe (mag diese nun aus "Finnegans Wake"-Enthusiasten oder Barbara-Cartland-Fans bestehen). Jeder Autor ist zunächst einmal Mitglied einer Gruppe von Lesern, und der tiefste Sinn des Lesens und Schreibens von Fiktion liegt darin, ein Gefühl der Verbundenheit zu stärken, Widerstand gegen die existentielle Einsamkeit zu leisten. So verdient ein Roman die Aufmerksamkeit eines Lesers nur so lange, wie er das Vertrauen des Lesers an sich binden kann. Das ist das Vertragsmodell. Der Diskurs thematisiert hier Vergnügen und Verbundenheit. Meiner Mutter hätte das gefallen.
Einem Anhänger des Vertragsmodells erscheint die Status-Gruppe als ein arrogant-elitärer Haufen von eitlen Kennern. Einem Statusgläubigen dagegen kommt das Vertragsmodell wie ein Rezept für servile ästhetische Kompromisse vor, mit denen man ein Babel konkurrierender literarischer Kleingemeinden bedient. Bei bestimmten Romanen spielt diese Unterscheidung natürlich keine so große Rolle. Austens "Stolz und Vorurteil", Edith Whartons "House of Mirth" - da sagst du Kunst, ich sage Unterhaltung, beide blättern wir zur nächsten Seite um. Aber die beiden Modelle treten in scharfen, signifikanten Kontrast, wenn die Leser ein Buch schwierig finden.
Im Vertragsmodell ist Schwierigkeit immer ein Problem. In den schwersten Fällen überführt sie einen Autor der Bevorzugung egoistischer künstlerischer Prinzipien oder schlichter persönlicher Eitelkeit vor dem legitimen Bedürfnis des Publikums, gut unterhalten zu werden; der Autor ist mit anderen Worten ein Mistkerl. Formuliert man die Position extrem marktwirtschaftlich, ist es immer die Schuld des Produkts, wenn es nicht ankommt. Wenn man sich einen Zahn an einem schwierigen Wort im Roman anknackst, verklagt man den Autor. Wenn das lokale Symphonieorchester zu viel Musik des zwanzigsten Jahrhunderts spielt, kündigt man das Abonnement. Man ist ja schließlich kein Geringerer als der Verbraucher: Man diktiert die Bedingungen.
Aus der Statusperspektive weist Schwierigkeit meist auf hohe Qualität hin, sie suggeriert, daß der Romanautor alle billigen Kompromisse verschmäht hat und seiner künstlerischen Vision treu geblieben ist. Leicht lesbare Fiktion hat nur geringen Wert, meint man hier. Ein Vergnügen, das sich an harte Arbeit knüpft, an das langsame Vordringen in ein Geheimnis, das sich nur dann öffnet, wenn man länger bei der Stange bleibt als geringere Leser - dieses Vergnügen lohnt sich am meisten. Und wenn jemand (Mrs. M. zum Beispiel) das nicht bringt, dann soll sie doch abhauen.
Der Statusstandpunkt schmeichelt zweifellos dem Selbstwertgefühl des Autors. Im Innersten aber bin ich eigentlich auf der Seite des Vertragsmodells. Ich bin in einer freundlichen, egalitären Vorstadt aufgewachsen, wo ich Bücher zu meinem Vergnügen gelesen und alle Autoren ignoriert habe, die mein Vergnügen nicht ernst genug nahmen. Selbst als Erwachsener muß ich sagen: Ich bin ein eher schlampiger Leser. Ich habe - in vielen Fällen mehr als einmal - angefangen, "Moby-Dick" zu lesen, "Der Mann ohne Eigenschaften", "Mason & Dixon", "Don Quijote", "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit", "Doktor Faustus" und "Die goldene Schale", und nie bin ich in die Nähe des Schlusses gekommen. Tatsächlich ist das bei weitem schwierigste Buch, das ich je ganz gelesen habe, William Gaddis' knapp tausend Seiten langer Erstlingsroman "Die Fälschung der Welt" (The Recognitions).
Gaddis, dessen letzte zwei Bücher in diesem Herbst in den Vereinigten Staaten veröffentlicht werden, vier Jahre nach seinem Tod, wäre im Dezember achtzig geworden. Wie nur je ein amerikanischer Autor seiner Generation hat er offen das Statusmodell vertreten, den Vertrag mit dem Publikum verachtet. Seine Methoden waren zunehmend postmodernistisch, aber er hatte altmodisch-romantische, an die klassische Moderne angelehnte Vorstellungen vom Künstler als Messias und vom heilig-singulären Kunstwerk; die Leiden der Kunst und des Künstlers in einem wahnwitzig kommerziellen Amerika stehen im Zentrum seines Werks. Eines Werks, das seinem Wesen nach überaus schwierig ist.
Anderthalb Wochen lang las ich täglich sechs bis acht Stunden ohne Unterbrechung. Ich empfand eine gewisse professionelle Neugier, wie Gaddis das machte, aber ein paar hundert Seiten der "Recognitions" hätten durchaus gereicht, diese Neugier zu befriedigen. Ich saß da und las die anderen siebenhundert Seiten in einer Art Trance, wie jemand, der einen steilen Berg Schritt um Schritt hinaufsteigt.
Es galt, Zitate auf lateinisch, spanisch, ungarisch und in sechs anderen Sprachen zu erklimmen. Stürme obskurer Anspielungen tobten um ragende Klippen esoterischer Bildung, abrupt abstürzende Exkurse über Alchemie und flämische Malerei, Mithras-Kult und frühchristliche Theologie. Die Prosa erstreckte sich in seitenlangen Absätzen, wo der Sauerstoff knapp wurde, und die emotionale Temperatur des Romans war anfangs schon kalt und wurde immer kälter. Der Held, Wyatt Gwyon, war als Kind sympathisch, aber ansonsten wiesen die satirischen Urteile und intellektuellen Diagnosen des Autors jeglichen Versuch des Lesers zurück, Intimität zu empfinden. Es kostete große Anstrengungen, herauszufinden, wovon oder auch nur von wem die Geschichte handelte; die Dialoge waren mit Gedankenstrichen interpunktiert und weitgehend ohne Zuordnung zu bestimmten Personen; Wyatt selbst schrumpfte zu einem heimlichen, selten erblickten Pronomen ("er"); es tauchten brutale Partyszenen auf, Stürme reinen Dialogs, die Dutzende von Seiten tobten. Die einzige Verpflegung, die mich bei meinem Aufstieg hätte stärken können, wäre Vertrautheit mit den literarischen Einflüssen auf Gaddis gewesen, speziell eine eiserne Ration T. S. Eliot und Robert Graves hätte gutgetan, aber ich hatte ja nichts dabei. Ich hing allein und unvorbereitet an einem steilen, kalten, nur dürftig kartographierten Gebirgshang.
Fortsetzung auf der folgenden Seite.
Aber ich liebte das Buch. Auf dem verborgenen Gipfel des Romans, hinter den ziehenden Wolken sekundärer Symbolik, liegt eine Geschichte vom Verlust persönlicher Integrität und von der Arbeit daran, sie wiederzuerlangen. Wyatt, ein begabter Maler und einstiger Seminarist, lebt in New York, ist unglücklich verheiratet und schlägt sich mit Aushilfsjobs als Zeichner durch. Seinen Ehrgeiz als Maler hat er aufgegeben, vielleicht weil ein korrupter französischer Kritiker seine frühen Versuche niedergemacht hat, wahrscheinlich aber wegen seiner eigenen unglaublichen Ernsthaftigkeit. Eines Tages schlägt ihm in New York ein Kapitalist und Kunstsammler einen faustischen Pakt vor: Wyatt wird das Werk flämischer alter Meister fälschen, und dieser wird sie verkaufen. Wyatt willigt ein, aber nach Anfangserfolgen fehlt ihm die erforderliche Rückgratlosigkeit. Er spielt mit dem Gedanken, seine religiösen Studien wiederaufzunehmen, aber als er nach Neuengland zurückkehrt, muß er feststellen, daß sein Vater, ein protestantischer Pfarrer, sich dem Mithras-Kult zugewandt und den Verstand verloren hat. Also beginnt Wyatt so etwas wie eine lange Pilgerschaft, zuerst in New York, wo er seine eigenen Fälschungen zu entlarven versucht, und dann in Europa. Zuletzt sieht man ihn, wie er auf Seite 900 ein spanisches Kloster mit dem Entschluß verläßt, "endlich absichtsvoll zu leben".
Damals, als ich in der Wand hing, war mir nicht bewußt, daß ich mich an den Parallelen zwischen Wyatts Geschichte und meiner eigenen festklammerte: unser bizarr isoliertes Leben im Süden Manhattans, unsere gescheiterten Versuche, uns an das System zu verkaufen, unsere bemühten Zweifel an der Kunst, unsere verrückten Väter. Ich war einfach glücklich, daß ich ein schwieriges Buch zu lesen hatte, und es beeindruckte mich, daß ich es schaffte. Als ich auf der letzten Seite der "Recognitions" angekommen war, fühlte ich mich in der Lage, mit allem fertig zu werden, was mich in der Welt erwartete. Ich fühlte mich tugendhaft, als hätte ich einen Drei-Meilen-Lauf hinter mir, hätte meinen Spinat gegessen, wäre beim Zahnarzt gewesen, hätte die Steuererklärung abgegeben, wäre in die Kirche gegangen.
Vier Jahre des Erlernens von Komplexität an der Universität hatten ihre kumulative Wirkung getan. Als Erstsemester dachte ich, es wäre cool, wenn ich mir meinen Lebensunterhalt mit dem Schreiben von Geschichten verdienen könnte und wenn ich meinen Namen gedruckt sähe. Gegen Ende des Studiums war es mein Ehrgeiz, literarische Kunstwerke zu schaffen. Ich setzte voraus, daß große Romane kompliziert waren, sich einer beiläufigen Lektüre widersetzten. Ich glaubte, daß es das höchste Kompliment an ein Kunstwerk war, wenn man es an der Universität zum Gegenstand eines Seminars machte.
Meine Eltern verstanden das nicht. Als ich mein erstes Buch zu schreiben anfing, nach dem College, fühlte ich den skeptischen Blick meines Vaters auf mir ruhen, konnte innerlich hören, daß er Fragen stellte wie: "Was trägst du denn mit deinen Fähigkeiten zum Leben der Gesellschaft bei?" Auf dem College hatte ich Derrida und Marx und die feministischen Kritikerinnen bewundert - Leute, die es sich zur Aufgabe gemacht hatten, die modernen Systeme in Frage zu stellen. Ich dachte, ich könnte mich vielleicht ebenfalls gesellschaftlich nützlich machen, indem ich Fiktionen verfaßte, die diese In-Frage-Stellung vollzogen. In der Stadtbücherei von Somerville, Massachusetts, stellte ich mir einen Kanon von intellektuellen, gesellschaftlich unruhig-subversiven weißen männlichen amerikanischen Erzählern zusammen. Dieselben Namen - Pynchon, DeLillo, Heller, Coover, Gaddis, Gass, Burroughs, Barth, Barthelme, Hannah, Hawkes, McElroy und Elkin - tauchten immer wieder in Anthologien und in den Würdigungen der zeitgenössischen Kritik auf. Obwohl stilistisch verschieden, teilten sie alle das postmoderne Mißtrauen gegen den Realismus, wie es der Kritiker Jerome Klinkowitz zusammenfaßte: "Wenn die Welt absurd ist, wenn das, was als Wirklichkeit gilt, quälend unwirklich ist, warum sollte man sich damit beschäftigen, es wiederzugeben?"
Mein Problem war es, daß mir mit wenigen Ausnahmen - DeLillo vor allem - die Autoren meines modernen Kanons eigentlich nicht gefielen. Ich lieh mir ihre Bücher aus (darunter "Die Fälschung der Welt"), las ein paar Seiten, gab sie wieder zurück. Erst in den Neunzigern versuchte ich meinen College-Enthusiasmus für schwierige Bücher neu zu entfachen. Ich brauchte den Beweis, daß ich ein ernster Künstler war. Für diesen Zweck war "Die Fälschung der Welt" hervorragend geeignet. Das Buch warf mich um. Die Figuren waren nicht sympathisch, aber Witz und Leidenschaft und Ernst ihres Schöpfers waren es. Ich gab meinem dritten Roman, "The Corrections", seinen Titel auch in Verehrung dieses Werks von Gaddis.
Ein paar Jahre nachdem ich mir "Die Fälschung der Welt" erobert hatte, begann ich Gaddis' zweiten Roman "J. R." zu lesen. Der Roman war ebenso brillant wie "Die Fälschung der Welt". Dennoch gab ich eines Abends mitten in einem Vier-Seiten-Absatz auf, und als ich einige Tage später "J. R." wieder aufschlug, hatte ich die Orientierung verloren. Ich legte das Buch beiseite und hoffte, die Fäden an einem späteren Abend wieder aufnehmen zu können. Nach zwei Monaten stellte ich es verstohlen wieder ins Regal.
Im Sinne des Statusmodells hatte ich schlicht als Leser versagt. Aber ich hatte das Vertragsmodell auf meiner Seite. Ich hatte dem Buch wochenlang meine Abendlektüre geschenkt; es war immer noch nichts für mich. Beim langen Marsch durch "J. R." wollte ich Gaddis immer am Revers packen, ihn schütteln und schreien: "Hallo! Ich bin der Leser, den Sie suchen! Ich liebe anspruchsvolle Konstruktionen, ich bin auf der Suche nach einem guten Systemroman. Wenn Sie nicht mal mir einen schönen Abend verschaffen können, wer soll Sie dann überhaupt noch lesen?" Aber das machte die Tatsache, daß ich mit dem Lesen aufgehört hatte, nur schlimmer. Ebender Umstand, daß ich so gut ausgerüstet war, Gaddis zu lesen, ließ es mich als persönlichen Verrat empfinden, daß ich "J. R." nicht beendet hatte.
Gaddis entschied sich dafür, ein Purist seines Glaubens zu sein. In seiner fünfzigjährigen Laufbahn gab er nur ein einziges größeres Interview. Er ließ einen einzigen autobiographischen Essay erscheinen. Er las nicht öffentlich. Nicht daß ein Übermaß an Medieninteresse je ein Problem gewesen wäre. "Die Fälschung der Welt" wurde 1955 veröffentlicht. Es erschienen 55 Rezensionen, aus heutiger Sicht eine beeindruckende Zahl. Es wurden etwa fünftausend Exemplare verkauft - nicht schlecht für den anspruchsvollen Erstling eines Unbekannten. Doch der Roman verschwand rasch aus dem Bewußtsein der Öffentlichkeit.
"Ich glaube fast, wenn ich den Nobelpreis bekommen hätte, als ,Die Fälschung der Welt' erschien, hätte mich das nicht besonders überrascht", sagte Gaddis 1986 in dem Interview mit der "Paris Review" und fügte hinzu, die Aufnahme des Buchs habe auf ihn "desillusionierend" gewirkt. Vielleicht hätte sich Gaddis' Haltung im Falle eines größeren Erfolgs gelockert. Aber ich bezweifele es. Das Buch handelt von der Gleichgültigkeit der Alltagswelt der höheren Wirklichkeit der Kunst gegenüber. Seine letzten Worte ("Man spricht . . . mit hoher Achtung davon, auch wenn es selten gespielt wird") nehmen das eigene Schicksal vorweg. Wenn man die Hoffnung nährt, daß der marginale Roman, den man schreibt, am Ende doch vom breiten Publikum gefeiert wird, dann bereitet man rituell die eigene Enttäuschung vor, man sichert den eigenen Status als Weltverleugner, man bleibt im innersten Herzen ein zorniger junger Mann. In den vier Jahrzehnten seit der Veröffentlichung der "Fälschung der Welt" ist Gaddis' OEuvre immer zorniger und zorniger geworden.
Ein Teil von Gaddis' Wut scheint von Anfang an dagewesen zu sein. Er kam 1922 auf die Welt und wuchs mit seiner Mutter in einem alten Haus in Massapequa auf Long Island auf. Gaddis war als junger Mann ein Raufbold, ein Trinker. Wegen eines Nierenleidens war er nicht im Krieg, er studierte Englisch in Harvard, wurde aber ohne Abschluß der Universität verwiesen, nachdem es einen Zusammenstoß mit der Polizei gegeben hatte. Dann trieb es ihn durch Europa, Lateinamerika und New York, während er an der "Fälschung der Welt" arbeitete. Im Jahr der Veröffentlichung heiratete er eine Schauspielerin, Pat Black, mit der er zwei Kinder hatte. Hier verändert sich abrupt die Grundstimmung seiner Biographie, an die Stelle fremdländischer Schauplätze tritt das Vororthaus mit Kindern. Wie ein Jahrhundert zuvor Melville ging Gaddis im Süden Manhattans zur Arbeit. Er arbeitete als Public-Relations-Texter unter anderem für IBM, Eastman Kodak, Pfizer. Zwanzig Jahre lang, während der literarische Geschmack der Nation von dem in den Fünfzigern dominanten Realismus zu den schrägeren Tonlagen von "Portnoys Beschwerden" und "Catch-22" wechselte, blieb Gaddis unsichtbar. Er begann einen "Geschäftsroman" und ein Theaterstück und brach die Arbeit wieder ab. Er rauchte und trank viel. Seine erste Ehe endete. Erst gegen Ende der sechziger Jahre kratzte er genügend Stipendiengelder zusammen, um seine ganze Zeit jenem Geschäftsroman zu widmen.
Als dieses Buch 1975 erschien, hatte die Stimmung im Land zu Gaddis aufgeholt. "J. R." bekam bewundernde Rezensionen und erhielt den National Book Award. Gaddis' Erzählen war nicht einfacher geworden. "J. R." ist ein Roman von 726 Seiten, der fast ausschließlich aus mitgehörten Stimmen besteht, ohne Anführungszeichen, ohne konventionelle Narration, ohne Kapiteleinteilung, sogar ohne eine Unterteilung des Textes in längere Blöcke, aber mit Tausenden von Gedankenstrichen und Auslassungen, mit einer wiederum nach Dutzenden zählenden Besetzung und einer geradezu lachhaft komplizierten Handlung, die auf Wagners "Ring" aufbaut und zum Mittelpunkt ein Multimillionen-Wirtschaftsimperium hat, dessen Besitzer und Lenker J. R. Vansant ist, ein elfjähriger Schuljunge auf Long Island.
J. R. ist die Rotznase, deren ganze Existenz darin besteht, daß er irgendwelches Zeug haben will und es dann gegen anderes, besseres Zeug eintauscht. Wie sein Schöpfer ist er durch und durch obsessiv. Er träumt von dem, was seine Nation ihn zu erträumen lehrt. Er ist ohne jede Liebenswürdigkeit, Mitgefühl, Skrupel, aber er weiß es nicht besser, also ist der Leser auf seiner Seite, wenn er gegen die Haie aus Vorstandsetagen und Anwaltskanzleien antritt, die den Roman bevölkern.
"J. R." leidet an ebendem Wahnsinn, gegen den sich das Buch stemmen möchte. Die ersten zehn Seiten und die letzten zehn Seiten und alle zehn Seiten dazwischen verkünden uns, daß das Leben in Amerika seicht, betrügerisch, käuflich und kunstfeindlich ist. Doch der Roman wird ebenso kalt, mechanistisch und erschöpfend wie das System, das er beschreibt. J. R. hat große Ähnlichkeit mit Bart Simpson, aber Bart spiegelt unsere Kultur auf unvergleichlich angemessenere Weise als J. R. Das eigenartige ist, daß ich vermute, Gaddis selbst hätte sich lieber "Die Simpsons" angeschaut. Ich vermute, wenn jemand anderes die späteren Romane geschrieben hätte, dann hätte Gaddis sie nicht lesen mögen, und hätte er sie gelesen, hätten sie ihm nicht gefallen.
Gaddis' letzter richtiger Roman, "Letzte Instanz", wandert fast sechshundert Seiten lang dahin und daher, um vorzuführen, wie ein System, das Ordnung schaffen soll (die amerikanische Justiz), am Ende Unordnung fördert. Das Buch ist ideal für Proseminare. Es kommt zu einem banalen, aber einwandfreien gesellschaftlichen Schluß (wir ziehen in Amerika zu oft vor Gericht), es wimmelt von Motiven, Zitaten, sekundären Geschichten und zahllosen Anspielungen sowohl auf Gaddis' frühere Werke wie auf andere berühmte Texte, und tatsächlich liegt seine einzige ästhetische Schwäche darin, daß es sich endlos wiederholt, zusammenhanglos ist und wahnwitzig langweilig. Dieser Roman hat natürlich von allen Büchern Gaddis' die allerbesten Kritiken bekommen.
In "Die Fälschung der Welt" wird ein Sohn erwachsen und verschwindet. Im Mittelpunkt der beiden anderen Romane steht ein sehr großes Kind. In "Letzte Instanz" ist es der selbstsüchtige, unvernünftige, selbstmitleidsvolle, unfähige, unersättliche Oscar, ein Schwein in der Rolle eines Königs, ein leidender Künstler, der kaum Talent hat. Oscar weckt Sympathien nur, um sie zu mißbrauchen. Der Roman ist ein Beispiel für das ganz spezifische Abrosten des literarischen Postmodernismus. Gaddis begann seine Laufbahn mit einem modernistischen Epos über die Fälschung von Meisterwerken. Er endete sie mit einem Pornogehüpf, das einem Meisterwerk ähnelt, aber den Leser bestraft, der versucht, der Logik des Buchs zu folgen.
Wie viele dem Vertragsmodell anhängende Amerikaner, wie die literarischen Gesellschaften vor hundert Jahren, wie die Buchklubs heutzutage bin ich mir bewußt, daß der Vertrag Arbeit erfordern kann. Ich weiß, daß das Vergnügen an einem Buch nicht immer einfach ist. Ich will arbeiten. Es liegt jedoch auch in meinem protestantischen Wesen, daß ich dafür einen gewissen Lohn erwarte. Und obwohl mir bei der Suche nach diesem Lohn die Kritiker eine gewisse pastorale Hilfe angedeihen lassen können, glaube ich, daß hier am Ende jeder Mensch allein ist. Als Leser suche ich eine direkte persönliche Beziehung zur Kunst. Die Bücher, die ich liebe, auf welchen mein Glaube an die Literatur beruht, sind die, mit denen ich eine solche Beziehung habe. "Die Fälschung der Welt" stellte sich zu meiner Überraschung als ein solches Buch heraus.
Nach diesem Buch jedoch geschah etwas mit Gaddis. Etwas lief schief. Tatsächlich liegt das Wesen des Postmodernismus in einer pubertären Angst, auf irgend etwas hereinzufallen, in der pubertären Überzeugung, daß alle Systeme verlogen sind. Diese Theorie hat etwas Zwingendes, aber als Lebensform ist sie ein Rezept für leere Wut. Das Kind wächst ins Riesige, aber es wird nie erwachsen.
Ich glaube, darin liegt eine gute Geschichte. In dem Maße, wie ich glaube, daß es die von Gaddis selbst ist, stillt sie meinen Ärger über ihn, löst ihn auf in Trauer. Ein solcher Gaddis ist weit von einer Karikatur entfernt, und eine solche Geschichte würde nie in ein "Simpsons"-Format passen. Für eine solche Geschichte, deren Schwierigkeit die Schwierigkeit des Lebens selbst ist, ist der Roman zuständig.
Aus dem Amerikanischen von Joachim Kalka.
Von Jonathan Franzen, geboren 1959, erschienen in diesem Jahr der Roman "Die Korrekturen" und der Essayband "Anleitung zum Einsamsein".
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main