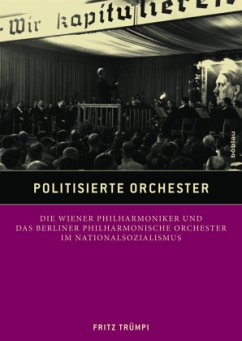Vor der Folie eines Vergleiches zwischen den Wiener und Berliner Philharmonikern im "Dritten Reich" liefert Fritz Trümpi eine detailreiche Studie über nationalsozialistische Musikpolitik. Die Politisierung der beiden Konkurrenzorchester, welche überdies den Städtewettbewerb zwischen Wien und Berlin repräsentierten, diente beiderseits der nationalsozialistischen Herrschaftssicherung, war in ihrer Ausführung aber von signifikanten Unterschieden geprägt. Ausgehend von einem vergleichenden Aufriss der Frühgeschichte der beiden Orchester untersucht der Autor Kontinuitäten und Brüche im Musikbetrieb nach der Machtübertragung an die Nationalsozialisten und dem "Anschluss" Österreichs an NS-Deutschland. Dazu greift Trümpi auf ebenso brisante wie vielfältige Archivmaterialien zurück, die hier zum Teil erstmals der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Die örtlichen Eigentümlichkeiten blieben unangetastet, die Gehälter stiegen: Die Wiener und die Berliner Philharmoniker im Nationalsozialismus
Im Frühjahr 1897 gastieren die Berliner Philharmoniker in Wien. Das Orchester ist gerade 15 Jahre alt, aber es tritt mit Anspruch auf, an sechs Abenden hintereinander unter der Leitung von drei der bekanntesten Dirigenten der Zeit: Mottl, Nikisch, Weingartner. Dem Wiener Fremdenblatt missfällt das. Wer wäre wohl so „massenhaft gebotenen Genüssen“ gewachsen? Die Neue Freie Presse ist ähnlich unglücklich: Dies zwanghafte „Gastiren und Wettdirigiren“ degradiere das Orchester zur Maschine. Der Wettbewerb des Wiener und Berliner Musiklebens und seiner beiden großen Orchester ist eröffnet, und schon stehen die Selbst- und Fremdzuschreibungen bereit, mit denen man ein gutes Jahrhundert die beiden Städte beurteilen wird. Wien zeigt sich ruhig, human, traditionsbewusst. Berlin ist modern, sportiv, technisch glänzend, eine Stadt des Massenzeitalters. Und so ist auch seine Musik, so sind die Berliner Philharmoniker. Alles wirkt angespannt. Roda Roda wird später schreiben: ohne Schweiß kein Preuß.
So klischeehaft das Wiener Urteil erscheint, es lassen sich Tatsachen dafür geltend machen. Die Berliner Philharmoniker nehmen gleich nach ihrer Gründung eine ausgedehnte Reisetätigkeit auf, sie bemühen sich um die neuen medialen Möglichkeiten und beginnen das Plattengeschäft. Und sie spielen regelmäßig populäre Konzerte. Das alles wehren die Wiener Philharmoniker ab. Manches liegt an den äußeren Bedingungen. Sie sind im Hauptberuf Mitglieder des Hof- oder Staatsopernorchesters, das zieht der Konzerttätigkeit Grenzen. Aber sie wollen es auch so. Sie bestehen auf dem Kanon der großen Werke, für Experimente mit zeitgenössischer Musik geben sie sich nicht gern her. Reisen, Schallaufnahmen, das widerstrebt ihnen.
Und ein zweites Gegensatzpaar bildet sich schon Ende des 19. Jahrhunderts heraus. Die Berliner Philharmoniker beanspruchen, Repräsentant deutscher Musik- und Orchesterkultur zu sein, Maßstab nach innen, Botschafter nach außen. Die Wiener Philharmoniker beziehen sich auf die Musikkultur ihrer Stadt, sie sprechen sich einen besonderen wienerischen Klang zu, abgerundet, weich, wie es dem harmonischen Sinn der Stadt entspreche. Ihr Selbstbild entsteht in der Abgrenzung gegen Berlin; Hofmannsthals Schema „Preuße und Österreicher“ von 1917 scheint durch. Politisch ging es wohl gar nicht anders. Die Völker der Habsburger-Monarchie konnten sich vielleicht noch auf Wien als ihre Hauptstadt verständigen, gewiss aber nicht auf eine maßstabsetzende deutsche Kultur.
Man muss schon von Markenbildung sprechen, die die beiden Orchester betrieben. Diese Marken waren so stabil, dass sie selbst den Nationalsozialismus überlebten. „Politisierte Orchester“ heißt eine neue Untersuchung über die Wiener und Berliner Philharmoniker im Nationalsozialismus. Der Autor, Fritz Trümpi, der mit dieser Arbeit an der Universität Zürich promoviert wurde, hat das Archivmaterial gründlich umgegraben; er hat auf dem ja keineswegs gerade erst entdeckten Feld der klassischen Musik im „Dritten Reich“ einiges Neue beizutragen.
Die Berliner Philharmoniker hatten in den späten 1920er Jahren die wirtschaftliche Basis ihrer Selbständigkeit eingebüßt und mussten um öffentliche Subventionen bitten. Ihre Argumentation war nationalpolitisch. So betonte Furtwängler 1932, dass während des Streits um die deutschen „Tribute“ Paris den Berliner Philharmonikern und ihrem „rein deutschen Programm“ einen „bedingungslosen Erfolg“ bereitete. Tatsächlich erklärten sich Berlin und das Reich bereit, die Philharmoniker zu unterstützen. Damit war deren Unabhängigkeit allerdings schon vor dem 30. 1. 1933 verloren. Goebbels, der die Philharmoniker seinem Ministerium unterordnete, hatte sogleich alle Möglichkeiten. Er setzte das „Führerprinzip“ durch, mit der Selbstregierung des Orchesters war es vorbei. Die jüdischen Musiker – es waren nur vier! – wurden entlassen, allerdings wohl gegen den Widerstand des Orchesters und Furtwänglers. Im Übrigen wurde das Orchester mit vorzüglicher Hochachtung behandelt. Die Gehälter stiegen auf eine einmalige Höhe (bald folgte die Preußische Staatskapelle dorthin) und im Krieg wurden die Musiker unabkömmlich gestellt, also nicht zur Wehrmacht eingezogen.
Mit dem sogenannten Anschluss 1938 hatte das Reich zwei Orchester, die sich für das weltbeste hielten. Das kleine Problem löste Goebbels durch Großzügigkeit. Die Wiener Philharmoniker durften ihren Vereinsstatus behalten – das war ein ganz ungewöhnliches Privileg –, mussten aber „Führer- und Rasseprinzip“ anerkennen. Das taten sie, elf jüdische Musiker wurden ausgeschlossen, anscheinend ohne nennenswerten Widerwillen. Darauf genossen die Philharmoniker den größten Respekt und wurden den Berliner Kollegen gleichgestellt in Besoldung und UK-Stellung. Die örtlichen Eigentümlichkeiten blieben unangetastet: „kein verwienertes Berlin, kein verberlinertes Wien“.
Dass die Wiener Philharmoniker sich früh schon als Vertreter nicht der Nation, sondern der Stadt gesehen hatten, passte bestens. Ab 1933, im Austrofaschismus, war daran weiter gearbeitet worden, durch die verstärkte Walzer-Pflege zum Beispiel. Das setzte sich im Nationalsozialismus fort, die Neujahrkonzerte wurden zum ersten Mal beim Jahreswechsel 1939/40 gespielt. Beide Orchester passten sich an, sie wurden zu Instrumenten der Außenpolitik durch Tourneen in den besetzten Ländern und den neutralen Staaten. Jüdische Komponisten und die „Neutöner“ waren selbstverständlich gebannt, Wagner und Bruckner wurden öfter gespielt. Darüberhinaus lässt sich eine nationalsozialistische Musikpolitik nicht recht erkennen. Im Übrigen wahrten die beiden Orchester ihr Profil. Die Wiener etwa beschränkten sich wie gehabt auf die kanonisierten Werke und pflegten das genuin Wiener Repertoire, die Berliner stellten immer wieder Zeitgenössisches vor.
Die Privilegien, die beide Orchester bis in die letzten Tage des Nationalsozialismus genossen, entsprangen mehr den musikalischen Interessen des nationalsozialistischen Führungspersonals als propagandistischen Zwecken. So zeigt sich hier eher ein Moment bürgerlicher Tradition als genuin nationalsozialistischen Denkens. Im Rundfunk etwa wurde der Anteil klassischer Musik nach 1933 gekürzt, Goebbels kalkulierte den Bildungswunsch seiner Volksgenossen niedrig und hatte wohl recht damit. Eine Umfrage von 1939 ergab, dass Sinfoniekonzerte von 8 Prozent der Befragten gehört wurden. Schlechter schnitten nur noch Kammermusik ab und die „Dichterstunden“. STEPHAN SPEICHER
FRITZ TRÜMPI: Politisierte Orchester. Die Wiener Philharmoniker und das Berliner Philharmonische Orchester im Nationalsozialismus. Böhlau Verlag, Wien, Köln, Weimar 2011. 357 Seiten, 39 Euro.
Wilhelm Furtwängler dirigiert ein von der NS-Organisation „Kraft durch Freude“ organisiertes Werkpausenkonzert der Berliner Philharmoniker. Foto: Scherl
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de

Wie wurden die großen Orchester im Nationalsozialismus an die Kandare genommen? Fritz Trümpis hochinformative Vergleichsstudie klärt auf.
Von Julia Spinola
Der französische Historiker François Furet bezeichnete die "ideologische Leidenschaft" als das Charakteristikum des zwanzigsten Jahrhunderts. Er hatte dabei auch eine völlig neue Form der totalen Herrschaft im Auge, die sich des Subjekts bis ins Innerste bemächtigen will. Selbst dort noch soll es gleichgeschaltet werden durch Gedanken-, ja Gemütskontrolle. So wird der Einzelne durch die politische Macht nicht bloß unterdrückt, sondern von Grund auf manipuliert. Nicht zufällig gehört die Propagandamaschinerie daher zu den zentralen systemtragenden Faktoren. Eigenständige kulturelle Deutungsinstanzen, darunter auch die Kunst, dürfen keine Chance besitzen, sich zu äußern. Das System muss sie an die Kandare nehmen.
Genau dies zeigt die Vergleichsstudie von Fritz Trümpi. Die Wiener Philharmoniker und das Berliner Philharmonische Orchester im Nationalsozialismus", auf ebenso gründliche wie exemplarische Weise. Der Reiz des Buches liegt nicht nur in der sehr klaren und übersichtlich dargestellten Aufarbeitung breiter Archivbestände. Vielmehr schlägt Trümpi gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Er liefert eine Rekonstruktion der politischen Verwicklungen, in die beide Orchester mit dem Nazi-Regime gerieten. Da er die Dispositionen dafür bis in die Gründungsphasen beider musikalischer Institutionen verfolgt, kommen auch Leser, die allgemein an Orchestergeschichte interessiert sind, auf ihre Kosten - zumal Trümpi mit einer ganzen Reihe wenig bekannter Details aufwartet.
Bereits die ersten Begegnungen zwischen beiden Orchestern stehen im Zeichen einer Rivalität. Ein Wien-Gastspiel des Berliner Philharmonischen Orchesters im Jahre 1897 löste bei Publikum und Presse eine Aufregung aus, in der mühsam verhohlene Bewunderung sich mischte mit Befremden. Die musikalischen Abgesandten der Preußen-Hauptstadt fielen im Konzertsaal durch eine Betriebsamkeit aus der Rolle, die von den Wienern als kunstfremde Sensationsmache empfunden wurde. Sechs Konzerte an sechs aufeinanderfolgenden Abenden mit drei der damals berühmtesten Dirigenten der Welt - Felix Mottl, Arthur Nikisch und Felix Weingartner - waren des Guten offenbar zu viel. Die Presse hetzte über die "neueste Capellmeister-Krankheit", das "Reisefieber" und ein Orchester, das als "Maschine" funktioniere.
Trümpi kann zeigen, dass die künstlerische Konkurrenz bereits damals eine politische Dringlichkeit besaß. Seit der als schmählich empfundenen Niederlage bei Königgrätz, die allerseits erkennbar war als Folge einer allgemeinen gesellschaftlich-wirtschaftlichen Rückständigkeit der Habsburgermonarchie, besaß der Anspruch Wiens, das Zentrum der deutschen Musikkultur zu sein, nationale Bedeutung. Ein Triumph Berlins in den Konzertsälen mit neuen preußischen Methoden war also auf keinen Fall hinzunehmen und entsprechend herunterzuspielen. Es ist verblüffend zu sehen, welch dominierende Rolle diese reibungsvolle Polarität der Kulturen beibehält bis in die Zeit der nationalsozialistischen Kulturlenkung hinein - und welche Unterschiede sich aus ihr ergaben hinsichtlich des Grades und der Art der Vereinnahmung.
Da war auf der einen Seite das neue Berliner Konzertorchester, das sich nur erhielt durch seine Eintrittsgelder und daher mit Rekordleistungen aufwarten musste. Es glänzte mit Dauerpräsenz im Konzertleben der Heimatmetropole, entwickelte eine intensive Reisetätigkeit, nutzte systematisch neue mediale Verbreitungsmittel wie die Schallplatte, pflegte ein breites Spektrum von Veranstaltungsarten, zu denen auch populäre Konzerte gehörten, und öffnete sich der musikalischen Moderne. Die Rechnung ging auf: Die Berliner wurden schnell zum international hoch gehandelten musikalischen Vorzeigeobjekt Preußen-Deutschlands. Auf der Gegenseite standen die Wiener mit ihrem traditionalistischen Immobilismus: "Mir san mir." Durch ihre Position im Opernorchester waren sie nicht auf Konzerteinnahmen angewiesen, als angestammte Symbolträger der Musikstadt Wien nicht auf eine neue Profilierung - im Gegenteil, die alte musste bewahrt werden.
Als Hüter der klassischen Substanz konnten sie von vornherein mit breiter Rückendeckung rechnen, wenn sie sowohl der Moderne als auch dem Populismus stets die kalte Schulter zeigten. Lediglich die Strauss-Dynastie durfte aus ihrer Position in der zweiten Reihe ins Stammrepertoire aufrücken, als man der Volksgemeinschaft etwas näher kommen sollte. Aber jene hatte ja immerhin den Segen von Wiener Größen wie Johannes Brahms. Wagemut birgt Risiken, und so ging es schon bald auch bei dem Berliner Vorführorchester nicht mehr ohne Subventionen - und das heißt auch: Abhängigkeiten - weiter. Das hatte gravierende Folgen. Aufgrund ihrer nationalen Symbolprominenz machte Propagandachef Goebbels den finanziell angeschlagenen Philharmonikern sofort nach der Machtübernahme Angebote, die sie nicht ablehnen konnten.
Diktaturen lieben das Klotzen. Die Gehälter der Orchestermitglieder wurden mehrfach so drastisch angehoben, dass selbst der Finanzminister zu intervenieren versuchte - vergeblich, versteht sich, zumal die Aufstufungen trickreich umdefiniert wurden in Reisezulagen. Die alte Versatilität des Orchesters kam den Propagandastrategien bestens entgegen. Die Berliner Philharmoniker firmierten nicht nur in heimischen Konzertsälen und auf bombastischen Feiern, sondern auch im Ausland sowie in Funk und Film gehorsam als Ausweis der Superiorität deutscher Musikkultur. Eine solche Vereinnahmung funktionierte mit den sturen Partikularisten aus Wien nicht ebenso einfach. Natürlich wurden auch an der Donau Juden umstandslos entlassen und zum Teil ermordet, gab es auch unter den Wiener Philharmonikern Mitglieder der NSDAP, begab sich auch das Wiener Orchester hin und wieder auf Propagandareisen. Aber der Nationalcharakter des Orchesters war gebunden an die Traditionen einer Stadt, die noch dazu eine Konkurrenzposition zu Berlin besaß. Und so war die Geschichte der Wiener Philharmoniker im Nationalsozialismus durchgehend geprägt von Versuchen, eine Sonderwegslösung zu gewinnen.
Trümpis Buch besticht durch eine hochinformative Sachlichkeit. Da ohnehin kein Anlass besteht, sich über die Rolle künstlerischer Karrieren in einem totalitären System irgendwelche Illusionen zu machen, kann der Gegenstand des Buches nicht die Entlarvung sein, sondern nur die genaue Einsicht. Ebendiese freilich zeigt einmal mehr, dass die Alternative zur Verwicklung - sofern man nicht das Lebensrisiko des aktiven Widerstandes in Betracht ziehen wollte - nur in der Emigration bestand.
Fritz Trümpi: "Politisierte Orchester". Die Wiener Philharmoniker und das Berliner Philharmonische Orchester im Nationalsozialismus.
Böhlau Verlag, Wien/Köln/Weimar 2011. 357 S., Abb., br., 39,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Auch wenn das Thema "klassische Musik im Dritten Reich" sicher kein unerforschtes Gebiet ist, stellt Rezensent Stephan Speicher nach der Lektüre von "Politisierte Orchester" fest, wie viel Neues er hier erfahren hat. So verdeutliche Fritz Trümpi in seiner Promotion wie die Wiener mit den Berliner Philharmonikern schon seit Ende des 19. Jahrhunderts in ihrer "Markenbildung" miteinander konkurrierten: Gemäß dem Motto "Ohne Schweiß kein Preuß" fand man die Berliner zu modern und technisch perfekt, während man sich in Wien traditionsbewusst gab und sich einen besonders harmonischen Klang zusprach. Auch als Goebbels die beiden Philharmonien seinem Ministerium unterordnete, behielten sie - nach Entlassung aller jüdischen Musiker und der Verbannung jüdischer Komponisten aus dem Spielplan - weitgehend ihr eigenes Profil und genossen zahlreiche Privilegien. Eine interessante Untersuchung, der man die gründliche Sichtung des Archivmaterials anmerke, so der Kritiker.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH