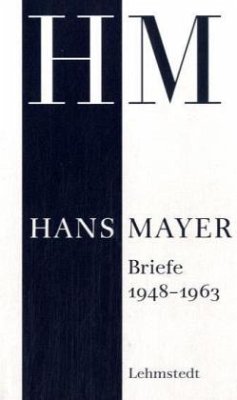Hans Mayers Briefe aus den Jahren 1948 bis 1963, in denen er an der Leipziger Universität gewirkt hat, sind ein umfassendes Spiegelbild der geistig-kulturellen Entwicklung der frühen DDR mit all ihren Höhen und Tiefen. Ob Thomas Mann oder Hermann Hesse, Bertolt Brecht oder Johannes R. Becher, Peter Huchel oder Franz Fühmann, Hans Werner Richter oder Günter Grass - Hans Mayer korrespondierte mit allen. Die Briefe machen deutlich, daß Mayer sich stets als Mittler verstand: Mittler zwischen Büchern und Lesern, Mittler zwischen Literatur und Wissenschaft, Mittler vor allem zwischen Ost und West - trotz Kaltem Krieg und persönlichen Anfeindungen von beiden Seiten.

Der hat im Kopf mehr als andere im Laptop: Hans Mayers Briefe
Damals in Leipzig, Anfang der fünfziger Jahre, hatte es sich unter uns Studenten herumgesprochen, dass ein Neuer da sei, ein noch ziemlich junger Professor, der gerade aus dem Exil zurückgekehrt war und zu dem es sich lohne hinzugehen. Er spreche atemlos, über die Satzenden hinweg, wisse unendlich viel, zeige das allerdings auch, aber sei eben ganz einfach interessant. Dass er drüben in der Gewifa las, der Gesellschaftswissenschaftlichen Fakultät, war zwar ein Handicap, denn das war üblicherweise das Reservat der Genossen. Aber was dieser Hans Mayer über das neunzehnte Jahrhundert, über Heine und Büchner vorzutragen hatte, klang so ganz anders als das, was wir sonst dort oder bei den Germanisten zu hören bekamen.
Gewiss schien er mit Marx auf gutem Fuße zu stehen; aber das große Panorama von Namen und Tendenzen eines Jahrhunderts, das er vor uns entfaltete, war faszinierend und lag weit jenseits allen offiziellen Kanons, des neuen, angeblich sozialistischen, wie des alten geisteswissenschaftlichen. Sprachgrenzen wurden aufgehoben, neben die Deutschen traten Balzac, Flaubert, Dickens. Und die Perspektiven wurden noch weiter durch die Musik, von der Mayer eine Menge zu verstehen schien, von Berlioz und Mendelssohn zum Beispiel und vor allem von Wagner. Hier, das wurde deutlich, spielte jemand auf einer großen Orgel mit allen Registern: Hans Mayer, geboren zu Köln am 19. März 1907.
Eines der Register, das Mayer gern zog, führte aus der Geschichte in die Gegenwart. Floskeln, leichthin eingestreut, wie "Brecht sagte mir neulich", verwendbar auch für Namen wie "Frau Seghers" oder "Doktor Becher", verfehlten ihre Wirkung bei jungen, bewunderungsbereiten Studenten nicht. Offenbar ging dieser Mayer bei der kulturellen Prominenz des eben erst gegründeten Staates ein und aus. War das alles staunenerregend, so war etwas anderes achtunggebietend. Mayer hatte gerade ein Buch über Thomas Mann geschrieben, dessen Werk in Leipzig zwar unerreichbar war, der aber 1949 zu Goethes Ehren als gefeierter Staatsbesucher durch die Republik geführt worden war. Ihn selbst also, den Großen, hatte er in der Schweiz besucht, wobei für uns, abgesehen vom Transfer des Hauches von Größe durch den Zwischenträger Hans Mayer, mindestens ebenso aufregend war, dass man tatsächlich in diese Schweiz reisen konnte, vorausgesetzt, dass man durfte.
Und Mayer durfte. Er würde demnächst, ließ er uns wissen, Vorlesungen halten in München, Tübingen, Zürich, Paris und anderswo in dieser Traumlandschaft des Westens. Verkündet wurden solche Reisepläne gern am Ende der Vorlesung im Pluralis Majestatis: "Wir werden demnächst in Heidelberg (oder Stuttgart oder Rom) über Goethe (oder Lessing oder Kleist oder Brecht oder Thomas Mann) lesen" - eine seltsame Allüre, die offenbar dem Gesprochenen die Würde des Gedruckten geben sollte, wie es sich ja in der Wissenschaft auf lange Zeit nicht gehörte, "ich" zu sagen. Auch das "lesen", wie Mayer es brauchte, stammte wohl daher, denn eigentlich las er ja nicht, sondern sprach frei und hatte in seinem wunderbaren Gedächtnis mehr parat als andere heute in ihrem Laptop.
Was wir nicht wussten und uns damals vielleicht auch nicht gekümmert hätte: Mayer, der hier so souverän im Plural von sich sprach, war allein und war es auf eine viel profundere Weise, als wir uns das wohl hätten vorstellen können. Fünf Jahre hat Hans Mayer, wie er mir einmal schrieb, an seinem Buch über "Außenseiter" gearbeitet, einem Meisterstück mayerscher Brillanz, immer überraschend im gewaltigen Fundus des Wissens und klar, geschliffen in seiner Sprache. Es ist wohl sein persönlichstes Buch geworden, auch wenn es sich nach außen als Kulturgeschichte gibt und so lesen lässt. Die "Außenseiter": Das sind für Mayer die Juden und Homosexuellen - er war beides -, und es sind für ihn auch die Frauen in einer Männergesellschaft, mit denen er sich freundschaftsfähig solidarisch empfand, denn er war kein Frauenfeind und konnte ein charmanter Gesellschafter sein. Aber sein Außenseitertum war noch breiter angelegt. Mayer kam aus einem wohlhabenden Elternhaus, nur dass der Vater als überzeugter Sozialdemokrat aus dem Ersten Weltkrieg zurückkehrte. Das wiederum ebnete dem Sohn den Zugang zum Marxismus und zur Arbeiterbewegung, für die er in der Tat tätig wurde. Für die bürgerliche Welt, der er als angehender Jurist zustrebte, stellten indes gerade solche Sympathien einen weiteren Schritt ins Außenseitertum dar. Das letzte Kriterium dafür aber war doch wohl Mayers scharfe, glänzende, außerordentliche Intelligenz, denn nichts isoliert so sehr wie sie und wird immer wieder und zu allen Zeiten neben der Bewunderung das stille oder laute Misstrauen der anderen provozieren.
Wirklich ein Außenseiter wird man allerdings erst, wenn man keiner sein möchte. "Ein Deutscher auf Widerruf" lautet der Titel der zwei Bände von Mayers Lebenserinnerungen. Aber er war zugleich auch ein Deutscher im Widerspruch - mit sich selbst wie mit der Gesellschaft, die ihn feindlich oder freundlich umgab. Denn eigentlich wollte er ja dazugehören, wo er sich von Gleichgesinnten umgeben sah, hatte Lust an der Geselligkeit und schloss sich dann doch wieder durch die unhemmbare Demonstration seiner Überlegenheit, durch geradezu monumentale, atemberaubende Akte der Eitelkeit oder, wie er selbst zugestand, durch gelegentliche Wutausbrüche davon aus. Er konnte - man muss es erlebt haben! - eine fremde Universitätsbibliothek mit seinen Gastgebern betreten, unverzüglich auf den Katalog zusteuern und ohne jede vornehme Zurückhaltung strengstens prüfen, ob denn auch wirklich alle seine Werke vorhanden waren. Und wehe, wenn da auch nur eines fehlte. Andere indes tun das auch, nur verhohlener; aber ebendies, dass er seine Schwächen so offen und schutzlos zutage trug, machte ihn auch wieder liebenswert und schließlich zum freundlichsten Gast der Welt, der - was von manchen bestritten wird, was ich aber gern bestätige - durchaus still zuhören konnte.
Seit kurzem gibt es nun noch ein weiteres, wenngleich nicht mehr autorisiertes Buch von Hans Mayer, der 2001 starb. Es ist ein Buch, das seine ganze innere Spannung zwischen Außenseitertum und Dazugehörenwollen zugleich als ein Stück deutscher Geschichte darbietet: eine Edition seiner Briefe aus der Zeit der Leipziger Professur. 1948 war er dorthin berufen worden; am 17. August 1963, zwei Jahre nach der Errichtung der Berliner Mauer, erklärte er von Hamburg aus seinen Entschluss, nicht mehr in die DDR zurückzukehren. Das Buch lässt sich auf verschiedene Weise lesen: als Material zur äußeren Biographie, als eine Dokumentation der Sehnsucht nach der Überwindung seines Außenseitertums, aber auch als eine Dokumentation der ganzen geistigen Hoffnungslosigkeit des Arbeiter-und-Bauern-Staats. Es ist ein Buch über verlorene Illusionen und über den Triumph politischer Dummheit und Engstirnigkeit über einen bedeutenden deutschen Intellektuellen.
Man wird in diesen Briefen nicht in erster Linie nach Erkenntnissen über Literatur, Geschichte und Politik suchen dürfen oder gar Intimitäten über das Privatleben ihres Verfassers erwarten. Davon enthalten sie überraschend wenig. Eher sind sie Dokumente einer großen Einsamkeit, die sich - eine andere Art von Eitelkeit - darin äußert, dass er, wie einst uns als Studenten, allen möglichen Leuten mitteilt, was alles er gerade tut, wohin er reist, wer ihn eingeladen hat. Wirklich Persönliches, also Gefühle und Geschmacksurteile, findet sich lediglich in Briefen an den jungen Juristen Walter Wilhelm. Und das klingt dann so: Oben - es ist die Tschaikowskistraße in Leipzig, Mayers Wohnung während seiner gesamten Zeit dort - übt jemand "die ,Kinderszenen'. Seltsam, wenn man sie so gestümpert hört, kann man plötzlich Hans von Bülows böses Wort über Schumanns ,Intervallenheulerei' verstehen! Früher war ich in allen Schumanndingen unersättlich; längst nicht mehr . . ." Die Laufbahn als Konzertpianist hatte er selbst einst ins Auge gefasst, aber die Finger waren zu kurz. Und am Schluss erst folgt dann werbend ("So, nun bist Du wieder an der Reihe") und scheu, Gemeinsamkeit suchend, die Bitte um "einen vernünftigen & herzlichen Brief: weder Stilübung, noch ungedrucktes Feuilleton". Gespreiztheit hat ihm nie gelegen.
Mayer kam nach Leipzig mit Enthusiasmus und dem besten Willen dazuzugehören, aber auch in dem Gefühl, dass er dort zu Hause sei, wo neben Marx und Engels auch Goethe und Schiller als Klassiker galten. Das stellte sich rasch als Täuschung heraus; zunächst, als man ihn im Lande hin und her schieben wollte: "Es besteht ein Missverhältnis zwischen dem, was ich im Rahmen meiner Kräfte zu leisten suche und doch wohl auch leiste - und der Behandlung, die mir die amtlichen Stellen zuteil werden lassen." So bereits 1950 an Bildungsminister Paul Wandel.
Bald danach ging es an die Substanz, so bei der Frage, ob eine "mehr oder weniger subalterne Kommission" durchsetzen könne, das lyrische Werk Georg Kaisers oder Gottfried Benns der deutschen Öffentlichkeit vorzuenthalten. In Benns Sog, so schreibt er im September 1961, also nach dem Mauerbau, an Friedrich Wilhelm Oelze, sei er erst spät geraten, aber dann immer mehr. Und darauf folgen die hellsichtigen Sätze: "Das ist romantische Nachfolge, was immer Benn denken mochte. Der Geigenton Storms übertragen auf das Cello, gelegentlich gestört, oder eigentlich auch kontrapunktisch bereichert, durch Jazz-Einlagen." Das Werk Benns war, was heute leicht vergessen wird, bis in die achtziger Jahre in der DDR tabu, also unerreichbar und unerwünscht.
Mayer hatte bei alledem viele Privilegien. Er durfte in den "Westen" reisen, von dort Bücher mitbringen oder sie sich schicken lassen. Nicht nur für sich hat Mayer die Grenze weitgehend zu ignorieren versucht, sondern auch zum Vorteil seiner Studenten. Das zeigen in diesen Briefen die Einladungen an die damaligen Größen westdeutscher Germanistik, an Wilhelm Emrich, Friedrich Beißner, Erich Trunz und Fritz Martini, und ebenso die an Herman Meyer in Amsterdam und Eudo Mason in Edinburgh. Es waren eben nicht nur kaschierte Selbsteinladungen, es war auch ein Beispiel privater Deutschland-Politik, wobei - das sei ausdrücklich hinzugefügt - Mayer seinen westdeutschen Kollegen gegenüber keinen Zweifel daran ließ, dass ihm die Rolle einiger ehemaliger brauner Parteigenossen in Adenauers Staat durchaus nicht gefiel. Aber sie waren eben nicht füreinander geschaffen, diese DDR und dieser Professor. 1956 begann seine Überwachung durch die SED-Kulturfunktionäre, erst subtil, später in "Totschlägermanier".
Den Mimen flicht die Nachwelt keine Kränze. Auch den Literaturprofessoren nicht, obwohl sie es wahrscheinlich nicht alle einsehen möchten. Hans Mayer aber kann zufrieden sein. Das Denkmal, das ihm diese reiche, gut annotierte Briefausgabe setzt, zeigt, dass noch viel zu lernen ist von ihm über deutsche Zeitgeschichte, über den Umgang des Staates mit seinen Intellektuellen, über Außenseiter, von denen immer wieder neue kommen werden, und natürlich vor allem über "die heil'ge deutsche Kunst", wie Hans Sachs in den "Meistersängern" jene Sache nennt, der Hans Mayer sein Leben verschrieb.
GERHARD SCHULZ.
Hans Mayer: "Briefe 1948-1968". Herausgegeben und kommentiert von Mark Lehmstedt. Lehmstedt Verlag, Leipzig 2006. 630 S. geb. , 29,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Heute wäre der große Literaturwissenschaftler Hans Mayer 100 Jahre geworden: Mark Lehmstedt hat seine DDR-Zeit in Briefen rekonstruiert
Auf ihre Weise war die frühe DDR ein Kulturstaat, wenn man den Akzent auf Staat legt und das Gewaltsame daran nicht übersieht. Johannes R. Becher, der Kulturminister, war ein schillernder expressionistischer Dichter. Unter seiner Ägide wurden die wenigen, aber starken Zentren gebildet, welche die Kultur im neuen Arbeiter-und-Bauernstaat trugen: Brechts Berliner Ensemble als theatralischer Musterbetrieb; die klassizistisch gestaltete Zeitschrift Sinn und Form, die Peter Huchel unbestechlich redigierte; der Aufbau-Verlag, der sich zunächst darauf konzentrierte, Klassiker in schönen Ausgaben unters Volk zu bringen; die neue Berliner Akademie; und die Universität Leipzig mit ihren beiden unorthodoxen Koryphäen Ernst Bloch und Hans Mayer, die, jeder auf seine Weise, zu einer Generalrevision der deutschen und europäischen Überlieferung ansetzten, Bloch als Geschichtsphilosoph, Mayer als Literaturhistoriker.
All das hatte zusammengenommen einen großen Zug, wie er sich bis heute beeindruckend in der eleganten Monumentalität von Henselmanns Stalinallee in Ostberlin ausprägt. Solche Kulturgründung zeigte zwangsläufig einen fast historistischen Zug, denn neue Talente mussten in die planvoll entwickelten Baupläne erst hineinwachsen. Sie folgten bald, Franz Fühmann, Heiner Müller und Peter Hacks sind die ersten Namen, danach kamen Christa Wolf, Volker Braun und Christoph Hein und so viele andere. Geburtshelfer war Stephan Hermlin in der Abteilung Literatur der Berliner Akademie, neben Becher der erste Schriftsteller der DDR. Die Jungen hatten zumeist bei Mayer und Bloch in Leipzig studiert, und viele von ihnen arbeiteten auch bei Brecht im BE – im Kunststaat DDR verlief alles kleinräumig, konzentriert.
Eines dieser wenigen, aber enorm wirkungsvollen Kraftzentren führen Hans Mayers Briefe während seiner Zeit in der DDR von 1948 bis 1963 vor, die der Leipziger Verleger Mark Lehmstedt soeben rechtzeitig zum hundertsten Geburtstag des großen Germanisten an diesem Montag vorgelegt hat. Sie ziehen uns in den Wirbel des kraftvollen Neuanfangs. Mayer war in dieser Zeit viel mehr als ein Professor: Er war ein Faktotum, dem so etwas wie Allgegenwart gegeben war. Er schrieb nicht nur das erste große Thomas-Mann-Buch der Nachkriegszeit – Auflage 15000, sofort ausverkauft –, edierte rasch die beste Gesamtausgabe des Nobelpreisträgers, lehrte nicht nur in großen Vorlesungen zur deutschen Literatur, sondern war auch der erste Festredner, Gastdozent und Auslandsrepräsentant seines Staates.
Arbeitsbeziehungen zu Huchel und Brecht bildeten sich sofort; eine riesige, bis heute maßgebliche Anthologie zur Literaturkritik in Deutschland entstand; die großen Festtage zu Goethe und Schiller 1949 und 1955 bestritt Mayer teils im Alleingang – bei seinen Vorträgen quollen die Säle über und mussten Übertragungen ins Freie organisiert werden –, teils an der Seite des verehrten Thomas Mann. Mit Becher war er bald auf Duzfuß. Dem jungen Fühmann schrieb er bedenkenswerte Einschätzungen zu dessen ersten Werken, ebenso Heiner Müller und Hacks. Dazu kamen Vorträge in Westdeutschland, besonders enge Beziehungen nach Stuttgart zu Fritz Martini und Wuppertal. Auftritte an der Sorbonne; Germanistentag in Rom; Lehrtätigkeit in Warschau; Reise in die Sowjetunion; Pläne für China.
Mayer ist brillant – oft spricht er frei, man kann aber Broschüren aus den Mitschnitten machen – und unermüdlich. Der dicke Briefband – bloß ein Drittel des erschlossenen Materials bringt er – ist überwiegend energische Geschäftspost auf den Höhen der Kultur: „Sehr verehrter Herr Professor” (Thomas Mann), „Lieber Brecht”, „Lieber Herr Ihering”, später schon: „Lieber Herr Grass”, „Lieber Heinrich Böll”, oder auch „sehr verehrter, lieber Hermann Hesse”, dann, prekär und mutig: „Lieber Georg Lukács” – Mayer hat mit allen zu tun und verhandelt mit allen von Gleich zu Gleich.
„Briefe soll man nur schreiben, wenn eine Mitteilung zu machen ist; wenn etwas erörtert werden soll; wenn Zuneigung die Ferne zur Nähe machen möchte.” Das schreibt er mahnend dem jungen Freund Walter Wilhelm aus Frankfurter Tagen. Wilhelm aber ist der Einzige, für den der dritte Zweck, der Wunsch nach Nähe, zutrifft; sonst geht es in diesen Briefen nur um die ersten beiden Absichten. Mit Wilhelm tauscht er Geschenke an den Geburtstagen und viele herzliche Worte. Sonst aber geht es um Termine, Doktoranden – an Bloch: Bitte schreiben Sie das Zweitgutachten für Girnus – und Buchvorhaben. Mayer macht sich stark für eine Ausgabe des „Joseph” von Thomas Mann in der DDR; er wettert gegen ein misslungenes Heft von Sinn und Form bei Huchel; er enttarnt einen zum Kommunisten umgerubelten Nazi.
Am interessantesten ist seine immer wieder ausbrechende Generalkritik am geistigen Niveau der DDR. Ein langer Brief an Becher vom 30. März 1953 beklagt vor allem sprachliche Verschluderung, mangelnde Bildung, „amusische Lebenshaltung”. „Übergangserscheinungen, gewiss. Wir werden auch das überwinden. Einstweilen aber ist dieser Zustand tief bedrückend.” So offene Worte lässt sich Mayer in keinem Moment seiner fünfzehn DDR-Jahre verbieten. Das Tauwetter nach Stalins Tod nutzt er ohnehin; selbst Ulbrichts Literaturauffassung kritisiert Mayer offen.
Als dann nach dem Ungarnaufstand 1956 die Lage brenzlig wird – Wolfgang Harich und Walter Janka werden zu langen Haftstrafen verurteilt, Bloch wird zwangsemeritiert, gegen Mayer beginnt eine Pressekampagne –, da verhält sich Mayer zwar vorsichtig, aber nicht feige. Selbst für Harich, den er als Intellektuellen geringschätzt, tritt er ein. Er weigert sich, Lukács-Zitate aus seinen Schriften zu entfernen. Und in seinen Verlagskontakten zeigt er eine cholerische Überempfindlichkeit, die im Einzelfall ungerecht war, insgesamt aber einen geistigen Bezirk durch lautes Gebell verteidigte.
Mit Becher wechselt er 1957 zurück zum „Sie” und schreibt ihm – „Lieber Dr. Becher” – eine vernichtende Epistel zur neuen Unterdrückung, immerhin auch als Zeichen persönlichen Vertrauens: „Es ist also erreicht. Die Universität Leipzig braucht nunmehr weder die Schmach der Vorlesungen eines Ernst Bloch noch eines Hans Mayer zu ertragen. Gibt es ein schöneres Zeugnis dafür, dass man ernstgenommen wird?”
Ja, Mayer war eitel und wirkte wohl oft unerträglich arrogant. Einem Kollegen, der einen Artikel zu seinem fünfzigsten Geburtstag vorbereitet, rät er: „Vielleicht ist es aber nicht unangebracht darauf hinzuweisen, dass ich der erste Professor der DDR war, der einer Einladung der Sorbonne und des französischen Germanistenverbandes zu Vorlesungen gefolgt ist, wie ich auch . . .” – die Liste geht eine halbe Seite weiter. Doch hier ging ein Rastloser ganz in der Sache auf, der er den ersten Rang in seinem Leben gegeben hatte: der Literatur. Der Enthusiasmus und die Energie, die sich hier zeigen, bleiben mitreißend selbst in dieser Institutspost, und wer zu den gleichzeitigen Büchern Mayers greift, vor allem zu seiner Sammlung „Deutsche Literatur und Weltliteratur‘, der erkennt solche Kraft wieder in einem zupackenden, federnden Stil, den Mayer nie mehr übertroffen hat. Eine gute Zeit!
Aber auch eine furchtbare Zeit. Ihre Rückseite wird sichtbar in dem Material, das Lehmstedt in einem zweiten wuchtigen Band als „Der Fall Hans Mayer” gesammelt hat: die Unterlagen der Staatssicherheit und der SED-Parteistellen, vor allem in der Universität. Seit Ende 1956 wurde Mayer wie das Ehepaar Ernst und Karola Bloch zum Objekt intensiver Ausforschung, Überwachung und Maßregelung. Lehmstedt hat die Berichte der „Geheimen Informanten”, Treffberichte der Stasi-Offiziere sowie Nachschriften von Abhörwanzen, dazu Protokolle der Parteistellen zu einem schaurigen Gesamtgemälde vereint. Dabei fällt auch ein sensationeller und bizarrer geheimdiensttechnischer Befund ab: Die Wanzen bekamen Namen und Identitäten, als handele es sich um reale Personen, die den abgehörten Gesprächen beigewohnt hätten, beispielsweise als Haushaltshilfe von Frau Bloch. Es wird Sache der Diktaturforschung sein, dieses wichtige Ergebnis zu bewerten.
Für den Mayer-Leser bleibt vor allem Ekel, der Widerwille vor einer Blockwartmentalität, die deutsch-diktaturübergreifend den abweichenden Intellektuellen ins Visier nimmt. Folgende Einschätzung vom 5. März 1957 sagt eigentlich schon alles: „Prof. Mayer wird vom GI (Geheimen Informanten) als ein typisch bürgerlicher Mensch eingeschätzt, ein Egoist, der an der Universität keine Freunde hat. Mayer würde nach der Ansicht des GI ohne Zögern Menschen fallenlassen, falls sie ihm hinderlich würden. Dazu ist er mit bestimmten Minderwertigkeitskomplexen ausgestattet, die einmal davon herrühren, dass er jüdischer Abstammung ist und deshalb während des Faschismus und in der Emigration große Schwierigkeiten hatte.” Später wird Mayer eine besondere Unleidlichkeit gegen Deutsche zugeschrieben, weil seine Eltern in Auschwitz vergast worden waren.
Irgendwann bemerkt der Staatssicherheitsdienst auch, dass Mayer homosexuell ist und eine Freundschaft zu einem Spitzensportler unterhält, ja dass er sich am Leipziger Hauptbahnhof herumtreibt und sich Jugendliche mit Geld „gefügig macht”. Jedes Molekül Aufsässigkeit wird registriert, jeder Auslandskontakt vermerkt, aber am Ende bleibt die Überwachung ergebnislos: Konspiration gegen die DDR lässt sich nicht nachweisen, und abschätzige Bemerkungen über den Volkskammerpräsidenten Dieckmann sind fast das Sensationellste, was die Überwachung politisch ergibt.
Doch die Mischung aus maßregelnder Spießigkeit, latentem Antisemitismus und Schwulenekel, die die Dokumente zeigen, verdichten sich zu einer Stickluft, von der man sich fragt, wie Mayer sie überhaupt so lange aushalten konnte. So rätselhaft wie verquer rührend aber wird die verklärende Erinnerung, die Mayer in seinen späteren Erinnerungsbüchern der Leipziger Zeit gewidmet hat; offenbar war am Ende die utopische Kraft der Idee, der er zu dienen meinte, und die Begeisterung in seiner nationalpädagogischen Arbeit stärker als die niederdrückende Umgebung.
Mayer war Marxist, das ist das eine; auch als Jude mag er gehofft haben, in einem kommunistischen Staat besser aufgehoben zu sein als im Adenauer-Staat; aber vielleicht spielte auch der Umstand eine Rolle, dass die DDR keinen scharfen Homosexuellen-Paragraphen mehr hatte, im Gegensatz zur BRD, in der die verschärften Bestimmungen des Dritten Reichs erst 1969 abgeschafft wurden. So kann das Fortbestehen des Paragraphen 175 ein Faktor gewesen sein, der Mayer länger als Bloch und andere von Westdeutschland fernhielt. 1963 gab dann der berüchtigte Artikel in der Leipziger Studentenzeitung mit dem Titel „Eine Lehrmeinung zuviel” den Ausschlag, nicht mehr in die DDR zurückzugehen.
Jedenfalls zeigt Mayers gewaltige Arbeitsleistung in der DDR-Zeit, sein fast restloses Aufgehen in seinen Rollen als Hochschullehrer und Kulturfunktionär auch etwas vom privaten Verzicht des auf Diskretion verpflichteten Außenseiters in einem unerbittlichen Kollektiv. Die peinliche Einschätzung von Mayers Person, die nach seiner Übersiedlung in den Westen Herr Dr. Nollau vom Bundesverfassungsschutz 1964 abgab und die sofort im Ministerium Mielkes bei Markus Wolf landete, druckt Lehmstedt als letztes Dokument wie einen bösen Witz ab. Der westliche Verfassungsschutz übernahm wörtlich die Urteile der östlichen Staatssicherheit, sprach von Charakterlosigkeit und revisionistischen Tendenzen, ließ sich die sittlichen Verfehlungen nicht entgehen und schloss mit dem Votum: „Von der Überlassung einer Professur wird dringend abgeraten.”
Am Ende muss man sagen: Das östliche System hat Mayer vor allem als Person, als inkommensurablen Charakter von sich gewiesen, der Westen hat ihn zwar nicht glänzend untergebracht – es blieb bei einer Professur in Hannover –, ihm aber seinen Freiraum gelassen. Seine Karriere als grandioser Stilist konnte Mayer, dessen Bücher im Westen längst verbreitet waren, ohne Bruch bis zu seinem Tod 2001 fortführen.
Sein wichtigstes Buch kam 1975 bei Suhrkamp heraus und konnte in der DDR nie erscheinen. Es heißt „Außenseiter” und handelt von den Verlorenen der bürgerlichen Aufklärung, von Juden, Frauen und Homosexuellen.
Ja, Mayer war ein Bürger, das hatten die Beobachter der DDR-Volksgemeinschaft ganz richtig gesehen. Seine ästhetischen Vorlieben waren verfeinert, um nicht zu sagen dekadent, sein Geschichtsbild eher hegelianisch als marxistisch, jedenfalls gebrochen. Ein Kern seiner eigenen Erfahrung war das Außenseitertum des Juden und des Homosexuellen, das er, je älter er wurde, umso weniger verleugnete. So wurde er zum Verfasser eines der letzten linken Klassiker kurz vor dem offiziellen Ende der kommunistischen Utopie. „Außenseiter” ist eine Philosophie der Ungleichheit aus egalitären Motiven, nicht aus Nietzscheanischem Herrenmenschentum. So macht das Buch die Gegenrechnung auf zum totalitären Zeitalter mit seinem uniformierten Menschentypus.
Man kann mutmaßen, dass dieses Buch Mayers Vermächtnis bleiben wird. Man lese es vor dem Horizont unserer Kulturkämpfe. Inzwischen ist die Stellung der von Mayer benannten Außenseitergruppen das einzig valide Kriterium für kulturellen Fortschritt oder Zurückgebliebenheit: Ob eine Gesellschaft in der Moderne angekommen ist, das entscheidet sich heute an der Frage, wie sie mit dem Monstrum des Judenhasses umgeht, an der Gleichberechtigung der Frau und an der Anerkennung der Homosexualität als bürgerlicher Lebensform. Hans Mayer, der Marxist, ist ein wichtiger Zeuge des 20. Jahrhunderts; als Denker der menschlichen Diversität kann er auch im 21. Jahrhundert noch fortleben.
Der in Leipzig ansässige Herausgeber und Verleger Mark Lehmstedt hat seine Sammlungen und die großartigen, so knappen wie reichhaltigen Kommentare zum Fall Mayer ganz allein, ohne die geringste öffentliche Förderung zustande gebracht – man sieht, was ein Einzelner leisten kann, wenn er sich auf Besseres konzentriert als den Papierkrieg um Exzellenzinitiativen. Diese Bände wirken in ihrer noblen, klassizistisch anmutenden Gestalt wie ein Tribut an den Traum vom Kulturstaat, zu dem die DDR dann doch nicht geworden ist. Der Suhrkamp Verlag zeigte kein Interesse an Lehmstedts Vorhaben, sogar einfache Anfragen blieben ohne Antwort.GUSTAV SEIBT
HANS MAYER: Briefe 1948-1963. Herausgegeben und kommentiert von Mark Lehmstedt. Lehmstedt Verlag, Leipzig 2006. 630 Seiten, 29,90 Euro.
DER FALL HANS MAYER. Dokumente 1956-1963. Herausgegeben und kommentiert von Mark Lehmstedt. Lehmstedt Verlag, Leipzig 2007. 525 S., 29,90 Euro.
HANS MAYER: Außenseiter. Mit einem Nachwort von Doron Rabinovici. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2007. 523 Seiten, 15 Euro.
Interessant ist seine Generalkritik am geistigen Niveau der DDR
Die Wanzen bekamen Namen, als handele es sich um reale Personen
„Außenseiter” ist der letzte linke Klassiker im Zeitalter der Utopien
Hans Mayer im Jahr 1999 Foto: Isabel Mahns-Techau
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Eine Dienstleistung der DIZ München GmbH
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Der jetzt veröffentlichte Briefband von Hans Mayer bietet im Grunde nichts, was nicht schon aus seinen Erinnerungen bekannt ist, und er lässt auch keinen Blick in das Privatleben des Literaturwissenschaftlers zu, stellt Heinz Schlaffer enttäuscht fest. Die Briefe, die er mit so bekannten Autoren wie Bertolt Brecht oder Max Frisch tauschte, sind fast ausschließlich Geschäftskorrespondenz, in der es um Terminabsprachen oder die Organisation von Vorträgen und Ähnlichem ging. Zwar könne man viel über die spezifischen Bedingungen der Literaturwissenschaft und Kritik in der DDR lesen und Mayers Auseinandersetzung damit, konzediert der Rezensent, den es aber dennoch wundert, dass Mayer so gar nichts über sein Innenleben preisgibt. Selbst die Korrespondenz mit dem engen Freund Walter Wilhelm bleibt vergleichsweise zurückhaltend. Dafür hat Mayer aber keine Gelegenheit ausgelassen, in seinen Briefen auf seine beruflichen Erfolge hinzuweisen, ein "Geltungsbedürfnis", das der Rezensent allerdings als Überlebensstrategie eines Querdenkers in der DDR verteidigt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH