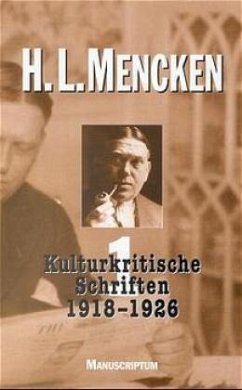In den drei hier versammelten Texten rückt Mencken - getreu seiner Devise "Isolieren und übertreiben" - den Übelständen seiner Zeit und seines Landes temperamentvoll zu Leibe. Er zerreist die Schleier öffentlicher Vernebelungen, legt hinter hehren Glaubensbekenntnissen Kleingeisterei und Unmoral bloß, entlarvt die Demokratie als faulen Zauber, mit dem der Massenmensch seinen begabteren Nachbarn übertölpelt, und beklagt mit dem ironischen Lob der Frau zwischen den Zeilen den Mangel an hervorragenden Männern (die für ihn allein im Besitz der wahren Kerntugenden sind).
Die Lektüre ist amüsant, wegen der tückischen Doppelbödigkeit, der Verflechtung von Ernst und Sarkasmus, von flüchtiger Impression und profunder Refelsion, aber auch anspruchsoll. Für Mencken war eine gute Formulierung mehr wert als eine große Wahrheit.
Die Lektüre ist amüsant, wegen der tückischen Doppelbödigkeit, der Verflechtung von Ernst und Sarkasmus, von flüchtiger Impression und profunder Refelsion, aber auch anspruchsoll. Für Mencken war eine gute Formulierung mehr wert als eine große Wahrheit.

Witzig, böse und bisweilen blind: Der amerikanische Journalist H.L. Mencken in einer dreibändigen Werkausgabe
„Wenn ich in zwei oder drei Jahren noch am Leben bin”, kündigt Henry Louis Mencken am 6. September 1931 in seinem Tagebuch an, „werde ich ‚Homo Sapiens‘ in Angriff nehmen, eine große Abhandlung über das Menschengeschlecht, in der ich meine gesammelten Ideen zu diesem Thema darlege. ” Welcher Berufsgruppe gehört der Mann wohl an? Ist er ein Philosoph? Ein Anthropologe? Ein Theologe?
Nein, H.L. Mencken, der Deuter des Homo Sapiens, der Kritiker der Demokratie, der „Verteidiger der Frau”, der Anwalt der amerikanischen Sprache und einflussreichste Privatmann der Vereinigten Staaten, wie man ihn auf der Höhe seines Ruhmes nannte, war der berühmteste Journalist seiner Zeit, ein ruppiger Konservativer, ein Germanophiler zur Unzeit, ein Freund des Bieres und der klassischen Musik. Er lebte im Jazz Age, aber der Jazz war nicht für ihn erfunden worden. Er wurde 1880 in Baltimore als Sohn deutscher Einwanderer geboren; die Vorfahren hatten es als Gelehrte in Sachsen zu einigem Ansehen gebracht. Aber schon als Junge wollte er Journalist werden. Mit 25 Jahren war er Chefredakteur des „Morning Herald” in Baltimore, bald darauf ging er zur „Baltimore Sun”, wo er sein Leben lang blieb.
Hass auf New York
Bald gingen seine Ambitionen über den Tagesjournalismus hinaus. 1908 veröffentlichte er „The Philosophy of Friedrich Nietzsche”, das erste amerikanische Buch über Nietzsche überhaupt. Es drängte Mencken nun zu den „smart magazines”, die, wie der „New Yorker”, im vor allem in Manhattan entstanden. Nach Jahren beim „Smart Set” gründete Mencken 1924 mit George Jean Nathan den „American Mercury”, der ein „Journal of Ideas” werden sollte, groß und breit genug für die Ansprüche eines Mannes, der darin seine Ideen über den Homo Sapiens ausbreiten wollte. Dies alles geschah von Baltimore aus, denn Mencken hasste New York und verließ sein Elternhaus, abgesehen von einer kurzen Ehe-Episode von kaum fünf Jahren Dauer bis zu seinem Tode im Jahre 1956 nicht mehr.
Nicht Artikel, Bücher waren das Ziel der immensen Produktivität, die Mencken entfachte. Aus Artikeln wurden Sammelbände, aus gesammelten Ideen Abhandlungen, aus gesammelten Werken wiederum „Reader”, denn Mencken hatte früh erkannt, dass der amerikanische Leser seine Nahrung gern als „Digest” zu sich nimmt. Früh begann Mencken, seinen Nachlass zu ordnen, erläuternde Nachschriften zu seinen Publikationen zu liefern, Werke neu und neu zusammenzustellen, und nebenbei führte er von 1930-1948 ein Tagebuch, das wohl von Anfang an als Quellenwerk für künftige Mencken-Biographen gedacht war. Es erschien erst 1989 in gekürzter Fassung in den USA und brachte Mencken unversehens zurück ins Rampenlicht. War Mencken ein Faschist gewesen? Ein Rassist, ein Antisemit? Oder war er nur ein knorriger Reaktionär und Freund der deutlichen Aussprache gewesen?
Nun gibt es eine dreibändige deutsche Ausgabe von Menckens Schriften, die dem Leser alle Vorzüge und auch ein paar Schwächen dieses Autors vor Augen führt. Was fehlt, ist Menckens berühmtestes Buch, „The American Language” ( 1919); hier liefert die Ausgabe lediglich einen kurzen Auszug aus der deutschen Übersetzung von 1927. Das Original ist ein großes, witziges und ungemein gebildetes Plädoyer für „the american vernacular”, für den Reichtum und die Erneuerungskraft des amerikanischen Englisch, es feiert die Assimilationsbereitschaft der amerikanischen Sprache. Weil sie sich vom Englischen gelöst hat, sind, so Mencken, auch die amerikanische Literatur und der amerikanische Journalismus den großen, steifen Brüdern von der Insel überlegen.
Der erste Band der deutschen Ausgabe enthält „Kulturkritische Schriften”, darunter „Zur Verteidigung der Frau” von 1918, ein Buch voll zeittypischer Spitzen und Sottisen zum unmöglichen Verhältnis der Geschlechter. Man wird diesem Buch nicht gerecht, wenn man es frauenfeindlich nennt, ohne darauf hinzuweisen, dass es im selben Maße männerfeindlich ist. Im Manne verachtet Mencken den „Boobus Americanus”, den durchschnittlichen, provinziellen, bibelfesten amerikanischen Biedermann, im Weibe das Geschöpf, das über seinen Suffragetten-Idealen den Dienst am amerikanischen Mittagstisch vernachlässigt. Allzu viele Frauen hätten sich „von der produktiven Arbeit emanzipiert, ohne sich dafür Ersatz auf geistigem, künstlerischem oder sozialem Gebiet zu schaffen” und er fährt fort: „Unter diesen Frauen findet man jene kurzlebige Begeisterung für den Bergsonismus, die Montessori-Methode, den Dämmerschlaf und ähnliche Überspanntheiten, die so bezeichnend für den derzeitigen beklagenswerten Zustand der amerikanischen Kultur sind.” Das hört sich an wie Woody Allen, der wie Mencken für eine gute Formulierung zu fast jeder Straftat bereit wäre.
Hitler und der Dschihad
Sind aber gute Formulierungen oder, allgemein gesprochen, ist ein zupackender und brillanter Stil, Grund genug, einen Traktat wie „Zur Verteidigung der Frau” der Vergessenheit zu entreißen? Alles, was Mencken schrieb (und selbst, wenn es den Homo Sapiens betraf), war auf den Tag gerichtet, denn er war ein Journalist. Aber Menckens Tage sind vorbei und mit ihm die Tage eines meinungsstarken, generalistischen Journalismus. Deshalb werden wir seine Frauen-Abhandlung schneller wieder vergessen als die kleinen autobiographischen Stücke, die er Mitte der dreißiger Jahre im „New Yorker” veröffentlichte, wunderbare Kindheitsszenen aus dem deutschen Dorf, das Baltimore einmal war. Und wir lesen den Reisebericht „Deutschland 1938” mit mehr Gewinn als seinen „Demokratenspiegel”, für den ihm sogar Kaiser Wilhelm II. aus dem holländischen Exil anerkennende Worte übermittelte.
Mencken und Deutschland, das ist eine komplizierte Geschichte. Zum Teil war es die Herkunft, die Mencken dazu brachte, Deutschland zu verteidigen, wo es nicht mehr zu verteidigen war. Hinzu kam sein Drang, als Lehrer der amerikanischen Nation, der Kritiker ihrer Demokratie und Hüter ihrer Verfassung aufzutreten, der sich bei ihm regelmäßig mit dem Einspruch gegen Amerikas öffentliche Meinung (die zu seinen Lebzeiten anti-deutsch war) verband. Was Mencken von seiner Deutschlandreise 1938 mitbringt, ist außer Erinnerungen an deutsches Bier und an die Landschaften seiner Vorfahren viel Verständnis für den „Dschihad”, so sein Ausdruck, den Hitler gegen die Juden zu predigen begonnen hat. Man weiß nicht genau, ob es wirklich Menckens Verständnis für Hitler ist oder nur seine Wiedergabe verständnisvoller Mitteilungen seitens deutscher Bekannter. Jedenfalls resümiert sein Bericht einen Status Quo, den andere alarmierend finden mögen, nicht aber Mencken. Hitler, so meint er oder lässt er andere meinen, hat den Deutschen zu neuem Selbstbewusstsein verholfen. Bald wird es einen Krieg geben, in dem die Deutschen sich an Polen und Juden für deren Provokationen revanchieren werden. Mehr fällt Mencken zu diesem Thema nicht mehr ein. Er ist bald 58 Jahre alt und wird Deutschland, so sagt er sich, nicht wiedersehen.
Timothy McVeigh, der Bomber von Oklahoma City, konnte Mencken angeblich auswendig zitieren. Mencken hätte nicht viel für Terroristen übrig gehabt, aber vielleicht verband ihn mit dem rechtsradikalen Außenseiter doch dies: die Verachtung für den „middle America”, für die ahnungslose, angepasste Anständigkeit des weißen amerikanischen Provinzlers, wie er ihn sah. Kann man zugleich ein guter Demokrat sein und „ein subversiver, äußerst vehementer und schonungsloser Satiriker”, kann man als Humanist zugleich der „schärfste Kritiker amerikanischen Flachsinns und Wahns” sein, „der jemals gelebt hat?” Nicht sich selbst hat Mencken dieses äußerste Lob zugedacht, sondern seinem großen Vorbild, Mark Twain, aber er hätte wohl nichts dagegen gehabt, wenn wir ihm heute Ähnliches nachriefen.
CHRISTOPH BARTMANN
H.L. MENCKEN: Ausgewählte Werke. Herausgegeben von Helmut Winter. Band 1: Kulturkritische Schriften 1918- 1926. Band 2: Autobiographische Schriften 1930-1948, Band 3: Kommentare und Kolumnen 1909-1935. Aus dem Amerikanischen von Bernd Rullkötter, Joachim Kalka, Werner Schmitz u.a. Manuscriptum Verlag, Waltrop und Leipzig 1999- 2002. 424, 544 und 316 Seiten, jeweils 25 Euro.
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.diz-muenchen.de

Ein zweifelhafter Galan: Der amerikanische Journalist und Kritiker H. L. Mencken in einer neuen Ausgabe · Von Ernst Osterkamp
Im Dezember 1934 hielt in Washington bei einem festlichen Dinner vor fünfhundert Gästen Henry Louis Mencken (1880 bis 1956), der Starjournalist und berühmteste amerikanische Literaturkritiker der zwanziger Jahre, die Tischrede; ihren Kern bildete eine humorvolle Kritik an Franklin D. Roosevelts Politik des New Deal. Der Präsident antwortete zunächst mit einem verbindlichen Dank an seinen "alten Freund" Mencken und trug dann seiner erstarrenden Zuhörerschaft eine bittere Schmährede auf den Journalismus und die Zeitungsleute vor - um schließlich süffisant mitzuteilen, dies sei nur ein Auszug aus Menckens 1924 erschienenem Aufsatz "Journalism in America" gewesen.
Mencken hat diese Ohrfeige nie verziehen, denn er wußte, welch hoher Symbolwert ihr innewohnte: Seine große Zeit war mit dem Amtsantritt Roosevelts zu Ende. Als dieser 1945 starb, notierte Mencken im Tagebuch: "Er war der erste amerikanische Präsident, der bis zu den Abgründen ordinärer Dummheit vordrang. Zu keinem Zeitpunkt hat er den Fehler gemacht, die Intelligenz des amerikanischen Pöbels zu überschätzen. Er war sein unvergleichlicher Lehrmeister." Die Geschichte seiner öffentlichen Demütigung durch Roosevelt dagegen fehlt im Tagebuch; dort kann man lediglich lesen, der Präsident habe sich vor dem Bankett "ausgesprochen herzlich" mit ihm unterhalten. Was er verschwieg, kann man nun dem Kommentar zur soeben erschienenen Übersetzung seiner Tagebücher entnehmen.
Die Veröffentlichung von Menckens "Gesammelten Vorurteilen" im Insel-Verlag (F.A.Z. vom 17. Oktober 2000) ließ den Wunsch nach einer größeren Mencken-Werkausgabe in deutscher Sprache aufkommen. Der kleine Manuscriptum-Verlag hat das Wagnis einer auf immerhin drei stattliche Bände angelegten Ausgabe ausgewählter Werke Menckens auf sich genommen; sie wird mit Umsicht von Helmut Winter betreut. Nun liegt der zweite Band vor; er enthält in Deutschland unveröffentlichte autobiographische Schriften Menckens, während Winter im Falle der im ersten Band versammelten kulturkritischen Schriften auf schon vorliegende deutsche Übersetzungen zurückgreifen konnte. Dies ist historisch aufschlußreich: Der aus deutsch-amerikanischer Familie stammende Nietzsche-Verehrer aus Baltimore, der die Welt in "höhere Menschen" ("superior men") und Mob einteilte, hatte für die Idee der Demokratie nur Spott übrig, und für das Werk eines amerikanischen Demokratieverächters gab es im Deutschland der Weimarer Republik offensichtlich ein dankbares Publikum.
Menckens erstaunliches Buch "Zur Verteidigung der Frau" (1918 / 1922), in dem der Kulturkritiker das uneingeschränkte Lob der Frau zur Aburteilung der von ihm verachteten amerikanischen Bourgeoisie nutzte, erschien 1923 im deutschnationalen Verlag Georg Müller in der Übersetzung von Franz Blei, dem Freund und Verehrer Carl Schmitts und Rudolf Borchardts. Eine Übersetzung von Menckens großer Einleitung zu "The American Credo" (1920), der Attacke des Nonkonformisten auf das "Denken des ,homo americanus'" ("es gibt seit der preußischen Armee in der ganzen Welt keine derart gedrillten Menschen wie die Amerikaner"), wurde schon 1922 von dem nationalkonservativen Organ "Die Grenzboten" veröffentlicht. Und Menckens 1926 unter dem Titel "Notes on Democracy" erschienene Generalabrechnung mit der Demokratie brachte 1930 Ernst Niekischs Widerstands-Verlag (in der Übersetzung übrigens von Walter Benjamins Frau Dora Kellner) heraus.
Es waren in Deutschland also die "konservativen Revolutionäre", bei denen die im ersten Band versammelten Schriften Menckens aufmerksame Leser fanden, und diese scheuten keineswegs davor zurück, den spielerisch-spöttischen Nonkonformismus von Menckens Dekonstruktion der gedanklichen Grundlagen der Demokratie in bitteren politischen Ernst zu verwandeln. Man dürfte in diesen Kreisen übersehen haben, daß die Schreibenergien dieses "literarischen Rüpels", der zwar das Deutschland seiner Vorfahren idealisierte, aber ganz in den Traditionen der amerikanischen Demokratie aufgewachsen war, aus einem profunden Freiheitsverlangen stammten: "Meine literarische ebenso wie meine politische Theorie beruht auf einer einzigen Idee, nämlich der Idee der Freiheit." Ein besseres politisches System als die Demokratie hat denn auch Mencken, der sich als Kulturkritiker ohnehin "nicht mit Therapeutik, sondern mit Pathologie" befaßte, nicht gekannt.
Helmut Winter betont zu Recht, daß in Menckens Werk der Kernbestand der amerikanischen Ideale - "Freiheit, Klugheit oder Tapferkeit" - unangetastet bleibt. Dies sicherte ihm über sämtliche politischen Grenzen hinweg Freundschaft und Verehrung zahlreicher Schriftsteller, Wissenschaftler und Politiker, die das unbestechliche Urteil des polternden "Weisen von Baltimore" zu schätzen wußten.
Von der Vielfalt der gesellschaftlichen, literarischen und politischen Verbindungen Menckens legt sein von 1930 bis 1948 geführtes Tagebuch Zeugnis ab. Man erfährt nicht viel über die Bücher der Autoren des "jazz age" in diesen Aufzeichnungen, dafür aber um so mehr über ihren brennenden Durst: Sinclair Lewis "lechzt nach Whiskey, und wenn die Gelegenheit günstig ist, trinkt er ihn pur, ein Glas nach dem anderen." "Dashiell Hammett . . . traf betrunken ein und wurde etwas lästig." "William Faulkner . . . ist endlich abgereist und hat eine mächtige Alkoholfahne hinterlassen". F. Scott Fitzgerald "trinkt hemmungslos und ist zu einem öffentlichen Ärgernis geworden." Dennoch bieten Menckens Tagebücher in ihrem spröde resümierenden Duktus eine trockene Lektüre. Eine Vielzahl der erwähnten Namen und Ereignisse dürfte nur noch für Amerikanisten von Interesse sein, die ohnehin den Originaltext lesen werden.
Man hätte sich also eine strengere Auswahl aus den in der deutschen Ausgabe immerhin vierhundert Seiten umfassenden Tagebuchaufzeichnungen gewünscht. Dies hätte Raum geschaffen für weitere Auszüge aus Menckens autobiographischen Schriften, denn die wenigen in dem Band abgedruckten Proben - nostalgische Rückblicke auf das Baltimore der Jahrhundertwende - stellen dem Autobiographen Mencken ein glänzendes Zeugnis aus.
Nur mit Beklommenheit allerdings liest man Menckens kurzen Reisebericht "Deutschland 1938", der den zweiten Band der Werkausgabe abschließt und erstmals auf deutsch erscheint. Mencken, dessen Liebe zu Deutschland unerschütterlich war, hat auf seiner letzten Deutschlandreise systematisch die Stätten seiner Ahnen besucht und dabei seine Augen fest vor dem Terror der Nazis verschlossen. Diese Aufzeichnungen sind ein Dokument der Verblendung. Auf antijüdische Ausschreitungen in Berlin, bei denen Schaufenster zertrümmert und andere mit den Namen der jüdischen Geschäftsinhaber beschmiert wurden, reagierte Mencken mit dem rechtfertigenden Hinweis auf die Rassengesetzgebung der Nazis: "Laut Gesetz mußte jeder Jude seinen wirklichen Namen nennen, aber diese Vorschrift war umgangen worden. Ich fand es aufschlußreich, daß der wirkliche Eigentümer von Mademoiselle Félicies Hutgeschäft Jakob Goldfarb war und daß die Parfümerie Bon Marché im Obergeschoß den Gebrüdern Margolis gehörte." Mencken teilte die Menschheit gern in Elite und Mob ein; im Berlin des Jahres 1938 war seine Perspektive von der des Mobs ununterscheidbar geworden.
Henry Louis Mencken: "Ausgewählte Werke". Band I: "Kulturkritische Schriften. 1918 bis 1926." Band II: "Autobiographisches. 1930 bis 1948." Hrsg. von Helmut Winter. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Bernd Rullkötter. Manuscriptum Verlag, Waltrop und Leipzig 2000. 421 und 541 S., geb., 48,- und 54,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Christoph Bartmann offenbart sich als ambivalenter Fan von H. L. Mencken, dem "einflussreichsten Privatmann der Vereinigten Staaten, wie man ihn auf der Höhe seines Ruhmes nannte". Die Schriften des bekannten und umstrittenen Journalisten, von ihm selber zu Lebzeiten schon auf Buchausgaben hin angelegt, sind hier bis auf das Buch "The American Language" komplett versammelt, wobei Bartmann die zwar brillanten, aber der damaligen Zeit verpflichteten journalistischen Stücke eher kalt ließen, während insbesondere die autobiografischen Texte des zweiten Bandes seine Begeisterung hervorriefen. Und was ist mit Menckens Ansichten, die seinen fragwürdigen Ruhm als Frauenfeind, Rassist und Antisemit begründeten? Frauenfeindlich, schreibt Bartmann, sei er ohne Zweifel gewesen, aber eben auch männerfeindlich, vor allem was den amerikanischen Durchschnittsmann angeht. Und Menckens Sympathie für Hitler sei nicht wegzudiskutieren, doch solle man doch das Augenmerk lieber auf die Vorzüge seiner Schriften lenken: Scharfsinn und schonungslose Subversivität. Wie sein Vorbild Mark Twain, findet der Rezensent.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH