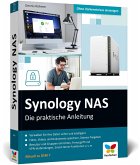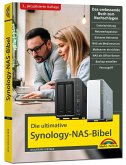Das Internet ist kein Speichermedium, es ist ein Verteilungsmedium. Deshalb ist nichts im Internet so beständig wie der Wandel - und das ist von Beginn an so gewesen. Schon in den sechziger Jahren wird die Vernetzung von Computern zugleich als Einkaufsmöglichkeit, als Austausch von Forschungen und als Sicherstellen durch verteilte Kommunikation nach einem Bombenangriff entworfen.Damit wird der Fokus bei diesem Medium immer wieder auf Schnelligkeit und Dynamik und nicht auf seine Beständigkeit gelegt.
Von diesen frühen Planungen der ersten Netzwerke bis hin zum heutigen Internetprotokoll verfolgt das vorliegende Buch die Entstehung und den Wandel dieser Technologie und stellt die wichtigsten Projekte, Visionäre und Ingenieure der Geschichte des Internet vor. Dabei zeigt sich auch: Die Entstehung dieser Kulturtechnik hat keineswegs nur in Amerika stattgefunden. Die Geschichte des Internets entspringt nicht einem Ort, sie folgt vielmehr seiner eigenen Architektur und ereignet sich selbst in Form eines verteilten Netzwerkes. Im Erzählen seiner Geschichte gilt es deshalb auch, einen Paradigmenwechsel zu vollziehen. Weil der Fokus dieses neuen Mediums auf dem Verteilen und nicht auf dem Speichern liegt, ist die Geschichte des Internet im besonderen Maße auch eine Herausforderung für das Denken einer zeitgenössischen Medientheorie.
Von diesen frühen Planungen der ersten Netzwerke bis hin zum heutigen Internetprotokoll verfolgt das vorliegende Buch die Entstehung und den Wandel dieser Technologie und stellt die wichtigsten Projekte, Visionäre und Ingenieure der Geschichte des Internet vor. Dabei zeigt sich auch: Die Entstehung dieser Kulturtechnik hat keineswegs nur in Amerika stattgefunden. Die Geschichte des Internets entspringt nicht einem Ort, sie folgt vielmehr seiner eigenen Architektur und ereignet sich selbst in Form eines verteilten Netzwerkes. Im Erzählen seiner Geschichte gilt es deshalb auch, einen Paradigmenwechsel zu vollziehen. Weil der Fokus dieses neuen Mediums auf dem Verteilen und nicht auf dem Speichern liegt, ist die Geschichte des Internet im besonderen Maße auch eine Herausforderung für das Denken einer zeitgenössischen Medientheorie.

Hätte das Netz in der Postmoderne entstehen können? Mercedes Bunz über die Irrwege der Geschichte des Internets
Dies ist ein wunderbares Buch. Dies ist ein furchtbares Buch. Man sollte es also lesen. Mercedes Bunz hat sich über die „Geschichte des Internet” gebeugt, ganz tief Luft geholt – und ein Bändchen vorgelegt von gerade einmal 147 großzügig bedruckten Seiten. Das ist kühn angesichts dieses letzten, größten, technischsten Weltwunders der Menschheit. Man muss aber nicht dem Beruf eines Systemadministrators nachgehen, um da auch ein bisschen gekränkt sein zu dürfen. Und doch: 147 Seiten reichen. Mehr muss man nicht wissen. Eher sogar noch weniger.
Denn Mercedes Bunz, Chefredakteurin von Tagesspiegel Online, reicht es nicht, ihr Stück Technik-Geschichte als Abfolge der Entscheidungen und Ereignisse zu erzählen. Das tut sie zwar auch, und sie tut es in dankenswert klarer Weise. Aber sie rasselt dabei mit dem Theorie-Besteck einer plänkelnden Postmoderne, um ihre Internetgeschichte als „mediale Umgewichtung vom Speichern zum Verteilen” zu erforschen. Theorienutzung ist prinzipiell zu begrüßen. Denn das Internet ist nicht erschöpfend erörtert, wenn man es nur als transkontinentalen Verhau vom Computern begreift. „Irgendwann”, schreibt Dirk Baecker im Vorwort zu Bunzes Band, „muss der Blick, der sich von der Technik des Internets faszinieren lässt, sich von dieser Technik lösen und ins im wahrsten Sinne Unbestimmte schweifen, um nach Formen Ausschau zu halten, mit denen man es erst zu tun hat, seit es Kommunikationen gibt, die mit dem Medium Internet rechnen.” Klug gedacht und holprig gesprochen. Es heißt: Das Internet selber erschafft Kommunikation, es ermöglicht sie nicht nur. Es erschafft eigene Möglichkeiten für Kooperation, Koordination und Kontrolle, neue Hyper-Texte, neue Verkehrsformen der Massenkultur.
Um aber die medialen Koordinaten dieser neuartigen Formen historisch zu verorten, ist es nicht nur überflüssig, über die glühenden Kohlen des Poststrukturalismus zu laufen und dabei „Tschaka Tschaka!” zu rufen. Es ist der Sache im Grunde sogar abträglich. Denn die Genese des Netzes kann kaum begriffen werden mit modischer Metatheorie und schicken Metaphern. Auch das Netz ist ein Kind seiner Zeit und also auch des Denkens seiner Zeit. Und eine medienanalytische Erforschung seiner Entstehung hätte aufrichtigerweise auch die Kategorien jenes Sinns historisieren müssen, dem sich dieses Medium verdankt. Sie hätte also versuchen müssen, die Realität eines Denkens nachzuzeichnen, welches das Internet gebar. Man hätte also statt des schwadronierenden Foucault – „weil die Wörter systematisch die Gegenstände bilden, von denen sie sprechen” – den Foucault der historisierenden Analyse benötigt.
Wenn also Mercedes Bunz ihr erstes Buchkapitel mit „Das Neue am neuen Medium” überschreibt, dann kann sich dieses „Neue” nicht in der Präsentation seiner Effekte erschöpfen, die Bunz als Entwicklung der distributed networks von Napster zu BitTorrent nachzeichnet. Als wirklich „neu” müsste ein Denken dargelegt werden, das sich auf das Abenteuer eingelassen hat, menschliche Kommunikation von Maschinen zu Abfolgen von Nullen und Einsen zerstäuben zu lassen, um sie dann nur von Maschinen kontrolliert auf letztlich willkürlichen Wegen von jedem beliebigen Punkt A zu jedem beliebigen Punkt B transportieren zu lassen. „Distributed Networks” bedeuten Kommunikation in Hochauflösung. Man muss sie nicht verstehen und, offenbar, man will sie auch gar nicht mehr verstehen, wie man ja auch die Abläufe im menschlichen Hirn damals gar nicht mehr vollständig verstehen wollte und es in den vorherrschenden Theorien als eine „Black Box” abtat, deren innere Vorgänge vernachlässigbar, deren Effekte aber samt und sonders kalkulierbar schienen.
Ein Hirn, das Schäden ausgleicht
Wenn dem Büchlein also ein Vorwurf zu machen ist, dann gewiss nicht der, dass seine Autorin nicht begriffen hätte, worüber sie schreibt, sondern der, dass sie dem vermeintlichen Glamour eines aktuellen Theoriedesigns verfallen ist, das das Oberseminar am besten nicht verlassen hätte. Dass sie französelnde Klopfer bemüht, um theoretisch eben nicht auf dem Teppich zu bleiben. Viel spannender als der brave Aufguss von Foucaultdeleuzeguattari wäre etwa die Behandlung der Frage gewesen, wie das zeitgenössische Denken der Netzpioniere, wie etwa der Behaviorismus, jener naturwissenschaftlich gegründete Strukturalismus der zweiten amerikanischen Moderne, die Entwicklung des Netzwerkdenkens beeinflusst hat. Wie also das kybernetische Operieren der Homo-Faber-Ära mit den Schemata von Reiz und Reaktion, Ursache und Wirkung, System und Funktion in Einklang zu bringen ist. Denn natürlich arrangiert sich ein Denken, das den menschlichen Organismus als eine Maschine betrachtet, leichter mit jener „abstrakten Maschine”, als die der Computerwissenschaftler Louis Pouzin das protokoll-basierte Internet vorstellte.
Paul Baran, einer der Architekten des Netzes und Entwickler der Informationsvermittlung im Internet, beruft sich für seine Arbeit „On Distributed Communication Networks” ausdrücklich auf den Neurologen Warren McCulloch, der beschrieb, wie das Hirn Schädigungen einzelner Bereiche durch Funktionsverschiebung in andere Hirnregionen ausgleicht. Auch für den Netzverkehr definiert man lediglich Input und Regeln – und überlässt Transport und Überwachung des Transports der Maschine. Anders herum: Ein Denken, das die kristallklare Distinktion und eben nicht das ewig hallende Universum der Differenz kennt, knüpft die stabileren Netze. Wäre also die Entwicklung des Internets in einer Postmoderne überhaupt möglich gewesen? Plausibel zu machen, warum also schon in den Theorie-Inkunabeln des Internets gewissermaßen ein Cyborg, der „kybernetische Organismus” für Informationsverarbeitung, liegt, hätte ein aufschlussreicherer Clou in Bunzes historischer Rekapitulation sein können, als in den Mahlstrom aus passend gemachten Versatzstücken des gerade angesagten Akademie-Jargons zu steigen.
Das Tasten der historischen Problemlösungsversuche aufzuzeigen, das gelingt Mercedes Bunz ja ganz ausgezeichnet. Es ist nicht so, dass die Entwicklung des Internets als ein Projekt betrachtet werden kann, das dem eines Hausbaus gleicht. Im Gegenteil: Aus heutiger Sicht gleichen die Überlegungen auf dem Weg zum Übernetz fiebrigen Denkbewegungen, abstrusen Investitionsentscheidungen, Delirien des nur theoretisch Möglichen, die immer nur hypothetisch und scheinbar orientierungslos vorhandene Technik-Stücke zu irgendwas verbanden, schiefe Analogien bemühten, um dann doch immer wieder alles zu verwerfen. Ein Irrweg-Sackgassensturmlauf gewissermaßen, für den nicht einmal klar war, welchen Zweck dieses Netz einmal erfüllen sollte. Dieses Buch trägt mit sicherem Gespür für die Meilensteine der Entwicklung eine Geschichte des Internets vor, die ausdrücklich auf die schier unüberbrückbaren ideologischen Gräben in der Phase seiner Konzeption hinweist. Denn von Anfang an bewegt die Entwickler das Problem von Kontrolle und Besitz von Information.
Herrschaft oder offene Struktur
So kurios es klingen mag: Bereits Mitte der siebziger Jahre, als Netzwerktechnologie schon als künftiges Paradigma der Informationsgesellschaft erkennbar wird, konkurrieren zwei komplexe Netzwerk-Modelle im Streit miteinander, die Bunz als historischen Clinch um „virtual circuits vs. Datagram” (virtuelle Verbindung versus Datenpaket) referiert. Die Frage lautete, „ob man in Zukunft Netzwerke mit einer Architektur bauen sollte, bei der die Kontrolle beim Netzwerkbetreiber liegt, oder ob man die Intelligenz des Netzwerks an die Enden zu den Nutzern verlegt”.
Während vor allem Telekommunikationsfirmen versuchen, Standards zu etablieren, die in der Hand der Netzwerkbetreiber bleiben, also Herrschaftswissen erzeugen wollen, belegt das offene und schließlich siegreiche Protokoll TCP/IP, dass erst die offene Struktur des Netzes neue Kommunikationsformen ermöglicht und damit seinen Erfolg beschleunigt. Während deshalb das Netz kontinuierlich wächst, reduziert sich seine Bedeutung immer mehr auf die eines bloßen Vehikels. In Folge ist nicht mehr von Belang, was die „abstrakte Maschine Internet” macht, wer sie steuert oder wer das Wissen besitzt, sich an sie anschließen zu können. Von Belang ist nur noch, was man selber damit macht: Willkommen im Informationszeitalter! BERND GRAFF
MERCEDES BUNZ: Vom Speicher zum Verteiler. Die Geschichte des Internet. Kulturverlag Kadmos, Berlin 2008. 147 Seiten, 17,50 Euro.
Ausschnitt aus einer Karte des Internets: Jeder Hauch in dieser Wolke verbindet zwei Teilnetze miteinander, die Farben repräsentieren ihren Ort. Grafik: Matt Britt
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Eine Dienstleistung der DIZ München GmbH
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Einen zwiespältigen Eindruck hat Mercedes Bunz' Geschichte des Internets bei Rezensent Bernd Graff hinterlassen. Fast ein wenig erstaunt scheint er darüber, dass es der Autorin tatsächlich gelingt, dieses Stück Technik-Geschichte auf nur 147 Seiten sehr klar darzustellen. Dabei begnüge sich Bunz nicht damit, ihre Geschichte als "Abfolge der Entscheidungen und Ereignisse" zu erzählen, sondern mit postmodernem Theoriewerkzeug. Das hält Graff für einen Fehler. Nicht, dass er was gegen Theorie hätte. Im Gegenteil. Zum Beispiel hätte ihn interessiert, aus welchem Geist das Internet eigentlich geboren ist, wie etwa der amerikanische Behaviorismus die Netzpioniere bei der Entwicklung des Netzwerkdenkens beeinflusst hat. Doch darüber findet er bei Bunz nichts. So wirft er ihr vor, dem "vermeintlichen Glamour eines aktuellen Theoriedesigns" verfallen zu sein. Und das ist diesem eigentlich guten Buch in seinen Augen eher abträglich.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH