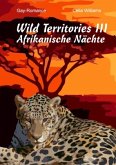Ein verstörender Roman, der vom Schrecken erzählt, den die Langeweile gebiert.Eher unfreiwillig ist der namenlose Ich-Erzähler in seine Geburtsstadt gekommen: Er muss sich um die Beerdigung seines Vaters kümmern. Große Gefühle stellen sich nicht ein; er ist ein Fremder in dieser Stadt.Da trifft er zufällig Max, einen alten Schulkameraden, der ihn auf seine Burg einlädt, wo er mit Freunden das alljährliche »Weekend« vor Beginn der Festspiele veranstaltet. Es gibt keinen Grund, das abzulehnen. Und so nimmt das unheimliche Treiben im Kellergewölbe der Burg seinen Lauf: Alkohol fließt in Strömen, Prostituierte werden bestellt, Hugo, ein Starkoch aus Reykjavik, serviert obszöne mittelalterliche Speisen, ein großes Fressen hebt an. Plötzlich läutet ein Mann an der Tür, den die Gruppe wegen seiner Hautfarbe sofort für einen Drogendealer hält und den man übermütig zum Essen einlädt. Als sich der Fremde als Bibelverkäufer entpuppt, eskaliert die Situation und der betrunkene Burgherr wird hemmungslos aggressiv. Niemand hilft, auch nicht, als längst unabweisbar klar ist, dass das zwingend notwendig wäre. Nach und nach verwandelt sich die Burg in ein grauenhaftes Gefängnis, aus dem es für alle Beteiligten kein Entrinnen zu geben scheint. Johannes Gelich hat ein morbides Kammerspiel inszeniert, das mit bohrender Intensität unser Selbstverständnis in Frage stellt.

Johannes Gelichs Roman "Der afrikanische Freund" als Vorabdruck in der F.A.Z.
"Heute Nacht ist Papa gestorben." Mit dieser Nachricht, deren Tragik zum Ich-Erzähler kaum durchzudringen scheint, beginnt der intelligente, vielschichtige und unerbittliche Roman "Der afrikanische Freund" des österreichischen Schriftstellers Johannes Gelich, den wir von heute an in dieser Zeitung vorabdrucken. Der initiale Tod des Vaters hat symbolische Obertöne: Das eherne Gesetz, die gewachsene Ordnung gerät ins Wanken. An Gott glaubt Papas verlorener Sohn schon gar nicht.
Im nüchtern-präzisen, Unheil prophezeienden Stil eines Geständnisses, der profanisierten Confessio, berichtet der Erzähler von den drastischen Ereignissen, die sich zugetragen haben, als er anlässlich der Beerdigungsangelegenheiten seine Geburtsstadt, Salzburg wohl, aufsuchte. Heimisch habe er sich hier nie gefühlt, teilt er mit. Von einem reichen Schulfreund, Max, wird er auf dessen Burg eingeladen, um mit zwei weiteren, ihm kaum mehr erinnerlichen Freunden das alljährlich die Festspiele präludierende "Weekend" zu begehen, eine orgiastische Feier im Kellergewölbe, zu der massenhaft Alkohol, Speisen sowie Prostituierte angeliefert werden. Von den spielerisch an "Das große Fressen" angelehnten Dionysien geht eine solche Faszination aus, dass der Erzähler - stets geneigt, sich überreden zu lassen - seine Kurzvisite immer weiter verlängert.
Der rauschhaften Ausgelassenheit eignet etwas Künstliches, alle Beteiligten scheinen eine Rolle zu spielen. Plötzlich jedoch bricht das Andere in diese selbstgefällige Welt ein. Ein ungebetener Gast taucht auf, ein Afrikaner, den man zunächst für einen Dealer hält, der sich aber als Bibelverkäufer erweist und, zum Hohn der Freunde, abstinent lebt. Max bricht einen Streit vom Zaun, greift den Fremden an - und von einem Moment auf den anderen ist aus dem Freundeskreis eine Schicksalsgemeinschaft geworden, verwandelt sich das Schloss in einen Kerker, denn das Opfer ist ja zugleich der einzige Zeuge der Tat. Der "afrikanische Freund", illegal im Land und bald aufs nackte Leben reduziert, ist so dem Richtspruch der Freunde ausgeliefert.
Diese spielen wie in Trance weiter ihr Spiel, das immer morbidere De-Sade-Züge annimmt und so den Fluch der bösen Tat, die fortzeugend Böses gebiert, dramaturgisch zu überwölben sucht. Die vier Personen reagieren sehr verschieden auf das Geschehene, als Kollektiv kennen sie keine Gnade. So läuft die Handlung auf einen düsteren Höhepunkt zu, einer der finstersten Momente in der jüngeren Literaturgeschichte. Gelich lockert seinen Griff nicht, verschmäht den auktorialen Notausgang. An der Seite der nicht unsympathischen Protagonisten gerät der Leser in eine Horrorwelt ohne jede Nächstenliebe. Natürlich steht der Roman damit unter Allegorieverdacht, erinnert die Handlung, wenn nach dem Recht des Stärkeren dem Opfer das erlittene Unrecht zum Vorwurf gemacht wird, an den Umgang des zivilisierten Westens mit dem afrikanischen Kontinent. In seiner postkolonialen Dimension aber geht Gelichs Requiem keineswegs auf. Der im Jahre 1969 in Salzburg geborene Autor - "Die Spur des Bibliothekars" (2003), "Chlor" (2006) - weitet sein Thema zu einer Analytik von Schuld und Unschuld jenseits aller metaphysischen Rückbindung: Decken sich Schuld und Unschuld, wenn die Idee von Sühne fortfällt? "Wo kein Kläger, da kein Richter", heißt es an einer entscheidenden Stelle.
Auf geradezu schmerzhaft indiskrete Weise wird der in Opportunismus und Utilitarismus sich erhaltende Naturzustand freigelegt. Die Gesetzlosen stehen noch einmal dem wehrlosen Gesetz gegenüber, das sie für illegal erklären. Der Erzähler, dieses unrettbare Ich, bleibt bewusst ohne Eigenschaften, ja, sogar ohne Namen: "Man hätte mich genauso gut aus dieser Geschichte entfernen und an meiner Stelle irgendjemand anderen setzen können. Markieren. Ausschneiden. Einfügen." Was wir vor uns haben, verdichtet auf ein ungeheuerliches und bildmächtiges Ereignis, ist auch eine moralische Geschichte, die nicht moralisiert.
Durch einen geschickten inszenatorischen Kniff - ein Theater im Theater - gibt Johannes Gelich seinem fesselnden, narrativ überzeugenden Kabinettstück eine unerwartete und fast christlich zu nennende Wendung. Bei der Eröffnung der Festspiele, dem Zielpunkt des "Weekend", wird traditionell "Jedermann" aufgeführt, in dem Gottvater den ihm gebührenden Respekt reklamiert. Der Erzähler, der "den Tod des Jedermann kaum erwarten kann", scheint von der Gnadenbotschaft übermächtigt. In Hofmannsthals Stück findet der vom Tod Bedrängte zum Glauben zurück und entgeht so der Hölle; der Erzähler beginnt "vor lauter Freude zu laufen".
OLIVER JUNGEN
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Der Salzburger Fremde: Johannes Gelichs verstörend furiose Camus-Überschreibung „Ein afrikanischer Freund”
Wie selten so etwas doch gelingt: Ein funkelndes literaturwissenschaftliches Kabinettstückchen und zugleich ein autarker Text; die Parodie auf ein berühmtes Werk des sogenannten Kanons und doch zugleich ein kraftvoller Roman, der sich nach seiner eigenen Binnenlogik entfaltet. „Heute ist Mama gestorben”, hob der eine zu erzählen an, 1942. „Heute Nacht ist Papa gestorben”, schreibt der andere, 66 Jahre später. Der eine Erzähler, er heißt Meursault, ruft daraufhin seinen Chef an, der andere, er bleibt das ganze Buch über namenlos, seine Chefin, um sich jeweils im Büro abzumelden. Beide sagen dabei „Ich kann nichts dafür” und merken, wie grotesk defensiv der Satz ist, wer kann schon etwas für den Tod eines Angehörigen. Beide empfinden keinerlei Trauer bei der Todesnachricht. Der eine setzt sich in den Omnibus nach Marengo, vierzig Kilometer von Algier entfernt, der andere nimmt den ICE nach Salzburg. All das und noch mehr Übereinstimmungen auf der ersten Seite – offensichtlicher kann man nicht kopieren.
Meist enden derartige Versuche in proseminaristischem Getändel, der Text, der auf ein früheres Werk rekurriert, zieht alle Kraft und Aura aus dem Referenzwerk und bleibt dabei im Stadium eines blassen Putzerfisches, der ohne sein großes Wirtstier verenden würde, oder eines nachäffenden Clowns, der andere überzeichnet, ohne selbst etwas zu sein. Johannes Gelichs Roman „Der afrikanische Freund” aber ist trotz der ostentativen Nähe zu Camus’ „Der Fremde” ein verstörend grausamer, großer Text.
Gelichs namenloser Erzähler fährt also von Wien nach Salzburg, um die Beerdigung seines Vaters zu organisieren. Dabei läuft er Max über den Weg, einem ehemaligen Schulkameraden und reichen Spekulanten, den er gar nicht mehr erkannt hätte und der ihn zu einem Fest auf den Familiensitz, eine mittelalterliche Burg einlädt. Max trifft sich jedes Jahr kurz vor den Festspielen mit zwei anderen Schulfreunden zu einem gemeinsamen „Weekend” mit Edelnutten, Alkohol, gutem Essen und vielen Anekdoten von früher. Hugo ist Chefkoch in Reykjavik, Marcel Fotograf der Salzburger Bussigesellschaft, innerlich angeschmuddelt sind sie alle drei, aber in ihren Kreisen würde man sagen, sie haben es geschafft.
Gelichs namenloser Held kommt wider Willen mit, einerseits ekelt er sich vor der unreifen Bagage, diesen Muttersöhnchen mit ihren Internatsritualen, andererseits sind das große Fressen und die Nutten bekömmlich, so bleibt er eben, bis zum Ende. Das beginnt, als ein Afrikaner namens Joses an der Tür klingelt. Die Freunde denken, der Mann sei Koksdealer und laden ihn begeistert ein. Der Schwarze ist aber bekehrter Christ und moralischer Eiferer, er will ihnen Bibeln verkaufen und prangert ihr Treiben immer schärfer an, bis Max explodiert und der Schwarze mit dem Kopf auf den Steinboden stürzt.
Es ist beeindruckend zu sehen, wie Gelich seinen Text in weiter Ferne und doch so nah an Camus ansiedelt: so nah, denn es werden ganze Sätze aus dem „Fremden” zitiert, und sein Protagonist schaut mit ähnlich insektenhafter Unbeteiligtheit auf das Treiben der Menschen wie Camus’ Meursault; und doch in weiter Ferne, denn während Camus’ Buch in einem sengend heißen Algerien spielt, unter einer erbarmungslosen Sonne, die die Menschen aufzuschmelzen scheint, verlegt Gelich den Roman unter Tage, in ein feuchtdunkles Burgverlies, einen verwinkelten Partykeller der achtziger Jahre, mit Sitzsäcken und Wolfgang-Ambros-Postern an den Wänden.
Zudem ist die Tötung des Arabers bei Camus ein abrupter Akt, fünf Schüsse, neun Zeilen, „ein lebloser Körper, in den die Kugeln eindrangen, ohne dass man es sah.” Da ist es vielleicht nicht sonderlich schwer, indifferent zu bleiben. Der afrikanische Freund in Gelichs Roman aber siecht über 72 Seiten und mehrere Tage dahin. Gelich zeigt, wie schwer es in Wirklichkeit ist, einen Menschen umzubringen. Joses stöhnt und lallt, liegt im Koma, wacht wieder auf und wankt durch die Räume wie ein Untoter. Max, der Gastgeber und Täter, ist nur noch ein feiges Häufchen Elend; weder traut er sich, einen Arzt zu rufen, noch schafft er es, dem Fremden den Gnadenschuss zu versetzen. Da die anderen sich „nicht in alle Ewigkeit schuldig machen” wollen, versuchen sie tagelang in Eigenregie den Schwarzen zu heilen, oder zumindest nicht sterben zu lassen. All ihre stümperhaften Therapieversuche erhöhen aber nur dessen Leiden. Nicht dass sie ihn absichtlich foltern würden, aber sie binden ihn, weil nichts Anderes zur Hand ist, mit schneidend dünnen Bratenschnüren fest und geben ihm Kokain gegen den Schmerz . . .
Es ist, als wollte Gelich es seinem Erzähler nicht so leicht machen mit der Indifferenz, zwar sagt auch er, wie Meursault, permanent, ihn gehe das alles nichts an, er sei nur Zeuge eines Unfalls und beschränke sich auf die Rolle des Zuschauers. Je öfter er das betont, je länger er und die anderen sich der unterlassenen Hilfeleistung schuldig machen, desto mehr verkommt diese aufreizend passive Haltung aber zur lächerlichen Attitüde, als sei da einer in löchrigem Rollkragenpulli auf den Existenzialistenkarneval gegangen. Am Ende ist er es, der den Schwarzen erschießt.
Vielleicht liest man Camus’ Roman einfach nur anders, wenn man aus Gelichs Aufzeichnungen aus einem Salzburger Kellerloch wieder auftaucht, aber Meursault scheint etwas Großes, ja heroisch Reines an sich zu haben, er wandelt unter der algerischen Wüstensonne wie ein Kind oder ein Mensch aus der vorchristlichen, ja vorplatonischen Zeit, ohne die quälenden Schuldgefühle des zivilisierten Menschen. Seine kühle Gleichgültigkeit ist das Inkommensurable an diesem Text, die beunruhigende Leerstelle, die umso stärker auffällt, als er immer wieder geradezu lyrisch, warmherzig, sehnsüchtig über die Welt spricht, über die Abenddämmerung oder seine Freundin.
Bei Gelich hingegen wähnt man sich in der toten Ekelwelt Houellebecqs oder in den frühen Romanen von Bret Easton Ellis, in dessen trostlosem Partytreiben von „Unter Null”, in dem die innerlich ausgeschabten kalifornischen Millionärskinder die Reizschwelle immer höher setzen müssen, um überhaupt noch etwas zu spüren. Von lyrischer Sehnsucht keine Spur. So vermittelt der Roman schmerzhaft das Gefühl einer abgestorbenen Leere; als strahlte er im künstlich kalten Neonlicht des lächerlichen Partyraums. Im Schockmoment des Unfalls, nachdem der Kopf des Schwarzen auf den Boden geknallt ist, denken alle kurz, die Szene sei inszeniert, und bitten Max, zurückzuspulen, „ja, spul zurück, wir wollen die Wiederholung sehen!”
Bei Camus gibt es einen zweiten Teil, in dem Meursault der Prozess gemacht und er hingerichtet wird. Hier aber kommen alle davon. Die Leiche wird in einer Szene von nachtschwarzer Komik in einem Stausee versenkt, am nächsten Abend mischen sich die vier jungen Männer unters Premierenpublikum des „Jedermann”, schauen dabei zu, wie der alte Kaufmann am Ende begnadigt wird, und hoch über Salzburg liegt der Stausee schwarz und schweiget. ALEX RÜHLE
JOHANNES GELICH: Der afrikanische Freund. Roman. Wallstein Verlag, Göttingen 2008. 176 Seiten, 16 Euro.
„Spul’ einfach zurück!” Szene aus Luchino Viscontis 1967 entstandener Camus-Verfilmung „Der Fremde” mit Marcello Mastroianni Foto: Deutscher Fernsehdienst
Johannes Gelich Foto: Linda Stift
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.sz-content.de
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Oliver Pfohlmann ergötzt sich an der geglückten Mischung aus "ästhetischem Raffinement und herrlich bösem Humor" die den dritten Roman des Österreichers Johannes Gelich auszeichnen und den der Rezensent für rundum gelungen hält. Unverkennbar ist die literarische Vorlage, Camus' "Der Fremde", die der Autor ins Parodistische gewendet auf eine oberösterreichische Burg nahe Salzburg verlegt hat. Mitten in das ausufernde Gelage dreier Freunde platzt ein farbiger Bibelverkäufer und wird im Rausch vom Burgherren bewusstlos geschlagen. Im weiteren Verlauf versucht man, unter Aufbietung allerhand erfolgloser wie widersprüchlicher Aktionen, sich des noch lebenden Fremden zu entledigen, bis der namenlose Erzähler schließlich zur Waffe greift. Geradezu perfide und nicht "ohne höhere Ironie" ist die Gleichgültigkeit des Ich-Erzählers, die stellvertretend auch zu der des Lesers wird, der nach dem Fortgang der Geschichte giert und ungewollt zum Komplizen des "boshaften Spiels mit der ästhetischen Lust an Gewalt wird", so der Rezensent.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH