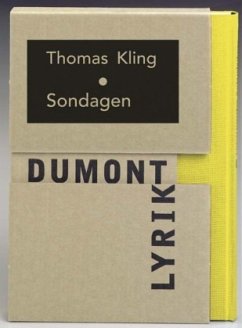Die Traditionslinie, mit der er sein lyrisches Werk von Band zu Band mit singulärer sprachschöpferischer Kraft fortdichtet, hat Thomas Kling zuletzt in "Botenstoffe", seinen funkelnd facettenreichen Essays und Exegesen, Porträts und Polemiken freigelegt. Thomas Klings "Sprachspeicher", seine Aufsehen erregende Sichtung der deutschen Dichtung vom achten bis zum zwanzigsten Jahrhundert, hat quergängerisch unser Museum der modernen Poesie gelüftet und mit Entdeckungen aus den lyrischen Archiven neu bestückt.
"Sondagen" nennt Thomas Kling sein nach "Fernhandel" bisher umfänglichstes Gedichtbuch. Wie Probeschnitte, die dem Archäologen aufeinander folgende Bodenschichten erschließen, so bergen diese neuen Sprachgrabungen im Terrain von Gedicht und Gedächtnis und in den Landschaften von Natur und Geschichte das "rohmaterial" des Spracharbeiters Thomas Kling: weitausholend von der klassischen Antike bis zum "totnmehl" in der Fortschreibung eines Gedichttableaus wie "Manhattan Mundraum".
Wenn bei Thomas Kling Sprache und Schrift zusammentreffen, dann wird bei ihm das Gedicht zum "kennungsdienst".
"Das Gedicht hat Anspruch darauf, Ansprüche stellen zu können."
Thomas Kling
"Sondagen" nennt Thomas Kling sein nach "Fernhandel" bisher umfänglichstes Gedichtbuch. Wie Probeschnitte, die dem Archäologen aufeinander folgende Bodenschichten erschließen, so bergen diese neuen Sprachgrabungen im Terrain von Gedicht und Gedächtnis und in den Landschaften von Natur und Geschichte das "rohmaterial" des Spracharbeiters Thomas Kling: weitausholend von der klassischen Antike bis zum "totnmehl" in der Fortschreibung eines Gedichttableaus wie "Manhattan Mundraum".
Wenn bei Thomas Kling Sprache und Schrift zusammentreffen, dann wird bei ihm das Gedicht zum "kennungsdienst".
"Das Gedicht hat Anspruch darauf, Ansprüche stellen zu können."
Thomas Kling

Thomas Kling sondiert in Geschichte und Vorgeschichte
Das Werk von Thomas Kling ist für Stereo geschrieben. Es genügt durchaus nicht, seinen neuen Band „Sondagen” zu lesen; man muss die mitgelieferte CD einschieben und die Gedichte mit Auge und Ohr zugleich aufnehmen. Eine Schreibung wie „brü- / llen”, allein im Zeilenbruch besehen, ist ein Manierismus; gehört, ist es wahrhaftig gebrüllt – nicht in dem Sinn, dass die Tonstärke stiege, sondern dass der Vorgang, so leise er bleibt, sein Lautbild gewinnt. Oder ein eingeklammertes „(pietät!)”: Das erschließt sich erst in der parodistischen Brüchigkeit der Stimme, die es spricht, Thomas Klings metallisch modulierender, anmaßender und vollkommen hinreißender Stimme. Sie ist es, die das Werk, immer bedroht, in der Vielfältigkeit seiner Gegenstände auseinanderzuflattern, zur klaren Einheit des Stils zusammenfasst; in ihr offenbart sich die Geschlossenheit von Klings großem und inzwischen weit fortgeschrittenem enzyklopädischen Projekt: der geschichtlichen Welt lyrische Gestalt zu verleihen.
Diesmal führt die Reise ins Neandertal, nicht weit von Klings Wohnsitz bei Düsseldorf entfernt. Man erlebt den Lehrer Fuhlrott – allein der Name schon scheint Klings Ohr ein kongeniales Fundstück –, wie er im Jahr 1856 mit seinem „knochenkoffer” unterwegs ist, einer jener unbedankt forschenden Lehrer auf dem Lande, wie sie Kafka geschaffen hat. „und der Fuhlrott fuhr, / zum ersten mal, der lehrer Fuhlrott, / fuhr er mit der eisenbahn. // am schönen neandertal vorbei / hier fließt die Düssel – / fuhr er an den Rhein. / mit hochgeschwindigkeit, / Elberfeld – Düsseldorf, / die geile Strecke.” Das frisch entdeckte Älteste, das sich des sensationell neuen Transportmittels bedient, welches seinerseits inzwischen wie ein Spielzeug von fragiler Frühe erscheint, die Begriffe von schnell und langsam relativiert am Horizont ihrer jeweiligen Epoche – solche Verkeilungen der historischen Schichten liebt Kling; und man muss es, wiederum, hören, wie er die „hochgeschwindigkeit” und die „geile strecke” spricht, mit einem kalkulierten Halbstarkentum, in dem Ironie und Rührung schwingen.
Auf der Tonspur gesungen
Es ist das Aufspüren und Herauspräparieren des archäologischen Objekts aus seinem scheinbar amorphen Bettungsgrund, was Kling anzieht; der Duktus seiner Verse wird beherrscht von Hauptwörtern, die seine Stimme wie mit Fingerspitzen aus dem Fundzusammenhang löst: Geweihmaske, Tundra-Bast, ockriger Schlot, Röhrenknochen, Pfostenlöcher, Fäkalienschicht („hier das feine”). Sie gleichen der Zigarette, wie ich sie von einem Porträtfoto Klings erinnere, emporgehalten in einer Geste, die cool und doch bergend anmutet. Die Quellen reden nicht, sie offenbaren sich manchmal bloß in einer Verfärbung des Bodens, und die Suche nach dem vergangenen Leben erlaubt sich nicht mehr als die behutsame Frage: „wie sie, zugleich, am bach stehen die frauen, / das wasser aufpeitschen mit gerten. / was da gesprochen wird? / oder gesungen?” Davon geblieben sind Spuren im Ton, die Kling mit der empfindlichen Granulation seiner eigenen Tonspur aufnimmt.
Wo sich sein Schreiben mit der geschwisterlichen Entsprechung dieses Wortspiels begreifen lässt, gelingen Kling seine besten Sachen. Jedoch ergibt sich fast im Umkehrschluss, dass er umso größeren Misserfolg haben muss, je festere Gestalt die behandelten Objekte von Haus aus mitbringen. Aus den Akten eines Hexenprozesses ein Gedicht machen zu wollen, ist misslich, weil deren Prosa, abgefasst in der handgreiflich bunten Sprache der frühen Neuzeit, einen Grad der Eindringlichkeit erreicht, an dem alles Schaudern des Nachgeborenen sprachlich zuschanden wird. „die feder zittert des schreibers.” Das glaube ich nicht; die Folterprotokolle von vor vierhundert Jahren bewegen den heutigen Leser nicht als Seismogramm, sondern weil sie inmitten des Entsetzlichen in klarster Unbewegtheit verharren.
Und vollends hat es keinen Zweck, Sonden absenken zu wollen, wo der Gegenstand in nichts als einer lackierten, entschiedenen Oberfläche besteht. Die zahlreichen Gemäldebeschreibungen des Bandes geraten in die Gefahr der schieren Verdoppelung, angereichert höchstens um eine flaue Missbilligung vor den Metzelstücken und Jagdstilleben. Über drei Seiten erstreckt sich die Schilderung von Bruegels Alchemistenküche. „belegschaft / am machn. das sieht man: / die leute / sind unterbezahlt.” Ganz recht: Das sieht man. Hören kann man es nicht. Dann aber schiebt sich plötzlich wieder, ein wahrhaft akustisches Sujet, ein „Stilleben mit Telefonbieter” dazwischen, der zittert und schwitzt, bis endlich der Hammer über die Löffelreiher und Eisvögel fällt.
Bilsenkraut auf dem Schutt
Der Band eignet sich, um die Stärken und die Schwächen und also insgesamt die Grenzen des Klingschen Verfahrens zu erkennen. Er will keinen gemalten, sondern einen gelauteten Erdkreis geben. Es lautet aber nicht alles. Zum Beispiel nicht das Bilsenkraut auf dem Schuttplatz seines heimischen Hombroich, das er gern zu seiner emblematischen Pflanze hätte (zumal es ein Hauptbestandteil der hexischen Flugsalben war). Es ist unmöglich, diesem Gewächs zu begegnen, es anzuschauen und anzufassen, ohne von der sinistren Sensualität seiner gummihaft stumpfen Blätter und seiner großen fahlen Blütenkelche mit ihrem tiefvioletten und leuchtendorangen Schlund fasziniert zu sein. Davon fängt sich kaum etwas bei Kling, der sie ungelenk „unausrechenbare pflanze” nennt, von der „schmutzblüte” mit „schmutzton” redet und von ihrer Frucht sagt, sie sei eine „rechte sprechkapsel”, was eine völlig willkürliche Behauptung darstellt. Die Verlegenheit sucht Zuflucht zuletzt im gelehrten Namen, und so steht als Titel über dem Gedicht „(Hyoscyamus niger)”.
Gelehrtheit bedeutet nicht an sich schon einen poetischen Makel, oft im Gegenteil; aber bei Kling verwandelt sie, sobald er die klassische Tradition berührt, die Namen in Spielsteine eines exklusiven Spiels. „Leonidas I” heißen diese überlakonischen Gebilde oder „Spruch des Anaximander”, „Krinagoras” oder „Epitaph des Sardanapal”. Mitspielen darf nur, wer den Ölschinken von Delacroix kennt, der den nachsinnenden Despoten inmitten seiner sterbenden Odalisken zeigt. Außer solcher Teilhabe an der Bildungsfrucht schenken die fünf Zeilen wenig Vergnügen.
Ganz und gar jedoch verweigert sich Kling der Anschlag auf das World Trade Center, dem er zum Auftakt mit 21 numerierten Stücken zu Leibe rücken will. Nummer 14 besteht aus einem einzigen Wort, „nothelfer”. Das ist von einem läppischen Feinsinn. Hier, auf Ground Zero, sind die Bilder und die Meinungen noch so stark, hier herrscht immer noch eine so helle Aufregung, dass die Coolheit, die ein solches Gebaren verschmäht, sich eigentlich nur unbehaglich an der Wand herumdrücken kann; der 11. 9. ist eindeutig nicht ihr Tag. Mit Verwunderung erlebt man, wie das Understatement, ans untaugliche Objekt gehalten, seinen eigenen Kitsch hervorbringt: „licht ging weg nur noch krach / und siedelten so in der luft / wir auf einer insel // unverweht // und allein” – da ist es Kling doch glatt gelungen, Paul Celan mit Lucky Luke zu kreuzen!
BURKHARD MÜLLER
THOMAS KLING: Sondagen. Gedichte. DuMont, Köln 2002. 137 S., 19,90 Euro.
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.diz-muenchen.de

In neuen Gedichten beschwört Thomas Kling eine zauberhafte Einheit / Von Heinrich Detering
Am Anfang aller Poesie steht der Zauber, als Sprach- und Schrift-Magie in einem ganz wörtlichen Sinn. Hinter dem althochdeutschen zaubar nämlich verbirgt sich etymologisch der angelsächsische téafor, der Farbstoff, der die Runenzeichen im Stein sichtbar macht. Mit der blutrot gefärbten Geheimschrift, mit Heilungszauber und Bienenbeschwörung, begann der zweitausendjährige Durchgang durch die Poesie, den Thomas Kling im letzten Jahr in seiner großen Anthologie "Sprachspeicher" unternommen hat. In derselben Schrift hat man sich auch seinen neuen Gedichtband zu denken - den ersten seit dem vor drei Jahren erschienenen "Fernhandel" und den umfangreichsten seines bisherigen Werks.
In den Zauberformeln entdeckt Kling Urmuster der Weltwahrnehmung und der Versuche, sie sprachlich zu bannen. Wer diese Gedichte liest, sieht Gespenster. Er sieht den wortmächtigen "wespenbanner / der wußte den richtigen spruch", er sieht Hexen und Untote, Wiedergänger von Vergangenheiten, die zu geisterhaftem Leben erwachen. Er erfährt nicht nur etwas "Über die Art wie sie Hagelschlag zu erregen pflegen", über die Anwendungen "der flut-, der flugsalbe", über "das stinkende haar / Und das blut und die pisse" - er erblickt dies alles auch in Klings Bildvorlagen, in den Hexenbildern Baldung Griens und des Hexenhammers, und zugleich aus den Augen des ängstlich voyeuristischen Schreibers, der die peinlichen Befragungen mit zitternder Feder protokolliert. Und da werden auf einmal postmoderne Metaphern wie die vom "beben der schrift" wieder so neu und konkret, als hätte Kling sie eben erfunden. Wer diese Zaubersprüche liest, hört mit albtraumhafter Schärfe das "gellen der tinte", das "fading" der Pythia, den "ohrenbetäubenden schneefall" am Waldrand. In den Leichenbildern, die Juan Valdés Leal 1672 in Sevilla gemalt hat, erblickt er die "gelockte bischofsmumie" und die von Käfern überkrochene Tiara; vorbei an den barocken Vanitas-Emblemen fällt sein Blick hinab ins "beingewölb aus staub und mulm", in dem das leitmotivisch eingesetzte "teure tuch" der Toten am Ende nur noch Tuch ist, ohne Beiwort; in dem plötzlich, die Epochen verwirrend und vereinend, eine Fotografie aus dem spanischen Bürgerkrieg aufblitzt und in dem endlich, als triumphierender "kerzenlöscher", der leibhaftige Tod erscheint.
Klings "Sprachspeicher", den der erste Merseburger Zauberspruch eröffnet hatte, endete mit Versen von Marcel Beyer. Auch dessen Bienen-Gedichte und archäologisch-poetologische Metaphern hallen nun in Klings Klangraum wider. Wie Beyer jüngst in dem Band "Erdkunde", so unternimmt auch Kling seine "Sondagen" als Grabungen im topographischen wie sprachlichen Gelände. Doch dieser Archäologe ist ein maskierter Medizinmann, ein Schattenbeschwörer des Imperfekts. Die technisch verfeinerten Instrumente verwandeln sich in seinen Händen zu magischem Gerät. Durchs "sprachrohr" blickend, entdeckt er eine "zielperson mit geweihmaske"; seine "wärmebildkamera" richtet er aufs schmutzverkrustete "hexenhemd"; er hört Beowulfs Seewetterbericht "mächtige / seeschlangen voraus" melden, und "dem bildstrom / längs macht fahrt das gedicht. ist lesbare sprachküste".
Sehr weit hinab geht diese Fahrt, aus den Nato-Bunkern in den Hades der Eurydike, zu Mars und Minerva, zu Sprüchen Anaximanders und des delphischen Orakels, die Kling der "Griechischen Anthologie" nachdichtet, und in die dionysischen Lavaströme unterhalb aller Geschichte. Immer tiefer, von der Gegenwart im ersten Kapitel bis in die antiken Anfänge des vorletzten, senkt sich das poetische "bleilot" in jenen "brunnenbereich", den man wohl unergründlich nennen sollte. Wer mit Kling in die Schlünde der Vergangenheit hinabgefahren ist, sieht nach dem Wiederauftauchen die Gegenwart mit anderen Augen - die erstarrten Basalte in den lichten Gehölzen der Eifel beispielsweise, hinter der aufgegebenen Raketenstellung von Hombroich, dort, wo Kling heute lebt: "bröckelig eine ausgeglühte / vom besenginster bald / schon beleuchtete gegend". Bis zur Verschmelzung durchdringen sich die Zeiten und Medien, die Kriege der angelsächsischen Helden und die der Nato, die Pergamente und die Tonbänder, der Kiel der archaischen Boote und der gleichnamige Reichskriegshafen.
Die Suggestionskraft dieser Wort- und Bildfügungen ist um so größer, als sie hier mit hypnotischer Präzision artikuliert werden. Der Soundmix der Sprachen und Zeiten, das Flimmern und Rauschen der Monitore, das sich in Klings bedeutendem Frühwerk manchmal zum Effekt zu verselbständigen drohte, zum Overkill der phonetischen und graphemischen Verfremdungen, hatte schon in "Fernhandel" musikalische Stringenz gewonnen. Nun verknüpft ein dichtes Geflecht von Leitmotiven die einzelnen Gedichte über kürzere oder weitere Distanzen. "Sondagen" ist ein genau komponierter Zyklus aus kleineren Zyklen, Choreographie und Begleitmusik eines Gespensterreigens, der im flackernden Licht der Feuerstellen und Bildschirme vorüberzieht. Und mit dem Verschwinden der renommistischen Sprachgesten wird der Blick frei für Bilder von unheimlicher Zartheit, für die blau schimmernde Haut des frisch abgezogenen Hasen etwa, die die Farbe des Himmels reflektiert, und "sonne scheint ihm rosa / durchs ohr". (Nicht nur hier meint man den Schamanen Beuys durch die Szene geistern zu sehen.)
Vom blutroten Beschwörungszauber aus erschließt sich auch das große, aus einundzwanzig Fragmenten gefügte Gegenwarts-Gedicht, das den Band eröffnet. Diese Fortsetzung des früheren "Manhattan Mundraum" spricht stockend und wieder neu einsetzend, immer an der Grenze des Verstummens, vom 11. September. In abgebrochenen Versen singt sie die "lichtsure" vom Wind überm Hudson und vom Staub, läßt sie Bruchstücke von Psalmen anklingen und die Todesfuge vom "siedeln in der luft". Wenn in diesem Sprachengestöber "ihr unglücklichen augen" angeredet werden, dann erscheint mit diesen drei Wörtern schattenhaft Goethes Türmer Lynkeus mitten in Manhattan, und die Klage von Philemon und Baucis: "Menschenopfer mussten bluten / nachts erscholl des Jammers Qual" - diese Klage wird hörbar wie ein ferner und trauriger Klang. In solchen Augenblicken sind Klings Zitatkunst und Assoziationsregie der Vollendung sehr nahe.
Der Urgrund dieser Poesie ist magisch, und er ist mündlich. Die blutrote Schrift ist nur ihre behelfsweise Notation; um wirksam zu sein, müssen die Fluch- und Segensformeln gesprochen und gesungen werden. Wie in seinem letzten Gedichtband hat Kling also auch jetzt, zeitgemäß modifiziert und medientechnisch wie immer auf der Höhe, an diese Ursprünge angeknüpft. Auf einer dem Buch beigefügten CD rezitiert er seine Verse mit eindringlich kühler Präzision. Wer sich also bei der Wahl seiner Weihnachtsgeschenke nicht zwischen Buch und CD entscheiden kann, soll Klings "Sondagen" kaufen, da hat er beide. In buchstäblich zauberhafter Einheit.
Thomas Kling: "Sondagen". Gedichte. DuMont Buchverlag, Köln 2002. 140 S., geb. im Schuber mit CD, 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Burkhard Müllers Besprechung über den neuen Gedichtband von Thomas Kling fällt gemischt aus. Zunächst einmal rät der Rezensent dem Leser, gleich zur mitgelieferten CD zu greifen, denn diese Verse seien "für Stereo" geschrieben und müssten gleichzeitig von Augen und Ohren aufgenommen werden. Für den akustischen Part stehe der Autor, freut sich Müller, mit "metallisch modulierender, anmaßender und vollkommen hinreißender Stimme" zur Verfügung. Und, ergänzt der Rezensent, Klings Vortrag schütze die Vielfalt dieser "Sondagen" vor dem Auseinanderfallen. Die Gedichte selbst hat Müller zwiespältig aufgenommen. Die Verse, die von Dingen mit diffuser Gestalt handeln, seien ganz wunderbar, so der Rezensent, die aber, in denen "feste Objekte" im Mittelpunkt stünden, missraten. Und auch Klings Versuch, den 11. September lyrisch zu verarbeiten, hält der Rezensent eher für kritikwürdig.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH