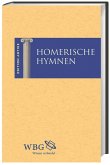There have been many works which dealt with the timeless stories of the rage of Achilles and the uncertainty of Odysseus's homecoming in the 'Iliad' and the 'Odyssey'. This book however provides something which is completely new: Bannert provides a direct view of the poet's workshop where he created the epic poems without any knowledge of writing as orally presented works of art. He analyzes the entire range of Homer's narrative technique: snapshots in time and descriptions in slow motion, close-ups and fixations on details, superimposed monologues and stories within stories. In his poetry written 2,800 years ago, Homer demonstrated all those techniques used in literature, theater or films today: the ability to captivate people and to make them curious as to what is going to happen next in a story.

„Ilias” und „Odyssee” sind sorgfältig komponierte Naturereignisse. Herbert Bannert gibt die homerischen Gedichte ohne kulturwissenschaftliche Ablenkung der Literatur zurück
Von Johan Schloemann
Ein Pfeil fliegt durch die Luft. Schuss, Flug, Treffer: Kaum ein paar Sekunden dürfte das dauern. Doch dies ist nicht irgendein Pfeil. Sondern einer, der einen Waffenstillstand bricht und so ein ganzes großes Kriegsgeschehen wieder in Gang bringt. Und so wird die Erzählung gedehnt: Ausführlich sehen wir den Schützen, den Trojaner Pandaros, wie er sich und sein Geschoss bereit macht, „den Urquell dunkeler Qualen”. Und auch, als der Pfeil schon in Bewegung ist, wird der Bericht abgebremst - und der Blick erst einmal auf das Ziel gelenkt, den König Menelaos, für den die Griechen gegen Troja in den Krieg gezogen sind. Die Göttin Athene, das wird schon verraten, verhindert, dass Menelaos tödlich getroffen wird - dieselbe Göttin übrigens, die gerade erst Pandaros zu seinem Pfeilschuss angetrieben hat. Diese Inkonsequenz folgt konsequent einem Prinzip der Handlungssteuerung: Man muss einen Helden in Bedrängnis bringen und daraus vielfältige Komplikationen entwickeln - aber er darf nicht oder noch nicht sterben.
Der Pfeil nun wird nur ein wenig die Haut verletzen, denn die Göttin hält ihn „so weit ab vom Körper, wie vielleicht eine Mutter / von ihrem Kind fernhält eine Fliege, wenn es in süßem Schlaf da liegt”. Wie ein Blitzlicht erscheint mitten im Männerkrieg, mitten in einem prekären ballistischen Moment dieses Bild der Häuslichkeit, des Friedens, der Fürsorge, der Lebenserhaltung. Eindringlicher kann man nicht daran erinnern, dass es eine Welt außerhalb des Kampfes gibt, und man spürt, dass damit auch die Gefühle der Krieger selbst aufscheinen, die sich nach ihren fernen Frauen und Kindern sehnen. Scharf, ja grausam ist der Kontrast; denn nichts ist weiter entfernt von dieser Szene höchster Anspannung als der „süße Schlaf”. Und dann ist der Pfeil endlich angekommen - doch auch jetzt werden erst noch minutiös die einzelnen Schichten der Rüstung des Menelaos geschildert, die er durchdringt, bis die Haut touchiert und ein bisschen Blut geflossen ist. Genug Blut allerdings für einen Vertragsbruch und eine zunehmende Zuspitzung des Kriegs, der schon seit zehn Jahren anhält.
Warum soll man „Homer lesen”? Ganz einfach - so führt es der Wiener Philologe Herbert Bannert in seinem so betitelten Buch, auch am Beispiel des Pandaros-Pfeils, vor -, weil das höchste Kunst ist. Eine Kunst, die vor allem zweierlei leistet: Sie macht trotz aller kulturellen Distanz zeitlose menschliche Fragen plastisch - anhand einer Welt, in der für den Einzelnen das „Handeln bis zur letzten Konsequenz” gefordert und „keine Möglichkeit, einer Entscheidung auszuweichen”, gegeben ist. Und zweitens sind, so Bannert, die Epen Homers, die im achten Jahrhundert vor Christus entstanden, „die ältesten uns erhaltenen Dokumente dafür, wie man eine Geschichte aufbaut, Szenen aneinander reiht, Spannung erzeugt . . ., wie ein Autor eine Figur gestaltet, Personen charakterisiert, eine Rolle anlegt”. Diese Gedichte zeigen uns „die Grundlagen jeder Darstellungstechnik”.
Das Ziel dieses Buches - das ohne Ablenkungsversuche, ohne aufgeregte Thesenbildung treffsicher erreicht wird - ist also: „Ilias” und „Odyssee”der Literatur zurückzugeben. Dies zwar nicht, um sie der Wissenschaft wegzunehmen; denn deren Ergebnisse sind erkennbar eingeflossen. Aber die Art und Weise, in der hier die Diskussionen der Forschung für den Leser ausgeblendet sind - anders als in anderen Arbeiten Bannerts, etwa auch in seiner rororo-Monographie über Homer -, diese Art und Weise hat schon fast etwas Freches.
Da hat man sich zumal seit Friedrich August Wolfs „Prolegomena ad Homerum” (1795) über die Autorschaft der homerischen Werke gestritten, über die Schichten ihrer Entstehung und ihre Rolle innerhalb einer mündlichen Sangestradition; hat Theorien zur Überlieferung des Textes und zur Genese verschiedener Fassungen entwickelt; hat die Formelsprache der Gedichte untersucht und vergleichende Epen- und Märchenforschung betrieben; hat nach der Aufführungspraxis der Gedichte und ihrer realgeschichtlichen Stellung in der Adelswelt des frühen Griechenland gefragt; und man hat nicht zuletzt über den archäologischen Kontext und den Quellenwert der Epen für die Zeit, in der sie spielen, debattiert - also für die Palastkulturen der späten Bronzezeit wie Mykene und Troja.
Und nun kommt Herbert Bannert und bringt uns Homer, dieses sorgfältig komponierte Naturereignis, wieder fast nur mit den Mitteln der geschickten Paraphrase und der literarischen Interpretation nahe. Das Buch ist so wenig kulturwissenschaftlich, wie es eben geht. Gleich auf der dritten Seite schreibt der Autor: „Wer war Homer? Wir wissen es nicht, und es ist auch nicht wichtig.” Und als hätte sich in den Grundfragen der Homererklärung kaum etwas getan seitdem, schließt das Buch mit einem Abendessen in Weimar im Sommer 1794, an dem Goethe, Herder, Wieland, Homer-Übersetzer Voß und Karl August Böttiger, der ewige Berichterstatter, teilnehmen: Herder habe in dem Gespräch vermutet, Homer könnte „nur ein nomen collectivum” sein; Voß hingegen „vertheidigte die unité und indivisibilité seines Homers mit eben so großem Eifer, als der eifrigste Jacobiner die Einheit der Republik”. Er selbst aber, Böttiger, habe an dem Abend die Bemerkung gemacht, „daß hier sehr viel auf die Frage ankäme, ob Homer die Buchstabenschrift gekannt, u. diese zum Niederschreiben seiner Gedichte gebraucht habe. Voß behauptete beides.”
Bannert selbst nun sagt zu diesen immer noch strittigen Fragen nur das Nötigste. Er nimmt eine „schriftliche Aufzeichnung . . . ab ca. 730 v. Chr.” an, sieht die Gedichte von Achills Zorn und Odysseus Heimkehr als „eine Auslese all der Errungenschaften vieler Sängergenerationen”, deren Dichter indes erkannt habe, dass ihn „die Buchstabenschrift in die Lage versetzt, ein thematisch und inhaltlich zusammenhängendes Gedicht von nie gekannter Länge und Komplexität zu entwickeln”.
Ansonsten aber geht es Bannert darum, eben diese Komplexität und erzählerische Kraft durch Einfühlung in den Text selbst spürbar zu machen. Das gelingt ihm großartig. Er vergleicht einzelne Szenen mit den Methoden des Films, führt vor, wie der Gesamtbau der Epen teils dem hinhaltenden Spannungsaufbau, teils der extremen Verdichtung auf einen Ort, eine Situation dient. Etwa bei der geschickten Auflösung der Chronologie in der „Odyssee”, in der wir dem Haupthelden erst im fünften Gesang begegnen und die ein Gemälde der weiten Welt ist, um am Ende in einem einzigen Raum zu kulminieren. Nie ist das nur Technik. Die Technik ist hier stets mit ihrem Ziel verbunden: der Tragik und Anmut der Geschichten. Also: Bannert lesen. Danach braucht es den sanften Imperativ seines Buchtitels nicht mehr, dann liest man den Homer von selbst.
Herbert Bannert
Homer lesen
Frommann-Holzboog, Stuttgart 2005. 237 Seiten, 39,80 Euro.
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Eine Dienstleistung der DIZ München GmbH
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
"Homer lesen" - warum? Diese Frage stellt sich nach Lektüre dieses Buches nicht mehr, versichert Johan Schloemann, weil Herbert Bannert überzeugend vorführe, dass Homers Epen "höchste Kunst" seien. Wie der Wiener Philologe Bannert seinen Lesern Homer nahe bringt, hat für den Rezensenten fast etwas Atemberaubendes, Freches: nur mit den Mitteln der Nacherzählung und literarischen Interpretation und "so wenig kulturwissenschaftlich, wie es eben geht". Zwar seien die neuesten Erkenntnisse der philologischen Forschung "sichtbar eingeflossen", doch zugleich langweile der Verfasser nicht mit theoretischen Erörterungen und Diskussionen. Stattdessen versuche er für die "Ilias" und die "Odyssee" selbst zu begeistern, indem er die erzählerische Kraft, aber auch die Komplexität des Textes, den raffinierten Gesamtbau, der in seinem langsamen Spannungsaufbau sowie in der extremen Verdichtung fast etwas Filmisches habe, deutlich macht. "Das gelingt ihm großartig", lobt Schloemann. Er empfiehlt: Bannert lesen, dann lese sich Homer wie von selbst.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Bannert lesen. Danach braucht es den sanften Imperativ seines Buchtitels nicht mehr, dann liest man den Homer von selbst.« Johan Schloemann, Süddeutsche Zeitung »Fazit: Ein gehaltvolles Büchlein, das Lust machen kann, Homer neuerlich im Lichte der durch Raoul Schrott in Gang gesetzten Homer-Diskussionen zu lesen.« Renate Oswald, Grazer Beiträge