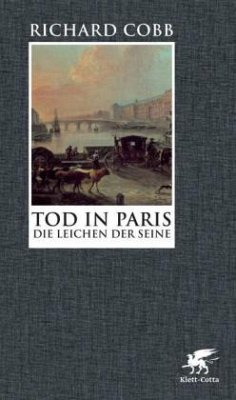Selbstmörder in Paris um 1800: Was mag einen Menschen bewogen haben, seinem Leben in der Seine ein Ende zu setzen? Und was kann ein Historiker über diese Menschen und ihre Beweggründe herausfinden, der heutzutage die Obduktionsprotokolle von Wasserleichen aus der Seine studiert? Angaben über Alter, Beruf, Familienstand, Wohnviertel, Herkunft führen mitten hinein in den Alltag der Armen und Marginalisierten in der revolutionserschütterten Großstadt. Das liest sich teilweise wie ein Krimi, und der Autor agiert wie ein Detektiv.
Ein Lehrstück darüber, wie Historiker über verstaubte Akten die Vergangenheit zum Sprechen bringen.
Ein Lehrstück darüber, wie Historiker über verstaubte Akten die Vergangenheit zum Sprechen bringen.

Spurensuche in den Akten der Morgue an der Seine: Ein so ungewöhnlicher Historiker wie Richard Cobb gewann daraus ein Bild des alltäglichen Lebens in Paris am Ende des achtzehnten Jahrhunderts.
Historiker, die uns die großen Linien aufzeigen oder gar erklären wollen, was die Welt im Innersten zusammenhält, hätten sich um den Aktenbehälter D4 U1 7 in den "Archives de la Seine" vermutlich nicht weiter gekümmert. Er enthält schließlich nur die Untersuchungsberichte des Leichenschauhauses der Seine über nichtnatürliche Todesfälle in den Revolutionsjahren III bis IX, also von 1795 bis 1801. Unter den Toten, insgesamt 404, findet sich naturgemäß kein Robespierre, kein Danton und kein Saint-Just, sondern zum Beispiel "Marie-Geneviève Sudeur, Ehefrau von Philipp Hudde, Wäscherin, geboren in Alfort-Charenton, 47 Jahre alt, Rue de Sèvres, (Division de l'Ouest), vermisst seit dem 19. Germinal, am 21. in Neuilly aus dem Wasser geborgen ...".
Nun war dieser Karton aber dem englischen Historiker Richard Cobb in die Hände gefallen - oder besser: Er hat ihn aufgespürt. Denn der frankophile Cobb war dafür bekannt, dass er in irgendeinem Aktenmagazin der Provinz auch schon mal versehentlich eingeschlossen wurde. Bevor er 1972 den Lehrstuhl für Neuere Geschichte in Oxford erhielt, hatte er in französischen Archiven vor allem nach aussagekräftigen Details gegraben - und für Cobb war beinahe jedes Detail aussagekräftig. Er war davon überzeugt, dass der Historiker "über normale Menschen und normale Milieus" schreiben solle, wie es in einem Nachruf auf den 1996 Gestorbenen hieß, und er "verachtete die Autorität und Menschen, die, wo auch immer, nach Macht strebten". Kurz, man könnte Cobb beinahe einen Vertreter dessen nennen, was modisch eine Zeitlang "Geschichte von unten" hieß, wenn das nicht viel zu kurz greifen würde. Denn dieser Historiker wusste vor allem, dass seine Zunft durchaus etwas mit der des Erzählers zu tun hat, und es verwundert nicht, dass er sowohl großartige Essays zur französischen Literatur als auch Kurzgeschichten geschrieben hat, sowohl in englischer wie in französischer Sprache.
In seinem kenntnisreichen Vorwort weist Patrick Bahners zu Recht darauf hin, dass wir in Cobb einen Zeitgenossen Foucaults erkennen müssen: das Gespür für die verborgenen Strukturen der Macht, die Hinwendung zu den Namenlosen, die durch ihn ihre Geschichte bekommen, die Bedeutung des Archivs insgesamt, die Vertiefung ins Detail. In der Tat fühlt man sich bei der Lektüre dieses Buches sofort an Untersuchungen wie "Wahnsinn und Gesellschaft" oder "Überwachen und Strafen" erinnert, mit dem Unterschied, dass Cobbs Sprache nicht so kalt durchdringen und so kristallklar leuchten möchte wie die Foucaults, sondern vor allem von Empathie getragen wird, ohne dabei jemals rührselig zu werden. Und natürlich war Cobbs Weg zum Lehrstuhl auch ein ganz anderer als die Ochsentour von Michel Foucault, wie sie für die französische akademische Elite bis heute typisch ist. In seiner Zeit "als stellenloser Aktenschnüffler" (Bahners) lebte Cobb von der Unterstützung durch französische Kommunisten, vom Sprachunterricht für Stewardessen der Air France und zuweilen auch von der Unterstützung seiner durchaus begüterten Eltern in Tunbridge Wells.
Sein Hauptaugenmerk im vorliegenden Fall gilt den Selbstmördern und Selbstmörderinnen, die mehrheitlich in die Seine gegangen sind, um ihrem Leben ein Ende zu setzen. Natürlich sind auch einige unter den 404 Toten, die dazu eine Schusswaffe benutzt haben - allerdings keine einzige Frau -, doch das Sich-Ertränken ist bei den von Cobb untersuchten Fällen die mit Abstand häufigste Form des Suizids. 249 der 274 Selbstmörder - in den anderen Fällen handelte es sich um Unfälle oder Morde - warfen sich in die Seine.
Ins Wasser gehen, das heißt immer, sich einer stärkeren Macht ergeben, weil man nicht mehr kämpfen kann - man denkt hier unwillkürlich an den Abschiedsbrief von Virginia Woolf -, aber zuweilen wird es wohl auch von der Hoffnung begleitet, im letzten Moment gerettet zu werden. Denn im fraglichen Zeitraum und in dem Milieu, aus dem Cobbs Fälle mehrheitlich stammen, fand der Suizid immer ein wenig in der Öffentlichkeit statt. Allein schon deshalb, weil die Seine ein öffentlicher Ort ist, der, wie Cobb in "Paris and its Provinces 1792-1802" schrieb, die Stadt nicht allein in zwei Hälften, sondern auch in zwei Mentalitäten teilte und für das Leben der Stadt konstitutiv war (und ist). An ihren Ufern promenierte man in der knapp bemessenen freien Zeit auch damals schon. Junge Frauen oder Mädchen, die an Liebeskummer oder an ihrer verlorenen Ehre litten, gingen mit Vorliebe sonntags ins Wasser, nicht ohne sich für ihren letzten Gang noch einmal prächtig gekleidet zu haben. Die Sprache der Kleidung und wie sie zu verstehen sei, ist überhaupt ein zentrales Motiv, das sich durchs ganze Buch zieht und dem gegen Ende ein ganzes Kapitel gewidmet ist. Zuweilen wurden die jungen Frauen jedoch schon vor dem entscheidenden Akt gerettet, wenn etwa einem aufmerksamen Mitbürger ihr auffälliges Verhalten am Fluss nicht entgangen war und er die zum Tode Entschlossene angesprochen hatte.
Da die Wasserleichen oft erst im Zustand der Verwesung entdeckt wurden, suchte man nach Angehörigen oder Nachbarn, die sie identifizieren konnten, die sogenannten répondants der Akten. Sie fanden sich fast immer, und wenn so einerseits die Lebenden über die Toten erzählten, erzählen andererseits die Toten dem Historiker Cobb noch viel mehr über die Lebenden.
Sie erzählen zunächst von einer ziemlich statischen Gesellschaft. Wir befinden uns im untersuchten Zeitraum überwiegend im Direktorium und, nach Napoleons Staatsstreich, in den ersten beiden Jahren des Konsulats. Man sollte also meinen, das Leben der Menschen, von denen hier die Rede ist, sei irgendwie durch das Nachbeben von "Revolutionswirren" tangiert. Doch in dem Milieu, dem die Mehrheit der Toten entstammt, werden Berufe - "und damit die Zukunftsaussichten" - von Generation zu Generation weitergegeben. Es ist "eine klar geordnete Gesellschaft mit streng geordneten Verhältnissen", auf die die Revolution kaum Auswirkungen hat, die aber auch kaum Raum für Mobilität und Veränderung lässt.
Zweitens ist es eine überaus transparente Gesellschaft. Die Menschen leben in ihr auf engstem Raum und gleichsam immer auch öffentlich. Man kennt sich durchaus; mit der bekannten Schimäre der anonymen und kalten Großstadt hat das alles nichts zu tun. "Es kann nicht so einfach gewesen sein, sich im Paris des 18. Jahrhunderts, wo man so eng aufeinander saß und jeder jeden beobachtete, wo kein nächtliches Gemurmel und kein in gedämpftem Ton geführter Ehestreit unbelauscht blieb, unbemerkt aus dem Leben zu stehlen." Deshalb gibt es unter den insgesamt 404 Toten auch nur etwa zwanzig, die nicht identifiziert werden konnten.
Schließlich entsteht das Bild einer Gesellschaft, die sich allein durch ihr Beharrungsvermögen der neuen Zeit verweigert - einer Zeit, die zudem in den Jahren des Direktoriums selbst nicht so genau wusste, wohin sie wollte. So wie die Guillotine gewissermaßen für die höheren Stände da ist, so scheren sich die Angehörigen der hier untersuchten Milieus, die sich durchaus vermischen und oft im selben Haus wohnen, nicht um die große Politik. Eine Tatsache, die Cobb so zusammenfasst: "Man hat den Eindruck, dass in einer Gesellschaft, in der man so dicht aufeinander hockt wie in Paris am Ende des 18. Jahrhunderts, alles seine Zeit und seinen Ort hat: Tod, Geburt, Werben, Heiraten, Jahrmarkt, Rausch, Streit, Verprügeln der Ehefrau, Stehlen - ein Kalender, der aus einer Zeit lange vor der Revolution stammt, überhaupt nicht von ihr beeinflusst wurde, ja sie vollkommen ignoriert."
Das wären die Quintessenzen dieses Buches. Aber man sollte Richard Cobb nicht auf Quintessenzen hin lesen, sondern einfach seinen Geschichten folgen, die bei aller Härte der Verhältnisse auch von Hilfsbereitschaft und Wärme erzählen, wobei Cobb nie in die Gefahr gerät zu romantisieren. Es ist kein Zufall, dass er in diesem Buch en passant ausgerechnet Raymond Queneau zitiert, den französischen Romancier einer Alltagsgeschichte par excellence, über den er an anderer Stelle einen Essay geschrieben hat: Es handelt sich um Geschichtsschreibung und Literatur aus demselben Geist.
"Tod in Paris" ist das erste Buch von Richard Cobb, das ins Deutsche übersetzt wurde. Es ist zu wünschen und steht zu hoffen, dass andere, wie etwa "A Second Identity", "Promenades" oder "People and Places", folgen.
JOCHEN SCHIMMANG
Richard Cobb: "Tod in Paris". Die Leichen der Seine 1795-1801.
Mit einem Vorwort von Patrick Bahners. Aus dem Englischen von Gabriele Gockel und Thomas Wollermann. Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2011. 201 S, geb., 19,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

„Die Leichen der Seine“: Richard Cobbs wunderbare Studie über den Pariser Alltag nach der Revolution
Man könnte jetzt natürlich mit statistischen Zahlen kommen. Siebenhunderttausend Einwohner auf zwanzig Quadratkilometern, mit einem Fluss mitten durch, da wird schon der eine oder andere absichtlich oder unabsichtlich hineinfallen. Der Historiker Jean Tulard schätzt die Zahl der Selbstmörder im nachrevolutionären Paris auf knapp zweihundert pro Jahr. Und die Bürokratie der jungen Republik, in der ein toter Citoyen erst richtig tot war, wenn er erfasst war, führte exakt Buch für das papierene Nachleben in den Archiven. Gerät dieses Material aber in die Hände eines Historikers wie des 1996 verstorbenen Engländers Richard Cobb, tritt alle Statistik zurück hinter ein Panorama aus lauter Einzelschicksalen. Cobbs 1978 erschienene Studie über die Akten eines Pariser Leichenschauhauses aus der Revolutionszeit, die hier zum ersten Mal auf Deutsch vorgelegt wird, ist ein Abriss des Pariser Alltagslebens am Ende des achtzehnten Jahrhunderts, eine Innenschau des Todes in den Anfängen der Republik, ein imaginärer Stelenwald zum Gedenken längst vergessener Selbstmörder, kurz: ein historisches Wunderding.
Wer in Paris zwischen Revolution, Directoire und Konsulat eines unnatürlichen Todes starb, konnte den beiden Concierges der Basse-Geôle, der amtlichen Leichenhalle für ungeklärte Todesfälle, kaum entgehen. Gut vierhundert Einträge sind erhalten von Menschen, die tot aus der Seine gefischt und in der Basse-Geôle nach Möglichkeit mit Namen, Herkunft, Alter, Kleidung, Todesursache und sonstigen Einzelheiten erfasst wurden. Statt dieses Material sofort auf die Allgemeingesetze über damalige Lebens- und Todesbedingungen zu extrapolieren, vertieft Cobb sich in die Einzelfälle und horcht jedem geduldig nach wie einer, der gerade im letzten Sterbenswörtchen noch die klärende Antwort aufs Leben erwartet. Und Cobbs Ergebnisse zwingen uns, manche Vorstellungen zu jenen Revolutionsjahren zu revidieren.
Es waren fast ausschließlich einfache Leute, schreibt der Autor, mehr Selbstmörder als Mordopfer, vorwiegend Männer, aus dem Milieu der Tagelöhner, Fuhrleute, Kaminkehrer, Wasserträger, Garköche, Laufburschen, Dienstmädchen, die ins besagte Leichenhaus kamen. Die Revolution hatte für sie schon wenige Jahre danach so gut wie nicht stattgefunden, denn sie übten Tätigkeiten aus in der vorindustriellen Gesellschaft, die vom Regimewechsel fast unberührt blieben. Cobb hebt die generationsübergreifende Kontinuität der Berufe in einer ausgesprochen statischen Gesellschaft hervor: „Familienbande, Heirat, gemeinsame Wurzeln in der Provinz oder im selben Viertel von Paris und in Familientradition ausgeübte Berufe erhalten und verstärken ihre Immobilität“. Das Kleinreden der Revolution, das sich durchs ganze Buch zieht, könnte bei einem Engländer als Ausdruck einer nationalen Manie verstanden werden. Hier spiegelt es schlicht die Faktenlage.
Wenn diese Leute aus Überdruss gegen die mühsamen Lebensbedingungen, wegen der Misere in trostlosen Mietkammern und manchmal aus Liebeskummer in die Seine sprangen, dann deshalb, weil das die einfachste Art des Selbstmordes war. Schusswaffen blieben den vermögenden Schichten vorbehalten, fürs Erhängen gab es in den allzeit belebten Dielen, Treppenhäusern, Werkstätten und Hinterhöfen kaum einen ungestörten Moment, und das Giftschlucken war eine Sache mit ungewissem Ausgang. So taucht der Historiker Cobb seinen vergessenen Helden hinterher und befragt mit einem bewundernswerten Einfühlungsvermögen in den Akten das, was die Seinefluten als letzte Lebenszeichen aus Kleidung und eventuellen Tascheninhalten von ihnen zurückgaben.
Mochten die Selbstmordkandidatinnen im Sonntagsstaat, mit übereinander angezogenen Röcken wie zur Sonntagsmesse in den Fluss gehen, suchten die übrigen Selbstmörder meistens so eine geeignete Stelle am Wasser, wie sie auch sonst durch ihren Alltag gingen. Die übereinander getragenen Kleidungsstücke kamen daher, dass das Ausziehen und Wechseln der Kleider fürs kleine Volk ein so seltener Luxus war wie der Todesschuss hinter einer verriegelten Tür. Und dass die Wäschezeichen mit Initialen auf dem Hemd der Toten eher auf Irrwege als zur Identifizierung der Person führten, war den Beamten des Leichenhauses früh klar. Die entsprechenden Kleidungsstücke waren meistens durch mehrere Hände gegangen. Aufschlussreicher erschienen die Flickmuster, die in den Taschen gefundenen Gegenstände – eine kleine Münze, ein abgebrochenes Messer, eine halbe Brille – oder der besonders abgeschabte Hosenboden, das an der Brust zerschlissene Wams, die ausgefransten Ellbögen, die manchmal auf spezifische Tätigkeiten zu schließen erlaubten. All diese Details breitet Richard Cobb mit liebevoller Aufmerksamkeit vor uns aus und gedenkt auch der Messingknöpfe mit der Prägung „République Française“, die, je länger die Revolutionskriege dauerten, von den Deserteuren in die Taschen der Gassenjungen oder aufs Mieder der Pariser Näherinnen kamen.
Mit einem an Foucaults Spurenforschung orientierten Verfahren, wie Patrick Bahners im Vorwort wohl richtig vermutet, bringt der Historiker Cobb die Selbstmörder des achtzehnten Jahrhunderts noch einmal zum Sprechen. Er zeichnet dabei eine Gesellschaft, der schon wenige Jahre nach dem Blutvergießen der Revolution der Tod wieder als etwas Außergewöhnliches erscheint: ein Paris ohne finstere Halsabschneidergassen, fast ohne Morde, weit entfernt von Eugène Sues „Mystères de Paris“.
Cobb zeigt ein Stadtleben, das bei allen Sozialgegensätzen gesellschaftlich eng verflochten blieb und in dem die Leute „im August zusammen schwitzten, im Januar gemeinsam zitterten, in unmittelbarer und unbequemer Nähe zueinander lebten, sich fortpflanzten und starben, wo sich nichts verbergen ließ und alles mitgehört wurde, wo aber nichts und niemand gleichgültig war“. Man liest dieses freizügig zwischen Spurensichtung und Weltbetrachtung wechselnde Buch von Anfang bis Ende in der Ungewissheit, ob Spannung oder Rührung uns stärker fesseln. Die elegante Übersetzung von Gabriele Gockel und Thomas Wollermann trifft Cobbs eigenwilligen Ton vorzüglich und die zahlreichen Aktenzitate über die vergessenen Toten ruhen im Satzspiegel nicht einfach als Fußnoten unter dem Strich, sondern rahmen wie Stelen würdig die Textränder. JOSEPH HANIMANN
RICHARD COBB: Tod in Paris. Die Leichen der Seine 1795-1801. Aus dem Englischen von Gabriele Gockel und Thomas Wollermann. Mit einem Vorwort von Patrick Bahners. Klett-Cotta, 2011. 201 Seiten, 19,95 Euro.
Sie sprangen in die Seine,
weil dies die einfachste Art
des Selbstmords war
Auf dem Weg ins Leichenschauhaus: Gut 400 Akteneinträge über Tote aus der Seine hat der 1996 verstorbene Historiker Richard Cobb analysiert. Er bringt die Selbstmörder des 18. Jahrhunderts noch einmal zum Sprechen.
Abb.: akg-images
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de
Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension
Hocherfreut zeigt sich Rezensentin Tania Martini darüber, dass Richard Cobbs 1978 verfasstes Buch "Tod in Paris - Die Leichen der Seine 1795-1801" endlich in einer deutschen Übersetzung vorliegt. Sie liest das Werk als eine Art Sozialgeschichte des Suizids und als "Alltagsgeschichte der Revolutionszeit". Wie Cobb aus den Protokollen der 404 Leichenkellernotizen der Jahre 1795 bis 1801 und aus anderen Quellen wie den Aufzeichnungen Restif de la Bretonnes das alltägliche Leben der Armen in Paris, die verwahrlosten Wohnung entlang der Seine hausten, erschließt, findet sie höchst faszinierend. Ihr Fazit: ein "ganz wunderbares Buch".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH