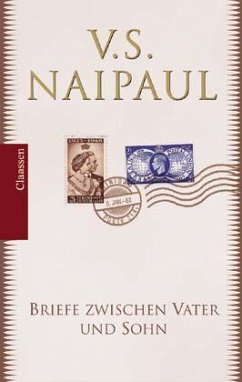Im Jahre 1950, kurz vor seinem achtzehnten Geburtstag, kehrt V. S. Naipaul seiner Heimat Trinidad zum ersten Mal den Rücken. Sein Ziel ist England, denn er hat ein Stipendium der Universität Oxford bekommen. 1953 stirbt Naipauls Vater, ein Journalist des 'Guardian' auf Trinidad, im Alter von 47 Jahren an einem Herzinfarkt. In den vorausgegangenen drei Jahren haben Vater und Sohn eine bewegende Korrespondenz geführt, die die selten innige und tolerante Beziehung der beiden spiegelt. Denn Naipauls Vater hatte einen Traum: Sein Sohn sollte Schriftsteller werden, und er konnte sein Glück kaum fassen, als dieser diese Berufung für sich entdeckte und zu schreiben begann.

Ein Star und ein Held: V.S. Naipaul und sein Vater in Briefen
Die Mütter dieser Erde sind doch alle gleich. „Am 10.11. 1950”, schreibt Vater Naipaul aus Trinidad dem Sohn nach Oxford, „hat deine Mutter dir ein 10 kg schweres Paket geschickt. Es enthält: 6 Dosen Grapefruitsaft, zwei Dosen Orangensaft, 2 Pfd. Kristallzucker, 1 Glas Amchar und einen selbst gebackenen Kuchen.” Ein knappes halbes Jahr später will der junge, meist hungrige Student von mütterlichen Sendungen nichts mehr hören und meldet nach Port of Spain: „Euer Campbell-Suppen-Karton ist völlig eingezuckert hier angekommen” und bittet, keine Pakete mehr zu schicken, „es sei denn, ich bitte euch darum.” Er hat nie wieder darum gebeten.
„Briefe zwischen Vater und Sohn” heißt das Buch, das Naipauls Agent Gillon Aitken aus Briefen zusammengestellt hat, die keineswegs nur zwischen Vater und Sohn gewechselt wurden. Es gibt auch Briefe zwischen Vater und Tochter, Bruder und Schwester (Naipauls ältere Schwester Kamla studiert zur selben Zeit mit einem Stipendium an der Benares Hindu University in Indien), und es gibt die regelmäßigen Zusätze der Mutter zu den väterlichen Briefen („Isst du auch genug”, „Heiratest du auch kein weißes Mädchen?”). Da aber dieser Briefwechsel vor allem vom Schriftsteller-Werden handelt, bleiben die weiblichen Beiträge in ihm marginal. Selbst den Titel hat der Vater schon vorhergesehen, als er am 22.10.1950 seinem Sohn schreibt: „Lieber Vido, .. . Deine Briefe sind von einer wundervollen Spontanität. Wenn du mir Briefe über das Leben und die Menschen ... in Oxford schreiben könntest, dann könnte ich sie zu einem Buch zusammenstellen: BRIEFE ZWISCHEN VATER UND SOHN.” Nun hat der Agent vollendet, was Naipauls Vater – er starb 1953 im Alter von 47 Jahren – nicht selbst hat tun können.
Totes Land
Der Briefwechsel beginnt im Herbst 1949, unmittelbar vor der Abreise des noch nicht achtzehnjährigen V.S. Naipaul nach England, und er schließt mit dem Tod des Vaters im Herbst 1953. Es folgen einige Briefe, die den Beginn von Naipauls literarischer Laufbahn ankündigen – 1957 konnte er seinen Erstling „The Mystic Masseur” publizieren, an dem er schon während der Oxforder Jahre gearbeitet hatte. Es muss nicht stimmen, dass erst mit der Publikation dieses Briefbandes, so der Verlag, „der Schlüssel zur autobiographischen Dimension seines Werkes” vorliegt. Wovon handeln Naipauls Bücher wie „Finding the Centre” (1984), der „Prolog zu einer Autobiographie”, „A House for Mr Biswas” (1961) oder „The Enigma of Arrival” (1987), wenn nicht von der „autobiographischen Dimension”?
Auch wenn nichts Weltbewegendes in diesen Briefen verhandelt wird, es lohnt sich, young Mr Naipaul beim Werden zu beobachten. Aber was heißt Werden? Schon an dem Siebzehnjährigen wirkt das meiste erstaunlich gesetzt. Die Urteile sind in Stellung gebracht, und in der Regel sind es keine besonders günstigen. Nicht dass Naipaul bei sich selbst eine Ausnahme machte: „Ich war immer der Meinung gewesen, ich sei zwar nicht attraktiv, aber doch zumindest nicht hässlich. ... Ich wusste gar nicht, dass ich ein fettes Gesicht habe.” Wer kriegt sonst noch alles sein Fett weg in diesem ersten Brief: Jane Austens „Emma”? „Purer Klatsch”. Die Inder? „Ein diebisches Pack”. Indien: „ein totes Land”. Die Nachhilfeschülerin? „Wirklich strohdumm”. Und überhaupt: „Meine Theorie ist, dass die Welt im Sterben liegt.” Man könnte den jungen Naipaul präpotent nennen, aber warum sollte er an seiner Sendung zweifeln?
Der Vater lobt und mahnt: „Du schreibst gut. Ich habe nicht die geringsten Zweifel, dass du ein großer Schriftsteller wirst, aber mach es dir nicht zu leicht” und, väterlicher Rat, „hüte dich vor jeglicher Art von Ausschweifung”. Das hat sich der junge Vido ohnehin vorgenommen. Er ist ein treuer Sohn und er weiß von den Entbehrungen der Eltern, die ihm das eine oder andere gesparte Pfund nach England schicken. Seine Art Sohnestreue besteht darin, seiner Berufung zu folgen, die Schreiben heißt. Ehe die Verleger oder gar die Leser von seinen Werken überzeugt sind, findet er sie schon einmal selber gut. „Hört euch mal das hier an”, schreibt er nach Hause. „Lest es laut”, um zu konstatieren: „Mir ist egal, was andere davon halten, ich finde diese Zeilen großartig.” Diesen Mann zeichnet von Beginn an eine außerordentliche Schicksalsgesundheit aus, ein unerschütterliches Selbstbewusstsein, das sich an jeder Probe nur bewährt. „Seid tapfer meine Lieben vertraut auf mich. Vido” kabelt er auf die Nachricht vom Tod seines Vaters nach Hause. Das ist leicht gesagt, wenn man schon als Einundzwanzigjähriger weiß, dass man ein sehr berühmter Schriftsteller wird.
Pakt der Generationen
Der Star dieses Briefwechsels ist Naipaul junior, der eigentliche Held aber ist der Vater. Auch er ist Schriftsteller, wenn auch einer, der sein Schreiben mit einem journalistischen Brotberuf und den Forderungen einer vielköpfigen Familie vereinen muss und der, weil er seine Themen aus dem Alltag von Trinidad schöpft, außerhalb der Insel nicht wahrgenommen wird. „Natürlich”, klagt er seinem Sohn, „bin ich als Schriftsteller hier auf der Insel bekannt – aber eben auch nur hier, und mir steht nicht unbedingt der Sinn danach, eine regionale Berühmtheit zu sein.” Vielleicht ist es nicht der Mangel an Talent, der den Vater von seinem berühmteren Sohn trennt, sondern bloß der Umstand, dass der Vater in koloniale Lebensformen hineingeboren wurde und ihnen treu blieb, während sein Sohn den Aufbruch wagte und beim Wiedersehen die Welt der Eltern mit anderen, post- kolonialen Augen sah.
Was an Naipauls Vater so besticht und diesem Briefwechsel seine menschliche Note gibt, ist die unbedingte Kollegialität, die brüderliche Sympathie, mit der er die literarischen Anfänge seines Sohnes begleitet. Einmal bietet „Pa” einen Pakt an: „Entweder du unterstützt mich, nachdem du dein Studium in Oxford abgeschlossen hast, damit ich mich ganz dem Schreiben eigener Geschichten widmen kann; oder ich unterstütze dich, damit du dich deinem Schreiben widmen kannst...” Unwahrscheinlich, dass der junge Naipaul die literarische Karriere seines Vaters mit Brotarbeiten gefördert hätte. Nicht weil er an der Begabung des Vaters zweifelt, sondern weil er weiß, dass er selbst ein Schriftsteller werden muss und zwar einer, der dem Vater notwendig überlegen ist, weil er über den größeren Horizont gebietet als einer, der auf dem „lächerlichsten Eiland” zuhause ist, „das je das Meer zierte”.
Der junge Naipaul wusste wohl, warum er sich von zu Hause fern hielt. Wenig ist in diesem Buch von Heimweh die Rede, aber einmal dann doch. „Ich habe Sehnsucht nach zu Hause”, schreibt Vido im März 1952 aus Oxford. „Wisst ihr, wonach ich mich sehne? Nach der Nacht, die ohne Vorwarnung einbricht, jäh und schwarz. Nach einem heftigen nächtlichen Regenguss. Nach dem metallischen Trommeln schwerer Tropfen auf dem Dach.” Und was fehlt ihm noch? „Meine Fahrradtouren, das Meer, das Parkett im Rialto und die Sorte Zigaretten, die ich zum Entsetzen aller immer geraucht habe.” Noch im Heimweh wird deutlich, dass dieser junge, überhebliche Mann zu seinem Glück kaum mehr brauchte als sich selbst.
CHRISTOPH BARTMANN
V.S. NAIPAUL: Briefe zwischen Vater und Sohn. Aus dem Englischen von Kathrin Razum und Claus Varrelmann. Claassen Verlag, München 2002. 422 Seiten, 23 Euro.
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.diz-muenchen.de

Die Energie der Ausgesperrten: V. S. Naipauls Briefwechsel mit dem Vater / Von Jenny Erpenbeck
Man weiß, wer Paul Klee ist, man kennt seinen Engel, seine Farben, seine Zeichnungen, die aussehen, als seien sie mit einem Nagel in eine Gefängniswand geritzt. Und dann, wenn einen zu interessieren beginnt, wo das herkommt, dieses einzigartige Gekritzel, wenn einem einfällt, daß hinter der Kunst ja der Mensch steckt, der das gemacht hat, und man wissen will, ob dieser Mensch der Kunst, die er hervorgebracht hat, wohl ebenbürtig ist, dann nimmt man seine Tagebücher zur Hand und liest.
Man weiß, wer Mozart ist. Und wenn man davon gehört hat, daß er seiner Cousine schweinische Dinge geschrieben hat, die durchaus nicht zur überirdischen Verklärtheit seiner Musik zu passen scheinen, und man ergründen will, wie das zusammengehen mag, oder wenigstens beide Seiten kennen will, die überirdische und die irdische, um sie nebeneinander im Kopf aufzubewahren, selbst wenn man nicht verstehen kann, wie das zusammengeht, dann nimmt man sich die Briefe Mozarts und liest.
V. S. Naipaul hat im letzten Jahr den Nobelpreis für Literatur bekommen, und einige seiner Werke sind seit mehreren Jahren auf dem deutschen Markt zu haben. Dennoch kann eine umfassende Kenntnis seiner Werke, die der Lektüre des soeben bei Claassen erschienenen Briefwechsels zwischen ihm und seinem Vater zugrunde gelegt werden könnte, hierzulande sicher nicht vorausgesetzt werden. V. S. Naipaul ist Inder und in Trinidad aufgewachsen. Was macht ein Inder in Trinidad, wird sich mancher fragen, ein anderer wird vielleicht gar im großen Weltatlas nachblättern müssen, um sich Gewißheit darüber zu verschaffen, daß Westindien, obgleich es dort eine große indische Minderheit gibt, nicht im Westen von Indien liegt.
Machen wir es also anders, sehen wir uns die Briefe nicht vom Felsen des Werkes aus an, quasi über die Schulter, im Rückblick - sondern so, als sei das Buch einfach ein Buch, ein Buch voller Briefe zwischen einem Vater und seinem Sohn.
"Betrachte es als eine Aufgabe fürs Wochenende, nach Hause zu schreiben." "Du solltest unbedingt an deinem Roman weiterarbeiten. Es dauert Jahre, ein erfolgreicher Schriftsteller zu werden, egal wie gut man ist; und je früher man beginnt, desto besser, daran muß ich dich wohl kaum erinnern." "Schreib weiter, damit du noch besser wirst, und kümmere dich nicht um mich. Mir geht es gut. Ich will einfach, daß du es schaffst. Und ich weiß, daß du es schaffen wirst." "Du hast wirklich einen sehr schönen Brief geschrieben. Schreib noch viele in dieser Art." "Schreib ein paar Kurzgeschichten, um dir ein bißchen Geld dazuzuverdienen. Später kannst du sie dann zu einem Buch zusammenstellen." "Beschreib die Dinge, wie sie sind, in realistischem Stil, humorvoll, wenn es sich anbietet, aber auch nur dann."
In einer bürgerlich beplüschten, mit Geld wohlversehenen Familie wäre bei solchen Anweisungen des Vaters an den Sohn womöglich ein Drama herausgekommen, eine sieglose Schlacht zwischen eigenem und elterlichem Ehrgeiz, an deren Ende beide Seiten erschöpft voneinander lassen, oder Fahnenflucht des Jüngeren, Lossagung von der Familie - und die Strafe dafür, das lebenslang schlechte Gewissen, falls der Erfolg sich einstellt. Kurz: ein Szenarium für mitteleuropäische Schlechtwetterlagen wie bei Ingmar Bergman.
Nichts davon jedoch im Briefwechsel zwischen Seepersad und Vidia Naipaul. Ganz im Gegenteil geht mit der Veröffentlichung dieser Briefe lange nach dem Tod des Vaters dessen schönster Traum endlich in Erfüllung: ein gemeinsames Buch von Vater und Sohn.
Der Briefwechsel beginnt 1950, als ein Stipendium es dem achtzehnjährigen Sohn ermöglicht, der heimatlichen Insel endlich den Rücken zu kehren. Weg aus der Provinz, hinein in die Welt. Die Mutter hat ihm ein Hühnchen eingepackt. Das ißt er auf der Durchreise im New Yorker Hotelzimmer.
In Oxford dann studiert er englische Literatur, schreibt nebenbei seinen ersten Roman und arbeitet als Redakteur für verschiedene Zeitungen. Die Eltern schicken Zucker, Socken und Hemden, eine Messingvase zum Geburtstag. Wenn sie Geld haben, schicken sie ihm Geld. Wenn er Geld hat, schickt er ihnen Geld.
Der Sohn wird nicht mehr zurückkehren, bevor der Vater stirbt - vielleicht entsteht gerade dadurch der Eindruck, daß der Jüngere gleichsam mit frischen Kräften den Weg weitergeht, auf dem sein Vater die ersten Schritte gemacht hat. Der Vater, aus einer Landarbeiterfamilie stammend, war Journalist geworden und hatte begonnen, Kurzgeschichten zu schreiben, dann auch an Romanen zu arbeiten, ohne jedoch mehr als lokale Berühmtheit zu erlangen. Ganz einleuchtend scheint es auf einmal, daß über zwei Generationen hinweg gearbeitet werden muß: für den Nobelpreis.
Nun ist V. S. Naipaul kein Maler und kein Musiker, sondern Schriftsteller, und so kann leicht in die Irre gehen, wer sich von diesem Briefwechsel zweier Schreibender besondere sprachliche oder geistige Genüsse erhofft. Vierhundert Seiten wird man mit solchen Erwartungen wahrscheinlich nicht durchhalten. Hin und wieder gibt es kurze Bemerkungen zum Werk anderer Autoren, natürlich auch einige Überlegungen zum Handwerk des Schreibens - aber beinahe nirgends finden sich ausführliche Reflektionen zu diesem oder jenem Thema, ausführliche Betrachtungen eigener Seelenzustände oder Beschreibungen anderer Personen. Vielleicht kennen sich Vater und Sohn zu gut, um sich auf diese Weise austauschen zu müssen. Oft heißt es in den Briefen aus Oxford in aller Kürze: Ich habe Freunde. Meistens verbunden mit der Bitte an die Eltern, Zigaretten zu schicken, damit der arme Student sich diese Freunde erhalten kann - zum Essen kann er sie nämlich nicht einladen, dazu reicht das Stipendium nicht aus. Das Auto des Vaters braucht einen neuen Schlauch, die Schreibmaschine des Sohnes hakt bei dem und dem Buchstaben, die Schwester will ihren Stipendienplatz in Indien vorfristig und fluchtartig verlassen - für all das ist Geld nötig, und jeder in der Familie überlegt, wie er dem anderen helfen, etwas beisteuern kann. Es scheint, als halte gerade das fehlende Geld die Familie auf eine Weise zusammen, wie man es sich hierzulande schwer vorstellen kann. Der Mangel löst nicht Egoismus aus, sondern Solidarität. Natürlich heißt das andererseits, daß bei der Ankündigung der Geburt eines siebenten Geschwisterchens von Freude oder gar Gratulationen an die Mutter nicht die Rede sein kann.
Woran jeder der beiden Männer arbeitet, wird zwar am Rande erwähnt, aber die Manuskripte gehen separat per Schiffspost hin und her und sind dem Briefwechsel natürlich nicht beigefügt. Wichtig ist immer, wohin sich die Texte verkaufen lassen. Hier stehen sich Vater und Sohn gegenseitig bei: Wie zwei Mäuse nagen sie gemeinsam an den Türen zum Kulturleben des British Empire.
Der Briefwechsel erzählt so von der ungeheuren Energie, die durch Ausgesperrtsein erzeugt wird. Ausgesperrtsein von dem, was in "der Welt" gilt - sei es durch Hautfarbe, durch Sprache, durch Geldnot, durch die Unmöglichkeit, die Provinz, in der man geboren ist, zu verlassen. Desto erstaunlicher, mit welcher Verachtung, welchem Haß der Vater über schwarze und muslimische Menschen urteilt, die, ebenso in ihrer Existenz gefangen wie er, mit ihm auf der Insel leben - und mit welcher Selbstverständlichkeit der Sohn diese Urteile bestätigt.
Erst im letzten Drittel des Briefwechsels erscheint diese rassistische Blindheit als etwas, das spätestens mit dem Menschen, der ihr anheimgefallen ist, vergehen muß - als etwas, das selbst alt und altmodisch geworden ist. So verfolgt der Leser nicht nur mit Rührung, sondern auch mit dem Gefühl eines notwendigen Ausgleichs, wie das Alter beginnt, sich des Vaters zu bemächtigen. Als habe es ihm den Kopf verdreht, schreibt der alte Mann immer weniger und beginnt statt dessen, Orchideen zu züchten. Ganz allmählich erscheinen diese Orchideen, eine nach der anderen, in den Briefen: Blumen, über deren Pflege der Ehrgeiz eines ganzen Lebens langsam verblaßt. "Ich sage dir", schreibt der Vater dem Sohn, "die Schmetterlingsorchidee ist eine kleine Schönheit. Die Schmetterlinge halten sie wirklich für einen Schmetterling."
V. S. Naipaul: "Briefe zwischen Vater und Sohn". Aus dem Englischen übersetzt von Kathrin Razum und Claus Varrelmann. Claassen Verlag, München 2002. 464 S., geb., 23,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
In diesen Briefen zwischen dem jungen V. S. Naipaul und seinem Vater hat der Rezensent Hanns-Josef Ortheil die "Keimzelle" des Naipaulschen Schreibens entdeckt. Zunächst aber offenbare sich darin eine "mehr als ungewöhnliche Beziehung" zwischen dem als Journalist arbeitenden Vater und dem in Oxford studierenden Sohn. Das Besondere dieser Beziehung liegt für den Rezensenten in dem Einverständnis, mit dem beide unermüdlich das gleiche Ziel verfolgen: "der gute Text". Dabei habe zunächst der Vater die Regeln seiner Schreibkunst an den Sohn weitergegeben, bis dieser "zum Lehrer" geworden sei und dem Vater zu lesen gegeben habe, was er "inzwischen begriffen" habe. Beide, so Ortheil, der Vater wie der Sohn, scheinen in diesen Briefen und überhaupt "um ihr Leben" zu schreiben. So dass es nicht verwundere, dass der Sohn nach dem unerwarteten Tod des Vaters "mit beinahe finsterer Entschlossenheit" seinen Weg weitergegangen sei.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH