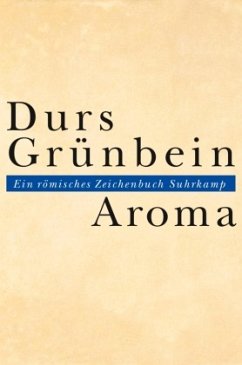Einer der bedeutendsten deutschsprachigen Dichter der Gegenwert stellt sich in Vers und Prosa der Ewigen Stadt.
'Aufblühen wird man hier, auch als kraut sich gern überlassen.
Dem wohligen Phototropismus. Der man im Norden war, Dieser Eisblock Identität, Psyches Schneemann ist bald zerronnen.' Der so spricht, ist an einem Ort angekommen, wo viele seiner Schreib- und Lebensmotive zusammenlaufen. Durs Grünbeins Jahr in Rom hat Gestalt gewonnen in einem Zeichenbuch. Die Stadt - 'Roma caput mundi' - wird als ein Schauplatz der Zeichen und Verweise erfahren und schlägt sich, wie bei den Reisenden früherer Zeiten, in Zeichnungen nieder - freilich in geschriebener Form. Aus vier Kapiteln gefügt, entstand so sein opus incertum, nach dem Vorbild des altrömischen Mauerwerks aus Bruchsteinen.Grünbeins Aroma eröffnet mit langzeiligen Gedichten in freiem, hexametrisch gewitterndem Versmaß: doch nicht auf der Suche nach dem verlorenen Gestern. Vielmehr sind es die kaleidoskopisch zu fassenden Momente der Gegenwart, die den Blick des Dichters auf Stadt und Umland lenken. Die geistige Bruderschaft im Zeichen der Urbanität findet der Dichter, über die Zeiten hinweg, in Juvenal, dessen Dritte Satire er neu übersetzt und erläutert. In einer Reihe von Prosabildern, die an römischen Erinnerungsorten den Apostel Paulus so gut einfangen wie den Antiquitätenhändler und den afrikanischen Immigranten, bricht Grünbein mit dem lyrischen Maß, bevor in freien Versen das Zeichenbuch ausklingt: 'Die Städte träumen alle voneinander. / Sie rufen sich beim Markennamen, und das Echo / Hallt durch die engen Korridore der Straßen.'
'Aufblühen wird man hier, auch als kraut sich gern überlassen.
Dem wohligen Phototropismus. Der man im Norden war, Dieser Eisblock Identität, Psyches Schneemann ist bald zerronnen.' Der so spricht, ist an einem Ort angekommen, wo viele seiner Schreib- und Lebensmotive zusammenlaufen. Durs Grünbeins Jahr in Rom hat Gestalt gewonnen in einem Zeichenbuch. Die Stadt - 'Roma caput mundi' - wird als ein Schauplatz der Zeichen und Verweise erfahren und schlägt sich, wie bei den Reisenden früherer Zeiten, in Zeichnungen nieder - freilich in geschriebener Form. Aus vier Kapiteln gefügt, entstand so sein opus incertum, nach dem Vorbild des altrömischen Mauerwerks aus Bruchsteinen.Grünbeins Aroma eröffnet mit langzeiligen Gedichten in freiem, hexametrisch gewitterndem Versmaß: doch nicht auf der Suche nach dem verlorenen Gestern. Vielmehr sind es die kaleidoskopisch zu fassenden Momente der Gegenwart, die den Blick des Dichters auf Stadt und Umland lenken. Die geistige Bruderschaft im Zeichen der Urbanität findet der Dichter, über die Zeiten hinweg, in Juvenal, dessen Dritte Satire er neu übersetzt und erläutert. In einer Reihe von Prosabildern, die an römischen Erinnerungsorten den Apostel Paulus so gut einfangen wie den Antiquitätenhändler und den afrikanischen Immigranten, bricht Grünbein mit dem lyrischen Maß, bevor in freien Versen das Zeichenbuch ausklingt: 'Die Städte träumen alle voneinander. / Sie rufen sich beim Markennamen, und das Echo / Hallt durch die engen Korridore der Straßen.'

Rom hat viel alte Bausubstanz: Der Flaneur Durs Grünbein hat seine touristischen Tagestouren in Verse gepresst. Der Grund dafür ist das einzige Rätsel des Buchs.
Von Ernst Osterkamp
Rom ist ein heikles Gelände für Dichter. Nach zweitausend Jahren europäischer Romdichtung im weiten Spannungsfeld zwischen spätantiker Admiratio Romae und romantischer Ruinenmelancholie ist dem Romthema nur dann noch etwas abzugewinnen, wenn sich ein Autor nicht von der geschichtlichen Bedeutungsfülle der Stadt einschüchtern lässt und aus der Kraft der Subjektivität ein radikal eigenständiges Bild Roms entwickelt: so wie dies in der klassischen deutschen Literatur Goethe mit dem ungeheuren erotischen Wagnis der "Römischen Elegien" oder in der Moderne Paul Nizon in bedingungsloser Liebe mit "Canto" und Rolf Dieter Brinkmann in bedingungslosem Hass mit "Rom, Blicke" gelang. Was aber dazwischen liegt, ist in aller Regel vom Übel.
Nun hat also auch Durs Grünbein als Gast der Villa Massimo ein Jahr in Rom verbracht und legt mit der marktgerechten Hurtigkeit, die man von diesem Dichter mittlerweile leider gewohnt ist, schon wenige Monate später einen stattlichen Band mit den literarischen Erträgen seines Aufenthalts vor. Der Band enthält immerhin einen schlechthin großartigen Text: Juvenals 3. Satire, in Grünbeins Übertragung, das Urmuster also der literarischen Großstadtschelte, dem seit seinem Band "Nach den Satiren" (1999) Grünbeins unbedingte Verehrung gehört. Wie beglückend wäre es gewesen, wenn Grünbein, dieser sensible Beobachter, sich auch nur ein wenig von Juvenals Schreibhaltung, seiner tiefen emotionalen Verstricktheit in die Stadt, die Liebe jederzeit in Hass umschlagen lassen kann, hätte zu eigen machen können!
Stattdessen hat er sich dazu entschlossen, Rom gegenüber die Haltung des touristischen Flaneurs einzunehmen - eines Flaneurs freilich, dem es unendlich schwerfällt, "ich" zu sagen, und der es deshalb vorzieht, sich hinter einer objektivierenden Instanz namens "er" oder "wir" oder "man" zu verbergen. Ein neuer, herausfordernder, die Dinge verfremdender Blick, der den Leser die Stadt neu zu sehen lehrt, kann so nicht entstehen. Man liest den Band schon jetzt, im Augenblick seines Erscheinens, so, wie man Gedichtbände von Conrad Ferdinand Meyer oder Paul Heyse liest: als literarisches Bildungserlebnis. Nur dass diese Dichter über ein besser entwickeltes Formbewusstsein verfügten.
Allerdings darf Durs Grünbein beanspruchen, für sein neues Buch den peinlichsten Titel in der reichen Geschichte der Romliteratur gefunden zu haben; er stammt tief aus den Niederungen des Kalauers. Der Dichter war also in Rom ("a Roma") und möchte seinen Lesern nun das "Aroma" der Stadt vermitteln. Man fragt sich verstört, was einen Dichter dieses Ranges zu solchen Scherzen der Halbbildung verführt hat. Man fragt sich dies umso mehr, als dem Band genau das fehlt, was im Titel steht: Aroma, der Zauber des unvermuteten, unverwechselbaren, stimulierenden Dufthauchs, der die Magie dieses einen Ortes aufruft.
Grünbein schreibt in der "Rom im Traum" überschriebenen Nachbemerkung, das "Naheliegendste" (gemeint ist das Nächstliegende) beim Namen Rom seien für ihn die Maronen in Papiertüten gewesen, und fährt fort: "Das Aroma von Rom konnte einem vom Geschmack der Artischocken wachgerufen, vom Anblick der Mimosen, von einer Tasse Cappuccino wiedergeschenkt werden." Aromafreier als solche Sätze, die eine standardisierte Geschmackskultur beschwören, sind allenfalls holländische Tomaten.
Natürlich wird jeder Leser Familie Grünbein den Besuch der "vitrinenbestückten Frühstückskapellen" römischer Bars gönnen. Von deren Aroma aber spürt er kaum einen Hauch, wenn er Sätze wie diesen lesen muss: "Dann ließ man den Löffel im Orangensaft klingeln, spreizte fachmännisch die Finger ab beim Schlürfen des geschäumten Milchkaffees oder des Cappuccino und verbiss sich in ein Hörnchen, Cornetto genannt, dass einem der Puderzucker unter der Nase stäubte." So präsentiert Grünbein die römischen Alltäglichkeiten und Banalitäten, in die er sich verbissen hat, in diesem Buch mit lyrisch abgespreiztem Finger, als handle es sich um Preziosen.
Warum die Gereiztheit des Rezensenten? Weil er von einem Dichter, dem wir Meisterwerke wie "Vom Schnee" (2003) verdanken, formal, gedanklich und in der Intensität der Wahrnehmung Bezwingendes erwarten darf. Hier aber tritt Grünbein auf als "der typische absichtslose Flaneur und Eindrückesammler", der Momentaufnahmen in Vers und Prosa liefert, in denen sich kaum je eine originelle Wendung, kaum je ein bezwingendes Bild findet. Der Band wird eröffnet von einem 53 Stücke umfassenden Zyklus, in dem der Dichter in jeweils (zumeist) sechzehn Versen die Ergebnisse seiner Tagestouren zusammenfasst: "Auf in die Stadt, die so vieles zu bieten hat für das Auge." So absolviert er, den 53 Wochen seines Aufenthalts entsprechend, in der Sprache der Reiseführer sein lyrisches Pensum: "Man biegt aus der Gasse und reibt sich die Augen. Da steht er, / Der einzige Bau, der als ganzer fast unversehrt blieb aus der Zeit, / Da Augustus Rom zur Marmorstadt ausrief." Man reibt sich tatsächlich die Augen: Bei diesem bleichen Bildungsparlando soll es sich um Verse von Durs Grünbein handeln? Und warum überhaupt Verse? Denn bei dieser durch Zeilenbruch versifizierten Prosa ist es im Grunde gleichgültig, ob eine Wahrnehmung oder ein Gedanke in Versform oder in Prosa formuliert wird.
So heißt es, die Raumnot in den römischen Mietshäusern mit einem wenig überzeugenden Vergleich akzentuierend, im achten Gedicht des Zyklus: "Ein Japaner war dieser Mensch der Antike - / Zu Hause in niedrigen Kellergewölben." In einer Folge von Prosaskizzen wiederholt Grünbein diesen Vergleich dann in leicht variierter Form: "Sie waren Japaner, diese kleinen Menschen der Antike, ein Leben lang mussten sie mit wenig Platz vorliebnehmen." Warum ein und derselbe Gedanke einmal in Prosa, das andere Mal als Vers erscheint, erschließt sich nicht. Ohnehin bleibt es dem Leser dieses Bandes ein Rätsel, welche Versauffassung Grünbein hat; ob Vers oder Prosa, hier wie dort herrscht derselbe nachlässige Plauderton.
Immerhin gibt es im letzten, "Tänzerin in Tivoli" überschriebenen Teil des Bandes, in dem vermischte Gedichte italienischen Inhalts versammelt sind, doch einige Texte, die den Leser daran erinnern, welch ein guter Lyriker Grünbein sein kann, wenn er sich nicht auf das Geschäft der poetischen Massenkonfektion verlegt. Ein Vers aus dem Titelgedicht, einem Liebesgedicht von wundersamer poetischer Verhaltenheit, gibt zu erkennen, worauf deren Qualität beruht: "Hier holte ihn das Persönliche ein, das Relative, Intime." Dies Persönliche und Intime kommt in den Versen und in der Prosa von Grünbeins römischem Zeichenbuch entschieden zu kurz. "Und hier nun betrat man die Heiligtümer Pomonas." So schreibt "man" über die Markthallen Roms. Wer aber ist "man"? Emanuel Geibel? Ein wilhelminischer Oberlehrer? Oder nicht doch etwa ein bedeutender deutscher Lyriker der Gegenwart?
Durs Grünbein: "Aroma". Ein römisches Zeichenbuch. Suhrkamp Verlag, Berlin 2010. 184 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Ewige Stadt, unsicheres Terrain: Durs Grünbeins „Aroma. Ein römisches Zeichenbuch“
Das unpersönliche Pronomen „man“ ist ein umtriebiges Wesen. Früher, in antiken Zeiten, tat es einen Schritt aus einem Stadttor „Roms“, und „man war auf dem Dorf“. Dann treibt es sich an einer Strandbar in Ostia herum. „Man ißt frischen Fisch.“ Schließlich, im November, versenkt es sich in einer Bar jenseits des Vatikans in ein Glas Averna: „Man blickt sich um und sucht / Durch den Höllenlärm ein dunkles Augenpaar zum Weiterträumen.“ Ein Jahr verbrachte Durs Grünbein in Rom, und aus diesem Aufenthalt ging ein Buch hervor, das Gedichte über diese Stadt enthält, eine Übersetzung der dritten Satire Juvenals, ein Gruppe von Essays – und wieder eine Sammlung von Gedichten. Aber er meidet das „Ich“, das lyrische, das prosaische wie offenbar auch das persönliche: „Vor einiger Zeit sah man im British Museum in London eine Ausstellung über Kaiser Hadrian“, lautet der erste Satz eines Essays, der vor allem vom souveränen Umgang mit Trümmern antiker Kunstwerke handelt. Wer ist dieser „man“?
Von der humanistischen Bildung, die bis ins frühe zwanzigsten Jahrhundert hinein das höhere Schulwesen in Deutschland prägte, ist wenig erhalten, so wenig, dass das, was sie wusste, immer wieder erklärt werden muss: „Wen zogen sie denn an, die alten Steine / In ihren Stadien des Verfalls?“, fragt der Dichter, „zuerst die Künstler.“ So fern ist die römische Antike gerückt, dass sie offenbar nicht nur erst dem Publikum, sondern auch schon den gelehrten Poeten als etwas Erstaunliches, ja beinahe Esoterisches vorkommt.
Und so streift er durch die die alte, große Stadt und sagt auf, was er sieht, für sich und seine Leser: Und weil das Wissen um die Antike zwar weitgehend verschwunden, der Schatten dieses Wissens, der Echoraum der antiken Tradition aber immer noch da ist – und mit ihm das Bewusstsein, sie kennen zu müssen und es nicht zu tun –, steht der Dichter fasziniert vor diesem Fremden, das zugleich das Eigenste sein soll: als ein poetischer Reiseführer, der Rom und die römische Geschichte um einiges besser kennt als sein Publikum und doch weiß, dass beides ihm nie wirklich geläufig werden wird. Auch wenn er es gern so hätte, und auch wenn er manchmal gern so täte.
Für diese Differenz, für diese existentielle Unsicherheit steht das „man“, weil dieses Wesen eine Allgemeinheit suggeriert, die es nicht haben wird, weil es sie nicht haben kann: Das „man“ spaziert aus dem Stadttor hinaus, isst Fisch und blickt sich um. Es beschäftigt sich mit Juvenal, dem römischen Dichter, der um das hundert nach Christus den römischen Alltag beschrieb, und es ahmt ihn nach, indem er gleichzeitig auf Altertum und Gegenwart, auf antiken Mörtel und auf modernen Asphalt blickt.
Doch der Mensch, der all dies tun könnte, ist nicht da – er ist ein Schemen nur, ein aufgeweckter Repräsentant der Eindrücke und gelehrten Assoziationen, die ihm widerfahren, eine Figur eher als ein lebendiger Geist. „Wer so spricht? Ein Zugereister aus dem Norden“, einer, der die Weltläufigkeit mehr spielt, als dass er sie tatsächlich besäße, und einer, der, weil er doch am liebsten sehr selbstbewusst erschiene, aber es eigentlich nicht ist, ein allzu vertrautes Verhältnis zu Phrasen unterhält: Und so erscheint, wenn von weißer Bettwäsche die Rede sein soll, diese sogleich als „jungfräulich“, und der Zigarettenrauch wird „gekonnt“ durch die Nasen geblasen, und so ist der Titel, den das Buch trägt – „Aroma“ – ein übler Kalauer („a Roma“), ein billiger Triumph des Witzes über die Sache – und immer bleibt da der Verdacht, nein, die Gewissheit, Durs Grünbein habe die übergroße Pose mitgedichtet, sie sei also bewusster Ausdruck eines tiefen Zweifels am eigenen „man“.
Es ist dieser Zweifel, der dieses kleine Buch immer wieder lebendig werden lässt, weil er dafür sorgt, dass im Übermaß der Anrede – an die Stadt Rom, an ihre antiken Bewohner, an die Weltgeschichte und an alles, was in Vers und Prosa hier noch so bedichtet wird – auch das Angesprochene und der Ansprechende erkennbar wird: wie in dem kleinen Vers über den polierten Avertin, „wie Rindfleischscheiben elegant gemasert“, wie bei den Staren, die in den Pinien verrückt spielen, wie die Aurelianische Mauer, die sich rostbraun ins Erdreich „kniet“. Und wenn dann am Ende, in der das Buch abschließenden Phantasie, ein Satz kommt wie dieser: „Rom monumentalisiert alles ein wenig, auch die eigene Vorstellung“, so erkennt der Leser darin das „man“ wieder – den Versuch, sich im Vermessenen einzurichten.
Ein Jahr verbrachte Durs Grünbein, wie so viele andere deutsche Künstler, in Rom, ein Eingeladener und Ausgehaltener, und man merkt dem Dichter an, dass er das Prekäre dieses Aufenthalts – die Pflicht, so viel Freiheit für seine Kunst nutzen zu müssen – durchaus wahrnimmt, als Zwang zum lyrischen Flanieren. Zumindest der erste Teil, das „opus incertum“, (das „unsichere Werk“ oder „römisches Mauerwerk aus Bruchsteinen mit Mörtelguß“) verdankt diesem Zwang seine Struktur, nicht nur, weil er in seiner Chronologie dem Stipendienjahr folgt, sondern auch, weil er den Schriftsteller ausschwärmen lässt zu systematischer Erkundung, immer das Gedicht im Sinn.
Nicht immer geht das gut, denn vom illegal eingewanderten Afrikaner führt so leicht kein Weg zum antiken Gladiator, und wenn der Dichter seine rothaarige Frau bewundert, wenn diese (wozu er selbst das Geschick nicht hat) mit einem Antiquitätenhändler zu feilschen versteht, dann findet der Leser diese Szene nicht nur indiskret, sondern er gewinnt auch den Eindruck, als wäre nun kein Erlebnis mehr vor seiner poetischen Bearbeitung sicher. Es sind aber immer wieder ähnliche Situationen, in denen sich beim Lesen dieser Überdruss einstellt: Ereignisse nämlich, in denen der Dichter seinen Gegenständen zu nahe zu rücken scheint, wenn er alle reflexive Distanz aufzulösen trachtet in seinem Bemühen, sich den Leser zum Vasallen machen.
Einleuchtend aber werden die Gedichte immer dann, wenn der zuweilen allzu redselige Flaneur auf seinen Gängen plötzlich ergriffen wird, wenn ihn, wie Juvenal, die Freude am Berichten davonträgt, wenn er sich selbst in seiner zwiespältigen Rolle wahrnimmt, kurz, wenn es tatsächlich etwas zum Bedenken und Bedichten gibt: die Überraschung etwa, die das Pantheon noch immer (und jedesmal) in sich trägt. „Man schaut auf zur Decke, sucht einen Halt / Unter der Kuppel, die an Bunker und Westwall erinnert mit ihren fünf / Kassettenreihen, konzentrisch geordnet auf dieses rohe Loch hin.“
In solchen Versen ist dann auch das Vorbild Juvenal am deutlichsten gegenwärtig, im Ineinander von Beobachtung und Selbstbeobachtung, im Mitgerissenwerten im Lauf des römischen Lebens. Und das „man“ stört an dieser Stelle nicht. Denn es ist selbst Ausdruck des Bemühens, unter dieser Kuppel, im Sog des Aufwärts, einen Halt zu finden.
THOMAS STEINFELD
DURS GRÜNBEIN: Aroma. Ein römisches Zeichenbuch. Suhrkamp Verlag, Berlin 2010. 184 Seiten, 19,90 Euro.
Es ist der Zweifel an sich
selbst, der dieses kleine Buch immer
wieder lebendig werden lässt
Histrionen von heute: Für Touristen als Legionäre verkleidete Römer. Foto: Alessandro Bianchi/Reuters
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.sz-content.de
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Sehr gern mochte Rezensent Andreas Nentwich diesen in Rom entstandenen Gedichtband von Durs Grünbein. So gut Grünbein dies könne, habe er hier den "Panzer des Bildungsdichters" abgeworfen und auf den Gestus des Staatsdichters verzichtet, freut sich Nentwich, der stattdessen einen unbeschwerten Dichter erlebt hat, der sich durch Rom treiben lässt und pflückt, was ihm am Wegesrand begegnet. 53 langzeilige Gedichte sind dabei herausgekommen, informiert Nentwich, die Übersetzung und essayistische Deutung einer Juvenal-Satire sowie verschiedene, mitunter wild fantasierte Prosastücke. Neben "tollkühnen Analogien" und weit gereister Wortbilder" hat der Rezensent dem Band auch ein interessantes Bekenntnis entnommen: Nur nicht sein wie Horaz, der alles richtig mache und den Grünbein als den "römischen Thomas Mann" bezeichnet.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Mit nichts anderem beschäftigt, als dienstbare Gemeinplätze in seinem Kopf so zu rhythmisieren, dass die tausend Nuancen der 'urbanen Urvibration' in ein bildsättiges Parlando überfließen.« Andreas Nentwich DIE ZEIT 20101014