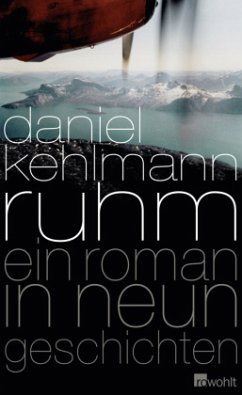Ein Schriftsteller mit der unheilvollen Neigung, Menschen, die ihm nahestehen, zu Literatur zu machen, ein verwirrter Internetblogger, ein Abteilungsleiter mit Doppelleben, ein berühmter Schauspieler, der lieber unbekannt wäre, eine alte Dame auf der Reise in den Tod: Ihre Wege kreuzen sich in einem Geflecht von Episoden zwischen Wirklichkeit und Schein. Ein Spiegelkabinett voll unvorhersehbarer Wendungen - komisch, tiefgründig und elegant erzählt vom Autor der «Vermessung der Welt».
«Ein Buch von funkelnder Intelligenz.» FAZ
«Ruhm strotzt vor Raffinement. Daniel Kehlmann scheint alles zu können.» NZZ
«Daniel Kehlmann hat mit seinem neuen Roman Weltliteratur geschaffen.»
Die Weltwoche
«Verteufelt gut ... brillant ...» NZZ am Sonntag
«Hochintelligent und zugleich ein Lesevergnügen ...» Deutschlandradio Kultur
«Ein literarisches Bravourstück ...» Die Welt
«Das Buch ist eine Wucht - virtuos und witzig geschrieben. Jede einzelne der neun Geschichten ein Diamant.» ZDF heute journal
«Ein Buch von funkelnder Intelligenz.» FAZ
«Ruhm strotzt vor Raffinement. Daniel Kehlmann scheint alles zu können.» NZZ
«Daniel Kehlmann hat mit seinem neuen Roman Weltliteratur geschaffen.»
Die Weltwoche
«Verteufelt gut ... brillant ...» NZZ am Sonntag
«Hochintelligent und zugleich ein Lesevergnügen ...» Deutschlandradio Kultur
«Ein literarisches Bravourstück ...» Die Welt
«Das Buch ist eine Wucht - virtuos und witzig geschrieben. Jede einzelne der neun Geschichten ein Diamant.» ZDF heute journal

Daniel Kehlmanns neuer Roman "Ruhm" ist eine Sammlung postmoderner Muster- und Meistergeschichten. Sie stellen die Frage nach dem letzten Erzähler auf ganz unterschiedliche Arten.
Von Heinrich Detering
Vergessen wir einmal den Welterfolg eines gescheiten und unterhaltsamen Buches namens "Die Vermessung der Welt"; vergessen wir die Reizbarkeit der Kritiker, in deren Vorstellung die Worte "gescheit" und "Welterfolg" nicht zusammenpassen; vergessen wir den Ruhm des Schriftstellers Daniel Kehlmann. Lesen wir stattdessen Leo Richter. "Ein Roman ohne Hauptfigur!" lautet die großartige, wenn auch nicht ganz neue Idee, die dieser so berühmte wie fiktive Schriftsteller seiner Freundin im zweiten Kapitel mitteilt, in eben dem Augenblick, in dem der Leser dieses Buches sich über den plötzlichen Figurenwechsel wundert: "Die Komposition, die Verbindungen, der Bogen, aber kein Protagonist, kein durchgehender Held." Der Dichter ist ein Egomane und Neurotiker, "Autor vertrackter Kurzgeschichten voller Spiegelungen und unerwartbarer Volten von einer leicht sterilen Brillanz".
Was sich aus den neun ineinander verspiegelten Geschichten dieses Buches entwickelt, ist der Roman eines Romans. Es ist ein Buch von funkelnder Intelligenz. Und es besitzt vom ersten Satz an eine Spannung, die unwiderstehlich ist. Im genauen Gegensatz zur eitlen Selbstbespiegelung eines Bestsellerautors, die manche Kritiker vorab befürchteten, entwirft Kehlmanns "Ruhm" das facettierte Bild einer Welt, in der alle Figuren fortwährend versuchen, mehrere Leben zu führen, gleichzeitig oder nacheinander und mit Hilfe des Internets oder des Mobiltelefons, durch die sie jederzeit überall dabei sein und das Geschehen umlenken können. Sie alle leben in den Fiktionen, die sie von sich selbst erfinden und die den Mustern von Büchern, Filmen oder Computerspielen folgen wie mythischen Archetypen. So finden sie sich immer neu verstrickt in Geschichten, die sie selbst produzieren, in die großen Erzählungen wie die alltäglichen Lügen.
Mit dem Läuten eines Telefons beginnt und endet es. Auch zwischendrin ist das bekannte Geräusch oft zu hören, und fast immer geht damit eine Verwirrung und Verschiebung der Wirklichkeitsebenen einher. Das Mobiltelefon, bemerkt eine Figur, "nimmt die Wirklichkeit aus allem". Wer sich seiner bedient, kann jederzeit überall und nirgends sein, es dehnt die virtuellen Räume des Internets aus bis in die Manteltaschen. Da erhält ein Computertechniker unverhofft lauter Anrufe, die einem ganz anderen gelten, so lange, bis er wie von selbst in dessen Leben einzugreifen beginnt. Unerforschlich ist die Ursache, unbekannt der andere - jedenfalls für ihn, den Betroffenen selbst. Wir Leser hingegen erfahren in der vorletzten Geschichte vom Rechnerfehler in der Telefonfirma, von den zuständigen und ihrerseits in diverse Doppelleben verwickelten Sachbearbeitern. Bis dahin haben wir auch den eigentlichen Adressaten jener Anrufe längst kennengelernt, den populären Schauspieler, der nicht nur erlebt, wie sein Telefon von einem Moment zum nächsten verstummt, sondern auch, wie er von der eigenen Kopie in Gestalt eines talentierten Imitators aus seinem Leben gedrängt wird, bis er schließlich befreit ein Dasein verlässt, dessen er ohnehin längst müde geworden ist. Ein Doppelleben führt auch der Mann, der zwischen den Welten der Ehefrau und der Geliebten mittels immer waghalsigerer Handy-Nachrichten balanciert, bis er stirbt - ob buchstäblich oder nur vor Peinlichkeit, das bleibt in der Schwebe. (Erzählt er also aus dem Totenreich oder bloß von nebenan?) Er ist der Vorgesetzte eines Internet-Nerd, der alles dafür geben würde, zur Figur in einer Geschichte von Leo Richter zu werden, und der für das Telefondurcheinander des Anfangs mitverantwortlich ist, das wiederum dazu führt, dass der Verzweifelte, der auf Seite zwanzig einem Wildfremden sein Herz ausschüttet, infolge dieses Telefonats seinem Leben ein Ende setzen wird (wie wir sechzig Seiten später vom eigentlich Gemeinten erfahren). Und so fort.
Und in jeder dieser Szenerien liegt unauffällig eines der Bücher des Erfolgsschriftstellers Miguel Auristos Blancos herum, die nicht nur das Coelho-Genre der tröstlichen Daseinsdeutungen parodieren, sondern einigermaßen zynisch auch die Leitthemen der Storys spiegeln; "Die Wege des Selbst zu seinem Selbst" heißt eines, ein anderes "Frag den Kosmos, er wird sprechen". In seiner eigenen Geschichte - denn auch ihn lernen wir hier ein Kapitel lang als Helden kennen - entsagt dieser Apostel selbst dann dem in seinen Büchern gepredigten Glauben und greift zur Pistole, mehr aus Eitelkeit als aus Verzweiflung - welche Sensation wird der Selbstmord des Sinnverkünders machen! Zuvor aber schreibt er seinen letzten Brief an eine seiner Verehrerinnen. Es ist die Äbtissin des "Klosters zur Heiligen Vorsehung", und um die Frage nach Providenz und Kontingenz geht es ja auch, in dieser wie in jeder Geschichte.
Begriffe wie "Zufall" und "Schicksal" erscheinen unauffällig und leitmotivisch, aber auch Wörter wie "Gnade" oder "Hoffnung"; immer wieder geht es um Schuld und Sühne, Leben und Tod. Von Geschichte zu Geschichte stellt sich so immer vernehmlicher die Grundfrage nach dem letzten Erzähler, diesem über seine Geschöpfe "wachenden höchsten Wesen", das sich, sofern es ein Geschichtenerzähler ist, doch jedes Mal nur "wie ein zweitklassiger Gott" benimmt und von seinen Figuren so beharrlich mit der Theodizeefrage konfrontiert wird, bis er nicht weiterweiß. In ihrer ganzen kunstvoll-amüsanten Komposition lesen sich diese postmodernen Muster- und Meistergeschichten als ein theologisches Experiment.
Im Erzeugen virtueller Welten sind sie alle groß, diese ahnungslosen Bewohner einer gestaffelten Fiktion. Ihre Beziehungen bilden nach und nach ein so unheimlich zwanghaftes und so komisch verzweigtes Netz, dass beim Lesen der Eindruck entsteht, man blicke in eine unabsehbar weitläufige, aus Geschichten gesponnene virtuelle Welt. Es ist eine Welt namens Literatur. Das gilt aber auch umgekehrt: Dies ist eine Literatur namens Welt. Kehlmanns vernetzte Fiktionen münden nicht in den Leerlauf brillierender Virtuosität, sondern in eine ebenso abgründige wie unterhaltsame Reflexion dessen, was wir die Wirklichkeit nennen. Weil hier früher oder später niemand mehr weiß, wo die Grenze zwischen Wahrheit und Lüge verläuft, deshalb kommt jedem irgendwann auch die Sicherheit darüber abhanden, "wer eigentlich ich gerade war und in welchem Irrgarten ich mich verloren hatte".
Wie aber, wenn eine Figur im Ernst aus dieser Welt herausfiele? So geschieht es hier jener Schriftstellerin, die anstelle des überdrüssigen Leo als deutsche Kultur-Repräsentantin ins ferne Mittelasien reist und dort infolge aberwitziger und folgerichtiger Verwicklungen einfach zurückgelassen wird, vergessen in einem Dorf der Provinz und abgeschnitten von jedem Rückweg. Einmal dem Läuten der Nachtglocke gefolgt - es ist niemals gutzumachen.
Kehlmanns short cuts und simple Storys ergeben ein perfekt abschnurrendes Welt-Maschinchen. Zu dieser Perfektion gehört die Entropie. Die Vollkommenheit der Maschinerie zeigt sich erst in ihrem Kollaps, der so raffiniert kalkuliert ist, als habe ihn auch der reale Autor nicht mehr im Griff (der doch gerade damit triumphiert). Dessen verlässliche Werkzeuge sind die kleine Verspätung, das vergessene Aufladegerät, der dumme Zufall. Die eigentliche Finte dieses Buches ergibt sich daraus, dass es am eigenen Text-Leib vormacht, was seinen Figuren widerfährt. So handelt Leo Richters berühmteste Geschichte von der letzten Reise einer todkranken Frau in ein Schweizer Sterbehilfezentrum - und davon, dass der Autor von seiner verzweifelten Figur so lange zur Rechenschaft gezogen wird, bis er nicht mehr widerstehen kann und seufzend umdisponiert. Eine brillante Volte, wieder einmal. Wie kommt es aber, dass Rosalies letzter Weg von einem Chauffeur gekreuzt wird, der seinem Autor bisher unbekannt war und der uns in einem anderen, keineswegs von Leo Richter erzählten Kapitel wiederbegegnet? Gleich ob er ein moderner Charon ist oder gar der Seibeiuns selbst: In ihm nimmt das Unverfügbare Gestalt an. Der Schriftsteller, der wie eine Spinne im Netz zu sitzen glaubt, wird am Ende von diesem Netz verschlungen.
So lässig wie mit Wahn und Wirklichkeit spielt diese Kunst mit ihren Vorbildern. An Salingers "Nine Stories" erinnert schon der Untertitel, Pynchon und Burroughs lassen grüßen, und an Kehlmanns Hausheilige wie Nabokov und Perutz, Thomas Mann und Borges kann sich, wer will, allenthalben erinnert fühlen. Vor allem aber erweist sich Kehlmann mit diesem Roman als ein sehr zeitgemäßer Romantiker, ein philosophischer Geschichtenerzähler aus jenen Zeiten, in denen die romantische Ironie erfunden, das Spiel von Zufall und Notwendigkeit zum Fiktionsprinzip erhoben und Spiegel, Wieder- und Doppelgänger zu Lieblingsmotiven einer Epoche wurden. Man muss nichts von solchen Bezügen bemerken, um dieses Buch mit dem größten Vergnügen zu lesen. Es gibt in der deutschen Gegenwartsliteratur keinen Autor, der eine derart virtuose Beherrschung des Handwerks mit so viel Welt- und Lebensklugheit verbindet und dabei so temporeich und pointensicher, so unverschämt unterhaltsam erzählt.
In der letzten Geschichte hat es den berühmten Schriftsteller aus dem Spiegelkabinett der Referenzen in die Schrecken der wirklichen Welt verschlagen; die Bürgerkriege in Somalia und Jugoslawien blitzen auf. So jedenfalls scheint es. "Dort draußen war der Tod", denkt Leo, "dort war die Wirklichkeit, so grell und schmerzhaft, dass man dafür keine Sätze mehr finden konnte." Er denkt das zwei Seiten vor dem Ende des Textes, der doch noch immer nichts ist als seine eigene Erfindung, miserabel recherchiert, fatal ausgedacht und unentrinnbar bis zum letzten Wort. So weist das "dort" nur noch voraus auf jenen Punkt, an dem die Fiktionen unwiderruflich enden. Die finale Pointe dieses Romans ist das leere Papier, das auf Leos letzten Satz folgt. Für den Leser ist es der Anfang der zweiten Lektüre.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Lothar Müller holt weit aus, um Daniel Kehlmann erst einmal über den grünen Klee zu loben. Kehlmann, findet er, ist ein erstklassiger Autor, wenn er Theorien in Erzählstoffe verwandelt, unterhaltsame Dialoge formt und seine Figuren leichthändig durch haarsträubende Plots schickt. Die neun miteinander verbundenen Erzählungen jedoch, die Kehlmann "auf der Höhe seines Ruhms" vorlegt, fügen sich für Müller nicht zu einem Roman. Laut Müller liegt das daran, dass die hier agierenden Figuren ihrem Autor gegenüber keine Geheimnisse haben und Kehlmann es sich diesmal mit der Theorie (es geht um moderne Kommunikationstechnologien) zu einfach macht. Dabei kann Müller den Texten ganz gut folgen. Zu gut womöglich, denn Charakter kann er bei den Figuren nicht erkennen, und die Verrätselung, vom Autor mit Aufwand betrieben, wie es heißt, verpufft und hinterlässt allenfalls Abwatsch-Figuren und, so Müller, beim Leser leider gerade keine offenen Fragen. So, ohne Dichte oder Atmosphäre, möchte der Rezensent das Buch lieber nicht als bedeutenden Roman bezeichnen. Höchstens als logisch verkettete Geschichten eines um keinen Einfall verlegenen Autors - ohne Dämonen und ohne Abgründe.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Heute erscheint Daniel Kehlmanns neues Buch „Ruhm”. Aber ein Sudoku ist noch kein Roman
Es ist etwas falsch gelaufen in der deutschen Nachkriegsliteratur, sagt der Schriftsteller Daniel Kehlmann in seinen Poetikvorlesungen „Diese sehr ernsten Scherze” (2007): zu viel Realismus, zu viel soziales Engagement, und wenn auf der anderen Seite an den Dadaismus der Vorkriegszeit angeknüpft wurde, dann ließ man den Humor weg und betrieb die Lautpoesie akribisch, als Experiment. In Kehlmanns sehr forschen und sehr belesenen Essays („Wo ist Carlos Montúfar?”, 2005) hilft gegen die Enge der deutschen Literatur und Literaturkritik nur die Orientierung an einem weltliterarischen Dreigestirn: an den Erzählern Südamerikas und ihrer Aufhebung der Grenzen zwischen Traum und Wirklichkeit, an der formbewussten Eleganz Vladimir Nabokovs und an den schwindelerregenden Abenteuern, in die Jorge Luis Borges die Ideen der metaphysischen Tradition und die Formen der Literatur selber verwickelte.
Das bisherige literarische Werk Daniel Kehlmanns, der 1975 in München geboren wurde und in Wien aufwuchs, ist aus dem reformatorischem Ehrgeiz hervorgegangen, den seine Essays formulieren. Mit den Sprachskeptikern und Sprachzertrümmerern, denen die Liebe seiner Lehrer in Schule und Universität galt, hat er so wenig am Hut wie mit den Tiraden und endlos bösen Wortgirlanden Thomas Bernhards. Zu denjenigen unter seinen Generationsgenossen, die noch immer in Familienromanen verschwiegener historischer Schuld nachspüren, steht er in kühler Distanz. Seine Figuren leiden nicht an der Geschichte ihres Landes, sondern an der Unerbittlichkeit des Zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik wie in „Mahlers Zeit” (1999) oder an den paradoxen Problemen der Logik. Zu den Traditionen, die Kehlmann demonstrativ ausschlägt, gehört die Unterwanderung des Romans durch die Autobiographie.
Schon sein Debüt, der Roman „Beerholms Vorstellung” (1997) war am Gegenpol zu allen autobiographischen Coming-of-age-Büchern angesiedelt. Es hatte einen Ich–Erzähler, von dem über seinen Autor wenig zu erfahren war, außer dass dieser seinen Helden mit Lust in die Spiegelkabinette der Magie und Illusionskunst schickte. Und es ließ bereits erkennen, was diesem Autor auch in seinen künftigen Büchern leicht von der Hand gehen sollte. Er ist sehr gut darin, Theorien – nicht zuletzt die fiktiven Theorien fiktiver Theoretiker – in Erzählstoffe zu verwandeln. Und er kann seinen Figuren unterhaltsam pointierte, witzige Dialoge in den Mund legen, während er sie mit leichter Hand durch Plots schickt, die er eigens erfunden hat, um diese Figuren an sich selbst oder der Welt irre werden zu lassen.
Diese Fähigkeiten mögen zu dem Erfolg beigetragen haben, den Kehlmann mit seinem Roman „Die Vermessung der Welt” (2005) hierzulande, aber auch international erzielt hat, dem Buch, in dem Alexander von Humboldt und sein Gefährte Bonpland als komisches Duo vom Schlage Don Quijote und Sancho Pansa die südamerikanischen Gebirge erklimmen, während der Mathematiker Gauß im heimischen Göttingen als übel gelauntes, selbstmordgefährdetes Genie die euklidische Geometrie aus den Angeln hebt: beide, der Reisende Humboldt wie der Mathematiker Gauß, hatten sich in Delirien des Raumes zu verlieren.
So wollte es der Autor Kehlmann, und so gelang es ihm auch bei seinem Spiel mit der Form des historischen Romans. Denn zu seinen Stärken gehört, wie gesagt, die Führung seiner Figuren mit leichter Hand. Jetzt, auf der Höhe seines Ruhms, hat Kehlmann ein Buch veröffentlicht, das den lapidaren Titel „Ruhm” trägt (Rowohlt Verlag, Reinbek 2009. 206 Seiten, 19,80 Euro). Dieses Buch enthält, wie der Untertitel sagt, neun miteinander verzahnte Erzählungen, die insgesamt einen Roman ergeben sollen. Es ist auf bemerkenswerte Weise misslungen. Denn es offenbart, erstens, eine Schwäche dieses Autors, seine Grenze: Er kann keine Figuren erfinden, die ihrem Autor ernsthaften Widerstand entgegensetzen, die ihm gegenüber Geheimnisse bewahren, die er nicht auflösen könnte. Und es gründet, zweitens, seine erzählerische Dramaturgie auf eine Theorie, die es sich mit ihrem Gegenstand, den modernen Kommunikationstechnologien, allzu einfach macht.
Beginnen wir mit dieser unausgereiften Theorie. Sie herrscht schon in der ersten Geschichte, „Stimmen”, in der sich ein Techniker widerwillig, weil alle seine Unerreichbarkeit beklagen, ein Mobiltelefon zulegt und irrtümlich eine Nummer zugeteilt bekommt, die einem berühmten Filmschauspieler gehört. Die Theorie behauptet, dass Handys als Agenten der Ortlosigkeit, der Anonymisierung und der Begünstigung des Identitätsverlustes wirken. Flugs wird so der Techniker, weil ihm Kehlmann eine Stimmenähnlichkeit mit dem Schauspieler zugeschrieben hat, zum Doppelgänger seiner selbst, der in das Leben des Filmstars eingreift, dessen aktuelle Affäre ruiniert, wichtige Termine storniert, einen weniger erfolglosen Kollegen in den Selbstmord treibt.
In der Komplementärgeschichte „Der Ausweg” wird dann der Schauspieler, der plötzlich keine Anrufe mehr erhält, dazu getrieben, anonym als Double seiner selbst aufzutreten, bis aus dem Spiel mit dem Verschwinden ungewollt ernst wird und ihm der Rückweg in seine Starexistenz versperrt ist.
Das läuft wie geschmiert und liest sich schnell weg, aber nur scheinbar zwanglos gehen in diesen ausgeklügelten Geschichten die alten, romantischen Gespenster der Selbstverdoppelung aus der modernen Technik hervor. Denn diese Technik ist, wie nicht nur besorgte Eltern wissen, die ihre Kinder per Handy-Ortung überwachen, ebenso sehr ein Instrument der Identifizierung, der Lokalisierung und Kontrolle wie der Verleugnung und Maskierung der Identität. Spannend werden Geschichten, wie sie Kehlmann wohl vorgeschwebt haben, erst dann, wenn sie diese widerstreitenden Energien gegeneinander antreten und sich in die Quere kommen lassen.
„Wie lange kann so etwas gut gehen?”, fragt sich in der Erzählung „Wie ich log und starb” der Abteilungsleiter einer Telekommunikationsfirma (es ist natürlich die Abteilung, die für die Vergabe der Schauspieler-Nummer an den Techniker verantwortlich ist), nachdem sein Doppelleben zwischen Ehefrau und Geliebter schon seit Monaten unentdeckt ist: „Wie ging das eigentlich früher vor sich? Wie log und betrog man, wie hatte man Affären, wie stahl man sich fort und manipulierte und richtete seine Heimlichkeiten ein ohne die Hilfe hochverfeinerter Technologien?”
Kehlmann hat dieser schlichten Frage des Abteilungsleiters, der das Produkt, das er verkauft, anstaunt, ohne es zu verstehen, in seiner Plotentwicklung wenig voraus. Damit, dass die Technologien der Überwachung und des Misstrauens denen denen des Lügens und Täuschens ebenbürtig sein könnten, rechnet er nicht. Stattdessen erfindet er dem fremdgehenden Abteilungsleiter eine Ehefrau und eine Geliebte, die beide in komischer Arglosigkeit und Vertrauensseligkeit brillieren. Logische, oder wie hier: logistische Unstimmigkeiten und Flachheiten können sich große Romane locker erlauben. Sie verstimmen aber in Büchern wie diesen, eben weil sie die Logistik, der sie folgen, so ostentativ hervorkehren.
Eine Figur setzt sich in einen Zug und landet in einem Tunnel, der die Form eines Albtraums annimmt. Mit diesem Dürrenmatt-Modell schickt Kehlmann seine Figuren gern ins Unheil. In der Geschichte „Osten”, in der eine prominente Kriminalromanschriftstellerin in einem fernen asiatischen Land verschollen geht, nachdem der Akku ihres Handys ausgefallen ist, beherzigt er zudem den Rat Dürrenmatts, eine Geschichte sei erst dann zu Ende erzählt, wenn sie ihre schlimmstmögliche Wendung genommen habe.
Aber das Schlimmstmögliche hat hier wenig Gewicht und wenig Wucht. Denn es stößt Figuren zu, die ihrerseits wenig Gewicht haben. Sie leiden nicht wirklich, sie besitzen keine Schärfe und eigentlich auch keinen Charakter. Das hängt mit der zweiten Schwäche dieses Buches zusammen: Sein großer Aufwand an Verrätselung und Maskenspiel mündet auf paradoxe Weise in die vollkommene Geheimnislosigkeit der dargestellten Welt und ihres Personals. Eine Hauptlast der Verrätselungen hat der Schriftsteller Leo Richter zu tragen, den Kehlmann als eine Art alter ego eigens erfunden hat, damit er das Täuschungs- und Illusionspotential der Literatur vorführt.
Dieser Leo Richter ist als Figur der Lebensuntüchtigkeit, der Verkapselung der Literatur in sich selbst gezeichnet. Er macht in der Geschichte „Gefahr” eine Autorenreise durch Mittelamerika, bei der eine etwas müde Satire auf Goethe-Instituts-Mitarbeiterinnen und Leser abfällt, die dumme Fragen an Autoren stellen. Er ist zudem Autor mindestens einer der neun Geschichten, die in diesem Band versammelt sind. Sie heißt „Rosalie geht sterben”. Darin feilscht am Ende die krebskranke alte Frau, die sich in die Schweiz aufgemacht hat, um mit Hilfe einer einschlägigen Organisation in Zürich ihrem Leben ein Ende zu setzen, es sich aber in letzter Minute anders überlegt, mit ihrem Erfinder Leo Richter um ihr Leben.
Wenn der ihr vorhält, sie sei doch eigens zu dem Zweck erfunden, in den Tod zu gehen, und im übrigen sei sie ja nur fiktiv, oder wenn er sich über eine in der Geschichte auftauchende Figur wundert, die er selber nicht vorgesehen hat, dann liegt die Pointe natürlich darin, dass Leo Richter seinerseits ja nur erfunden ist, von einem Erzähler, der wiederum etc. etc. Es mag sein, dass dieser Leo Richter nur dazu da ist, die ausgelaugten „postmodernen” Spielereien zu parodieren, die immer noch Italo Calvinos Roman „Wenn ein Reisender in einer Winternacht” nachbuchstabieren. Jedenfalls ähnelt die Geliebte, die er auf Erzählebene 1 hat und die auf keinen Fall für seine Literatur benutzt werden will, auf fatale Weise einer seiner Erfolgsfiguren auf der Ebene 2, der Ärztin, die sich in den Krisen- und Katastrophengebieten der Welt nützlich macht.
Wenn in der letzten Geschichte die Erzählebenen 1 und 2 zusammengeführt werden, wird Leo Richter, der seine Rolle als „zweitklassiger Gott” ausgespielt hat, das Buch verlassen. Aber das Ausgelaugte hat da längst schon auf das Buch übergegriffen, das der erstklassige Autor Kehlmann geschrieben hat. Spätestens, seitdem er zusätzlich zu Leo Richter noch einen weiteren eigens dazu erfundenen Autor in den Dienst der Literatursatire stellt: Miguel Auristos Blancos, einen Paolo Coelho ähnelnden Verfasser von Bestsellern, in denen weichgespülte Fragmente aus Philosophie und Religion zur globalen Wellness-Kultur beitragen.
Dieser Auristos Blancos ist, auch wenn er in einem Blackout von Hellsicht seine Wohlfühl-Literatur widerruft, nur eine mäßig interessante Abwatsch-Figur, nicht anders als der Mitarbeiter in der Telekommunikationsfirma, der den Nummerntausch verbockt hat, weil er wieder mal damit beschäftigt war, unter Pseudonym unausgegorene Aufsätze und autobiographische Prosa ins Netz zu stellen. Mehr als eine verkorkste Mutterbeziehung und die Rollenprosa, mit der Kehlmann ihn zu einer Satire auf den Netzjargon nutzt („ich poste viel bei Supermovies, auch bei literatur4you” etc.) hat er nicht zu bieten.
Nein, dies ist kein bedeutendes Buch, kein großer Wurf, bei dem aus neun Geschichten das Ganze eines Romans entsteht. Denn es gelingt ihm nicht, ein Äquivalent für die Ortsbindung und atmosphärische Dichte zu finden, die in einem modernen Klassiker des Genres wie Sherwood Andersons „Winesburg, Ohio” (1919) die disparaten Erzählungen und Figuren zusammenschließt. Es bleibt in „Ruhm” bei der logischen Verknüpfung der Geschichten: was der Figur in einer Geschichte widerfährt, erhält in einer späteren seinen Ort in der Kausalkette der Ereignisse oder umgekehrt. Der Verstand des Lesers mag seinen Spaß dabei haben, die Rätsel aufzulösen, die ihm dieses Buch aufgibt. Verlässlich arbeitet darin die leichte Hand eines Erzählers, der nie um einen Einfall und eine überraschende Wendung verlegen ist. Die Dämonen aber, die Abgründe und Alpträume, die es zu enthalten behauptet, enthält dieses Buch nicht. Ihm misslingt, was derzeit im deutschen Kino Christian Petzold gelingt, von „Wolfsburg” über „Yella” bis „Jerichow”: Gespenstergeschichten zu erzählen, die auf dem technologischen Niveau der Gegenwart angesiedelt und Figuren des deutschen Alltags in Schrecksekunden bannen. LOTHAR MÜLLER
Unstimmigkeiten können sich große Romane erlauben. Sie verstimmen in Büchern wie diesem
Verrätselung und Maskenspiel münden auf paradoxe Weise in vollkommener Geheimnislosigkeit
Herr über alle Geheimnisse, die seine Figuren in sich tragen: Daniel Kehlmann Foto: Peter Rigaud/laif
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.sz-content.de
Was Rezensent Dirk Knipphals diesem neuen Roman von Daniel Kehlmann positiv anrechnet, ist das "Spieler- und Zockerhafte seines Schreibansatzes". Absolut verständlich und sympathisch ist ihm, dass Kehlmann nicht an das erzählerische Erfolgrezept seines Megaweltbestseller "Die Vermessung der Welt" anknüpft, um nicht, so deutet es Knipphals zumindest, Zeit seines Lebens auf einen Roman reduziert zu werden. Als Plus verbucht Knipphals auch die Fähigkeit zum Kabinettstückchen, wobei er dies schon einschränken muss, um dann zu den Negativa zu kommen: Die Kabinettstückchen funktionieren, meint Knipphals, vor allem Kosten der eigenen Figuren. Einen solchen Witz findet Knipphals billig. Zur schlechten Laune des Rezensenten haben des weiteren vordergründige Konstruktionen, oberflächliche Figurenzeichnungen sowie die Schurigelei des Lesers gesorgt. Und ganz schlimme Sexszenen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Ein Buch von funkelnder Intelligenz. FAZ