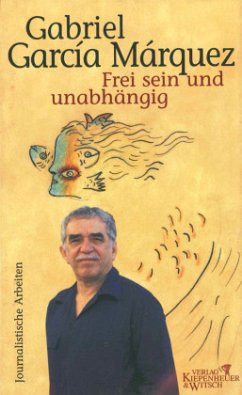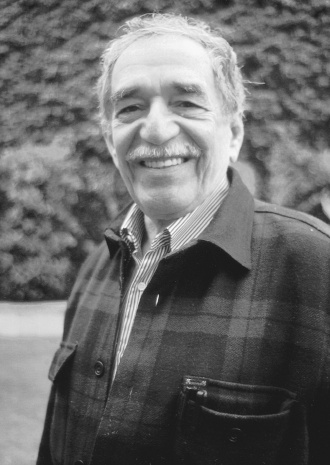Gabriel García Márquez ist nicht nur ein großer Romancier, sondern auch ein bedeutender Journalist und Reporter. Brillant geschrieben und fundiert recherchiert, belegen dies aufs Neue die vorliegenden Arbeiten, die sich wie eine bewegende Chronik einschneidender politischer und gesellschaftlicher Ereignisse der letzten 25 Jahre lesen.

Aus der Sammelmappe des Reporters Gabriel García Márquez
Antiquarisch orientierte Andacht hat diese Sammlung zustande gebracht, ungnädiges Vergessen wird ihr bestimmt sein. Sie enthält auf lange Strecken politische Artikel von García Márquez, deren Entstehungssituation nur noch mit einem ausführlichen Anmerkungsapparat rekonstruierbar wäre. Und die Texte sind mit ihrer notorischen Solidarität, etwa für Fidel Castro, und der holzschnittartigen Verachtung für die Gringos aus den USA überwiegend auf einen dürren Begriffsrahmen gespannt.
So erscheint wenigstens die Hälfte dieser ideologischen Überzeugungsschriften eher als Beleg für die einstigen Selbsttäuschungen eines rhetorischen Revolutionsarmisten denn als journalistische Zeugnisse, die über den Tag hinweg zu retten wären. Gepriesen wird an Fidel Castro „die Schwäche seines kindlichen Herzens”, ausgerechnet sein Kampf gegen den Personenkult, seine Redlichkeit, die „Zuneigung” des Volkes. Man muss nur einen Blick in das Staatsorgan, die Granma, werfen, um im Alltag das Dementi für die Prognose zu finden: „Die sozialistische Presse wird fröhlich und originell sein. ” Über Cuba finden sich in dieser Sammlung die meisten kapitalen Irrtümer, aber auch die, die García Márquez über das Angola der sozialistischen MPLA unter dem Präsidenten Agostinho Neto ausbreitet, grenzen an Desinformation aus Gläubigkeit.
Nach der Hälfte des Buches möchte man, von einer Reportage über den ersten Besuch in Havanna nach dem Sieg Castros 1959 abgesehen, nicht glauben, dass „Gabo” auch als Reporter Weltruhm genießt. Zu simpel ist sein lateinamerikanischer Patriotismus, da er sich mit den größten und den flachsten Wörter begnügt. Auf die erste Hälfte des Buches könnte man ganz verzichten. Erst mit seiner Chronik des gloriosen Befreiungscoups, den 1978 ein kleiner Trupp sandinistischer Guerilleros in Somozas Nationalpalast wagte, setzt der Journalist auf exakte Rekonstruktion, die Kraft von bizarren Einzelheiten, den Aberwitz von Situationen. Keinesfalls missen möchte man den panoramaartigen Bericht über das zerstörte Vietnam nach dem Abzug der Amerikaner und die detektivische Rekonstruktion des rätselhaften Verschwindens von Bateman, einem kolumbianischen Guerilleroführer, der aufbrach, um in Panama Friedensgespräche zu führen und nie dort angekommen ist. Wenigstens interessant sind auch die vielen anderen Seiten, die dem zwischen Militärs, den Drogenbossen und der politischen Guerilla zerrissenen Kolumbien gewidmet sind: In seinem Heimatland kann ihm niemand etwas vormachen, dort hat sich „Gabo” mit Vermittlungsbemühungen verdient gemacht.
Ein Versprechen sind die Partien, die aus der Autobiografie von García Márquez stammen: Amüsierte Ironie und ein melancholischer Witz bewährten sich beim Papstbesuch und bei einem Abendessen mit Felipe González kurz vor seinem Rücktritt. Diese Memoiren erst werden wieder bestätigen, was der Reporter García Márquez als seine Devise ausgegeben hat: Der Leser müsse das Gefühl haben, „selbst am Schauplatz der Ereignisse zu sein. ”
WILFRIED F. SCHOELLER
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ: Frei sein und unabhängig. Journalistische Arbeiten 1974 – 1995. Aus dem Spanischen von Svenja Becker, Astrid Böhringer, Christian Hansen und Dagmar Ploetz. Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2000. 390 Seiten, 45 Mark.
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.diz-muenchen.de

Mit einigen Koffern voller Ideologie auf Reisen: Die journalistischen Arbeiten von Gabriel García Márquez / Von Richard Swartz
In meinen ersten Jahren als Journalist hatte ich einen alten englischen Lehrer. Auf die Frage, welchen Beruf er habe, pflegte er zu antworten: "Ich bin Reporter. Ich schreibe hin, was ich mit eigenen Augen und Ohren sehe und höre." Mehr gab es dazu nicht zu sagen. Ich war Anfänger und hielt diesen Satz für eine gute Definition. Ein Reporter soll vor Ort sein. Vor allem anderen ist er Zeuge, in der ursprünglichsten Bedeutung dieses Wortes - ein Zeuge, der uns unter glücklichen Umständen ein freihändig formuliertes Protokoll der laufenden Ereignisse geben kann, umfassend und genau genug, daß es einer zukünftigen Geschichtsschreibung als Quelle dienen kann. Es ist ein Triumph des Journalismus, wenn der Reporter sagen kann, daß der Minister nicht zur Rechten, sondern zur Linken des Königs gestanden habe - auch wenn alle anderen das Gegenteil behaupten. Er hatte es mit eigenen Augen gesehen. Wenn ich mir heute wieder die Artikel meines Lehrers ansehe, die ich ausgeschnitten habe und die nun längst vergilbt sind, dann erkenne ich diese Qualität wieder: die Genauigkeit und Hellhörigkeit, die nur durch physische Gegenwart zu erlangen ist.
Und doch schaue ich nicht oft in diese Mappen. Ich habe das Gefühl, daß diesen Artikeln etwas fehlt, und weil dort etwas fehlt, wird die Lektüre der ausgeschnittenen Artikel zu einer tristen Beschäftigung. Aber was ist es, was da fehlt?
Vor kurzem ist auf deutsch ein Band mit Reportagen von Gabriel García Márquez erschienen, die zwischen 1974 und 1995 entstanden sind. Der Dichter Gabriel García Márquez hatte als Journalist begonnen und ist danach immer wieder aus der schönen Literatur in den Journalismus zurückgekehrt. Tatsächlich ist es ja oft nicht einfach, die Grenze zwischen der Literatur und dem Journalismus zu ziehen - und meistens ist es nicht einmal interessant. Im Fall von García Márquez sind die Verhältnisse jedoch noch schwieriger: Worin in den journalistischen Arbeiten das Journalistische liegen soll, ist nicht leicht zu ermitteln; Régis Debray hat sie einmal in einem Gespräch mit García Márquez als "journalistische Essays" bezeichnet, womit er verdeutlichen wollte, in welchem Maße diese Artikel als "zeitgebunden", "vergänglich", ja als "unmittelbar nützliche Politik" zu verstehen waren - und das trug Régis Debray mit allem Respekt vor, ohne daß García Márquez dagegen protestiert hätte. Ich frage mich, ob nicht dieses politisch Nützliche als der Schlüssel zu den journalistischen Texten von García Márquez anzusehen ist.
Fast alle handeln sie von Lateinamerika, von Chile, Kolumbien oder Nicaragua - und immer wieder von Kuba. Und Fidel Castro erscheint immer wieder, wie ein Wasserzeichen. Geschichten aus dem Portugal der Revolution, aus dem freien Angola oder aus Vietnam sind gelegentliche Ausflüge, in denen aber Castro und der amerikanische Imperialismus nie weit entfernt ist. Von Anfang weiß der Leser, daß dieser Autor von der Notwendigkeit des Sozialismus und der Revolution überzeugt ist.
Der Reporter García Márquez hat seine besten Momente - und diese treten um so eher ein, je weiter er von Lateinamerika entfernt ist -, wenn er mit einigen impressionistisch vorgetragenen Beobachtungen eine Stimmung oder eine Situation festhält. In Portugal bemerkt er, daß während der Revolution niemand die Zeit zum Schlafen findet, daß die neuen Minister ihre Besucher um zwei Uhr morgens empfangen. Doch gehören solche kühlen Beobachtungen zu den Ausnahmen - viel öfter schreibt er hin, was ihm die Minister mitzuteilen haben. Er vergißt, daß er selbst Augen und Ohren hat, weil er beschäftigt ist zu notieren, was der Leser genausogut in einer politischen Broschüre finden kann.
Gabriel García Márquez ist ebenso fleißig, wie er bei der Vorbereitung seiner Reportagen genau ist. Er hat seine Themen studiert. Mit der Energie eines Autodidakten hat er Informationen und Dokumente gesammelt - eine selten gewordene Tugend unter heutigen Journalisten. Manchmal fragt sich der Leser aber auch, wie García Márquez mit seinen Quellen umgeht. Wie kann er wissen, was Henry Kissinger oder chilenische Generäle in privaten Gesprächen sagen? In seinen Reportagen werden ihre Sätze als wortgenaue Zitate wiedergegeben. Noch störender ist es, daß diese Reportagen offenbar nur durch ein Minimum an physischer Gegenwart zustandegekommen sind. Selten scheint er den Tisch im Restaurant oder das Ministerium zu verlassen, und fast nie begibt er sich auf die andere Seite, um eine entgegengesetzte Meinung zu hören. Vielleicht ist es dieses Verfahren, das Régis Debray mit dem Ausdruck "journalistische Essayistik" gemeint hat - und das der Grund dafür ist, daß man sich nach der Lektüre an keinen Menschen aus Fleisch und Blut erinnert, nur an eine rechthaberische Indignation.
Nun sind richtig und falsch keine journalistischen Kategorien. Ein Reporter ist weder Astrologe noch Moralist. Weder Augen noch Ohren - genausowenig wie ein anderes Sinnesorgan - helfen uns, etwas Definitives über die Gerechtigkeit oder die Zukunft zu sagen. Doch genau dieses tut García Márquez, und sein Organ dafür ist die Ideologie. Schon bevor er anfängt zu schreiben, hat er sich für eine Seite entschieden: Er ist Sozialist und Revolutionär. Wie bei Ilja Ehrenburg oder John Reed wird sein Journalismus von didaktischen oder sogar propagandistischen Absichten getragen.
Am deutlichsten wird diese Absicht im Fall Kuba. Im Lauf der Jahre hat er die Insel oft besucht, mehrfach wurde er vom Maximo Leader persönlich empfangen. Diese Besuche führen zu Texten, die in ihrer Verbindung zwischer einer Gutgläubigkeit, die einem Candide angestanden hätte, und einem flinken Lust am Abenteuer an ein Jugendbuch erinnern. Mitte der siebziger Jahre reist er sechs Wochen lang mit seinem sechzehnjährigen Sohn kreuz und quer durch das Land, "in dem nichts von Interesse unerforscht" bleiben soll - aber nicht in einem Bus oder auf der Ladefläche eines Lastwagens wie die Kubaner, sondern in einer Limousine mit Chauffeur und Reiseführer. Am Ende der Tour erklärt er, daß in Kuba "eine neue Moral" entsteht und daß jeder Kubaner mit gutem Grund davon überzeugt ist, daß die Revolution unter Castros Führung "zu ihrem glücklichen Ende" kommen werde.
Die Voraussetzungen der eigenen Reise läßt er indessen unerforscht: freies Auto, Chauffeur, persönlicher Reiseführer - jeder Reporter von einiger Erfahrung mit autoritären Regimes kennt die problematische Lage, die oft mehr Einblick in eine Gesellschaft gewährt, als die Wirte einem zeigen wollen. Ich bin Chauffeuren begegnet, die "ihr" Auto wie einen Esel behandelten, und anderen, die jede Pause wahrnahmen, um das Fahrzeug blitzblank zu polieren; Chauffeuren, die es in Gegenwart von Zeugen nicht wagten, eine Zigarette vom Klassenfeind anzunehmen, Reiseführern, die mir nach einer Woche Vertrauliches ins Ohr flüsterten, anderen, die mir am letzten Tag weinend bekannten, daß sie nun meine politische Haltung der Polizei verraten müßten. Möglicherweise geschieht so etwas nicht auf Kuba - ich bin nie dort gewesen -, aber ich bezweifle es. Und deshalb fürchte ich, daß es die Ideologie ist, die ihm einen Streich spielt, daß er eine Schablone im Gepäck trägt, daß er deswegen immer wieder Wörter wie "dynamisch" oder "Komplott" benutzt - und solche Wendungen wie: "Es ist jedoch sicher kein Zufall, daß . . ."
Und doch bleibt García Márquez ein Dichter, auch wenn er Schindluder mit sich selber treibt. Es ist, als ahne er die Beschränkung durch die ideologische Schablone. Wie viele andere Autoren, die sich im selben Dilemma befanden, flieht er daher ins Konkrete. Der Wirklichkeit werden feste Konture verliehen, und dieser Einschlag von Handgreiflichkeit ist vermutlich ebensosehr eine Bestätigung der einen Ideologie, die die ganze Welt erklären soll, wie er eine Technik ist, sich gegen ihre leeren Phrasen zu wehren. Aber diese Spaltung ist gefährlich, sie führt in endlose Bestandsaufnahmen und Zahlenhaufen. Der junge Egon Erwin Kisch ist ein brillanter Reporter, während sich der kommunistische Reporter Kisch schwerhörig und halbblind an Tatsachen klammert, als sei er ein Buchhalter. Ein talentierter Reporter spart aus, um das Wesentliche sagen zu können, während der ideologische Reporter nichts ausläßt aus Sorge, daß ihm jemand widerspricht.
Doch für den Leser werden solche Texte schnell langweilig. Diese Verbindung von Phrase und Aufzählung ist ermüdend, ihre Ästhetik ist entstellend. Denn was hier fehlt, ist nicht nur Sinnlichkeit, sondern die besondere Schönheit, die nur entstehen kann, wenn nichts im voraus festgelegt wird, wenn sich der Reporter trotz aller Vorbereitungen auf einen Irrtum einläßt, wenn er ins Schlingern gerät oder in einer Sachgasse endet - und bereit ist, dieses Scheitern offenzulegen. Dann kann sich der Journalismus, der "zeitgebundende" und "vergängliche" Text, in etwas verwandeln, das in der Literatur selten eine Stärke ist.
Mein alter englischer Lehrer war immer vor Ort gewesen, und doch hatte er diese Art von voraussetzunglos reflektierenden Texten nicht schreiben können, obwohl ihn keine Ideologie daran gehindert hätte. Dazu reichte sein Talent nicht aus. Was in den vergilbenden Textausschnitten fehlt, ist eben die Nachdenklichkeit und die Schönheit, und im Grunde stehen die Dinge in den journalistischen Arbeiten von García Márquez nicht viel anders. Und doch ist dieser ein bedeutender Dichter, und mit einem der Texte der vorliegenden Auswahl erinnert er uns daran.
Der Text ist kurz. Er handelt nicht von der Notwendigkeit des Sozialismus, sondern vom Knopf eines Jacketts. García Márquez verliert ihn während einer zehnminütigen Audienz im Vatikan, in dessen "erstarrter Atmosphäre von Gott nichts zu spüren (war), dafür aber spürte man die Macht seines Stellvertreters". Alles geht schief. García Márquez verliert fünf von seinen zehn Minuten mit höflichen Fragen, die dem Papst nur die Gelegenheit geben, sein Spanisch zu üben. Und dann dieses Mißgeschick! Es ist schwierig, sich eine weniger passende Gelegenheit auszudenken, um einen Knopf zu verlieren - doch da rollt er über den Fußboden und verschwindet unter dem Schreibtisch des Heiligen Vaters. Gottes polnischer Stellvertreter auf Erden sieht ihn zuerst und García Márquez beeilt sich, um ihn aufzuheben. Im selben Augenblick ist die Audienz zu Ende. Ein Glocke ertönt. Der Knopf ist aus Metall. Gerne hätte ich mehr darüber erfahren.
Gabriel García Márquez: "Frei sein und unabhängig". Journalistische Arbeiten 1974 - 1995. Aus dem Spanischen übersetzt von Svenja Becker, Astrid Böhringer, Christian Hansen und Dagmar Ploetz. Kiepenheuer & Witsch Verlag, Köln 2000. 389 S., geb., 45,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Wilfried Schoeller beginnt seine Kritik mit einem Verriss und endet mit Bewunderung. Zumindest der erste Teil dieser Sammlung von Reportagen geht ihm aber gewaltig auf die Nerven: die Lobhudeleien auf Castro etwa - Marquez preist ihn "ausgerechnet" für seinen Kampf gegen den Personenkult - und die "holzschnittartige Verachtung" für die US-Amerikaner. Dann scheint es aber besser zu werden: den "panoramaartigen Bericht" über Vietnam nach dem Abzug der Amerikaner möchte der Rezensent "keinesfalls missen", und auch die Reportagen über den Regierungssturz der Somozas oder das rätselhafte Verschwindens eines kolumbianischen Guerilloführers haben Schoeller gut gefallen. Hier setze Marquez auf "exakte Rekonstruktion" und die "Kraft von bizarren Einzelheiten".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Der Virtuose des Konkreten« Dieter E. Zimmer Die Zeit