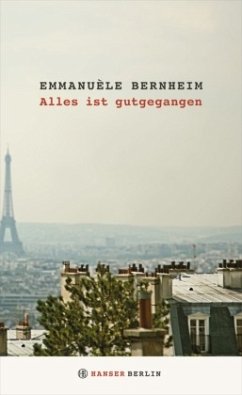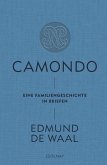"Die Diagnose ist nicht berauschend." 88-jährig erleidet André Bernheim, Kunstsammler in Paris, schillernd, charmant, vital, einen schweren Schlaganfall. Nichts, was sein Leben ausmachte, ist ihm nun mehr geblieben, und so bittet er seine Tochter, ihm den Freitod zu ermöglichen. Mit literarischer Intensität, dicht und präzise, erzählt Emmanuèle Bernheim, welche unendliche Zumutung dies für die Familie ist, wie sie sich trotz unauflösbarer Gewissenskonflikte gemeinsam auf den Tod zubewegt. Mit großer Offenheit spricht sie über eine der letzten tabuisierten Fragen unserer Zeit und eine sehr persönliche Entscheidung - sie berührt damit jeden von uns. Ein großes Buch über das Glück des Lebens und die Freiheit zu sterben.

Was tun, wenn einen der eigene Vater fragt, ob man ihm beim Sterben helfen könne: der französischen Schriftstellerin Emmanuèle Bernheim ist genau dies passiert
Ende November checkte ein altes Ehepaar im Pariser Hotel "Lutetia" ein, das sehr schön im sechsten Arrondissement gelegen ist und als besonders romantisch gilt. Am nächsten Morgen wurden die beiden in ihrem Zimmer tot aufgefunden, Hand in Hand, ihre Körper waren noch warm, beide hatten eine Plastiktüte über ihrem Kopf. In einem Abschiedsbrief erklärten sie, das Gesetz verwehre ihnen Zugang zu Medikamenten, die ihnen den Weg in den Tod erleichtern würden - sie seien deshalb gezwungen, diese grausame Methode anzuwenden.
Emmanuèle Bernheim, 58, erzählt mir von dieser Geschichte, über die sie in der Zeitung gelesen hat. Sie hat ihre eigene Erfahrung damit gemacht, wie kompliziert es sein kann, wenn ein alter Mensch beschließt, nicht mehr weiterleben zu wollen. Ihr Buch "Alles ist gutgegangen", das jetzt auf Deutsch erscheint, handelt vom Selbstmord ihres Vaters - und liest sich komischer, rasanter und spannender, als man bei diesem Thema meinen sollte.
Emmanuèle Bernheim hat lange fürs französische Fernsehen als Script-Doctor gearbeitet, als jemand also, der bei einem Drehbuch sofort die Schwachstellen findet und weiß, wie man sie repariert. Sie hat zusammen mit Michel Houellebecq dessen Roman "Plattform" fürs Kino adaptiert (der Film wurde letztlich nie realisiert) und zusammen mit François Ozon mehrere Drehbücher geschrieben, etwa zu dessen Filmen "Unter dem Sand" oder "Swimmingpool". Keine Überraschung also, dass diese Autorin etwas von Rhythmus versteht und so zu schreiben weiß, dass ein Weglegen des Buchs, nachdem man einmal zu lesen begonnen hat, schwerfällt. Sie hat bereits mehrere Romane veröffentlicht - dies ist das erste Mal, dass sie etwas in der ersten Person Singular schreibt.
"Ich hatte ehrlich gesagt überhaupt keine Lust, von mir zu erzählen", sagt sie, als sie mich in ihrer großen, hellen Wohnung in der Nähe des Jardin des Tuileries in Paris empfängt. "Ich wollte erzählen, was meinem Vater passiert ist, und es ist mir sehr schwer gefallen anfangs, die richtige Distanz zu finden. Zuerst habe ich versucht, nur die Fakten aufzuschreiben. Also: Am 27. September 2008 hatte mein Vater einen schweren Schlaganfall. Seine rechte Seite war dadurch gelähmt. Am darauffolgenden Tag etc. Es war entsetzlich langweilig. Beim Schreiben gibt es immer einen gewissen Grad der Erregung, selbst bei einem solchen Thema müsste das so sein. Aber ich schrieb und schrieb und: nichts. Ich konnte mich am Morgen kaum an den Schreibtisch bekommen. Ich dachte, vielleicht liegt es am Thema. Aber dann kam ich darauf, dass es etwas anderes war. Es hat mich ganz einfach angekotzt. Ich hatte die Form nicht gefunden. Und dann hab' ich mir gesagt: Erzähl es halt einfach, wie du einen Roman erzählen würdest. Es braucht eine Dynamik, es braucht Bewegung. Also dachte ich, na was soll's, fange ich eben mit mir an. Und so beginnt die Geschichte jetzt also damit, wie ich diesen Anruf entgegennehme, dass meinem Vater etwas passiert ist, wie ich die Treppen runterlaufe, meine Kontaktlinsen vergesse . . . Und sofort klang es wie ein Roman. Ich hatte nicht verstanden, warum eine Geschichte, die ich so intensiv erlebt hatte, so langweilig sein konnte. Auf einmal hatte ich den Ton."
Die Autorin erhält also einen Anruf - und rast los. Wir folgen ihr in die Métro. Die Sätze sind kurz und schnörkellos. Es geht sehr sachlich zu. Da sind viele Details, Handgriffe, Informationen - gepaart mit einem Gefühl höchsten Unbehagens, ja vielleicht sogar Angst. Dies steht so nicht im Text, der niemals, an keiner Stelle psychologisiert, sondern stets nur schildert, was auch eine Kamera einfangen könnte - doch alles, was die Icherzählerin tut und erlebt, deutet darauf hin: Immer wieder kontrolliert sie ihr Handy, schlägt sich bei einem plötzlichen Bremsen die Nase hart an der Scheibe an, schwitzt. Ihr ist flau im Magen, und sie erinnert sich daran, wie ihr als Kind immer schlecht wurde, wenn sie im Auto die Karte zu lesen versuchte, während der Vater fuhr. Und wie dieser sie, viel später, nach ihrem ersten Fernsehauftritt anrief, ihr gratulierte und anbot, wenn sie sich je die Nase operieren ließe, würde er gerne dafür aufkommen. Dergestalt vorbereitet kommen wir schließlich in der Notaufnahme des Krankenhauses an.
In den folgenden Wochen muss sich die Autorin mit lauter neuen medizinischen Fachausdrücken bekanntmachen. Dysphagie. Hemiparese. Ataxie. Ischämie. Hemiplegie rechts. Ihr Vater wird von einem Krankenhaus ins nächste verlegt, hört auf zu essen, ist deprimiert. Seine rechte Körperhälfte bleibt gelähmt, wenn er etwas sagt, ist es kaum zu verstehen. Und eines Tages bittet er sie, ihm dabei zu helfen, "Schluss zu machen". So drückt er sich aus. Und "noch nie seit seinem Schlaganfall hat er so deutlich gesprochen", heißt es im Buch. Und "Mein Vater lächelte mich an. Ein richtiges Lächeln, ein Lächeln wie früher, mit strahlenden Augen und Lachfältchen rundherum." Wir sind jetzt auf Seite 46 von 200 Seiten, und ab jetzt geht die eigentliche Handlung los, die mitunter so abstrus ist, dass die Autorin sie nur mit Antidepressiva, Weißwein und Schlaftabletten durchsteht.
"Wenn einen jemand fragt, ob man ihm bei der Selbsttötung hilft: Was macht man dann? Wie geht das?", sagt Emmanuèle Bernheim. "Das dauert, bis man das überhaupt erst einmal begreift. Und dann kommen lauter Schritte, die absolut absurd sind. Irgendwann legt man zum Beispiel ein Datum fest, man legt den Tag fest, an dem der eigene Vater sterben wird. Man nimmt seinen Kalender, blättert, sagt, Nein, da geht es nicht, da ist das Filmfestival in Cannes . . . aber wie wäre zum Beispiel Anfang April? Das ist so irreal, dass ich nicht verstanden hätte, was eigentlich passiert ist, hätte ich es nicht aufgeschrieben. Dieses Buch, das war mein Trauern."
Von einer Bekannten erhielt Emmanuèle Bernheim die Nummer einer Schweizer Gesellschaft für Sterbehilfe, und da ihr Vater deren Voraussetzungen erfüllte (unter anderem: Sterbewunsch bei klarem Verstand formulieren; Gift selbständig einnehmen), wurde man sich einig. Ideal erschien Bernheim die Lösung nicht, denn wer will zum Sterben schon extra verreisen, aber die französische Gesetzgebung ist so kompliziert wie die deutsche, was Beihilfe zum Selbstmord angeht beziehungsweise die Beschaffung von notwendigen Medikamenten, insofern war die Schweiz noch die eleganteste Wahl.
Bis es so weit war, sollte allerdings noch so ziemlich alles schiefgehen, was überhaupt schiefgehen konnte. So verriet jemand ihren Plan der Polizei, die sie daraufhin am Vorabend des Sterbetermins stundenlang verhörte - und alles beinahe in letzter Sekunde gekippt hätte, wären die Autorin und ihre Schwester nicht wie durch ein Wunder an eine Polizistin geraten, die in ihrer Familie Ähnliches erlebt hatte. "Tun Sie, was Ihr Herz Ihnen rät" - mit diesen Worten entlässt sie die Schwestern aus dem Revier.
Es wäre natürlich ein ziemlich trauriges Buch, wenn es nur vom Tod handeln würde. Doch "Alles ist gutgegangen" erzählt vor allem eben von André Bernheim (1920 bis 2008), und der scheint ein besonders lebendiger Mann gewesen zu sein. Er konnte ebenso verletzend sein wie charmant, hungerte stets nach Neuigkeiten aus dem Pariser Kulturleben, aß gerne gut, lebte mit seiner Ehefrau zusammen, der Mutter seiner beiden Töchter, liebte aber Männer, darunter auch zweifelhaftere Charaktere wie einen gewissen G. M., der ihn schon mal verprügelte. Zeitgenössische Kunst sammelte er so leidenschaftlich, dass viele es für seinen Beruf hielten. Er hatte einen handfesten, wenn auch ziemlich boshaften Humor sowie die für ihn selbst bestimmt sehr praktische Eigenschaft, niemals an andere zu denken, sondern immer nur an sich. So sei es ihm auch nie in den Sinn gekommen, erzählt Emmanuèle Bernheim, dass er seinen Töchtern mit seiner Bitte, ihm beim Sterben zu helfen, ganz schön viel abverlangte.
"Ich wollte meinem Vater nicht zu sehr eine Hommage schreiben, denn er hatte doch ganz schön viele Fehler. Ich wollte ihm gerecht werden, und ich wollte nicht langweilen, denn er war nicht langweilig. Ich wollte unser Abenteuer - denn es war eines - erzählen wie einen Krimi. Bis zur letzten Sekunde wusste ich nicht, wie es ausgehen würde." Es ist dann alles gutgegangen.
JOHANNA ADORJÁN
Emmanuèle Bernheim: "Alles ist gutgegangen". Aus dem Französischen von Angela Sanmann. Erscheint am Montag bei Hanser Berlin. 206 Seiten, 18,90 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Emmanuèle Bernheim erzählt in "Alles ist gutgegangen" von den letzten Lebensmonaten ihres Vaters, der nach einem Schlaganfall seine Töchter gebeten hatte, ihn in die Schweiz zu bringen, damit er seinem Leben in einer der dortigen Kliniken ein Ende setzen kann, berichtet Gabriele von Arnim. Dabei schwanken die Passagen zwischen dramatischer Innenschau, ausgewachsener Kriminalgeschichte samt Polizei - Auslandsreisen zu Selbstmordzwecken sind für die französische Justiz ein heikles Thema, lernt die Rezensentin - und kleinen alltäglichen Details, wie der Frage, wie der Ordner für die Unterlagen beschriftet werden soll und welche Farbe wohl angemessen wäre, fasst von Arnim zusammen. Gerade diese "Nebengleise" findet die Rezensentin aber besonders wichtig, weil sie das Buch vor der Melodramatik retten, die das Thema sonst all zu schnell aufkommen lässt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Emmanuèle Bernheims vieldiskutiertes Buch berichtet ohne jede Wertung,
wie sie ihrem Vater zu einem selbstbestimmten Sterben verhalf
VON JOSEPH HANIMANN
Zwischen förmlicher Steifheit, forciertem Humor und schlichter Peinlichkeit bleibt wenig Raum für einen persönlichen Zugang zu diesem schwierigen Thema. Wer es trotzdem versucht, der muss sich zurücknehmen, die Fakten sprechen lassen, persönliche Empfindungen bereitwillig, aber behutsam zulassen und keinerlei endgültige Wahrheiten behaupten wollen. Genau dies unternimmt die französische Autorin Emmanuèle Bernheim recht überzeugend in ihrem Erinnerungsbericht. Was passiert ist zwischen dem Zeitpunkt, als ihr Vater eines Morgens halbseitig gelähmt in die Notaufnahme eines Pariser Krankenhauses gebracht wurde, und dem Moment, da aus einem diskreten Berner Institut die Nachricht eintraf, alles sei gutgegangen, beschreibt die Autorin in knappen, impressionistisch hingetupften Situationsskizzen, in denen Spaß und Schmerz miteinander Versteck spielen.
Das Schönste an diesem Buch ist, dass es alle unsere vorgefassten Überzeugungen zum Thema der aktiven Sterbehilfe untergräbt. Die entsprechenden Institutionen sind nicht einfach gewinnbringende Geschäftsunternehmen mit dem Tod im Angebot. Die mehr oder weniger strenge Gesetzgebung in den einzelnen Ländern gegen diesen letzten Schritt hat meistens auch gute Gründe für sich. Selbst die Bürokratie der Behörden ist zu Mitgefühl fähig. Und die emotionale oder die moralische Belastung für die Umgebung hält sich mit dem Dauerstress, im Ernstfall konkret nichts falsch zu machen, so ziemlich die Waage. Niemand hat endgültig recht oder unrecht im Reich der Lebensmüden, auch der nicht, der da gerade die bitter schmeckende Lösung aus dem Glas heruntergeschluckt hat.
Bevor es jedoch so weit ist, wird viel gelacht in diesem Buch. Zwar läuft dem 88-Jährigen, der vor seinem Schlaganfall ein eleganter und angesehener Kunstgalerist in Paris war, immerfort der Speichel aus dem schief gewordenen Mund und die Auktionskataloge, in die er gelegentlich noch reinschaut, rutschen ihm unter der gelähmten Hand zwischen den Knien zu Boden. Das Lachen zwischen ihm und seinen beiden Töchtern im Krankenzimmer kommt aber spontan. Es hat nichts von der Unbeholfenheit, mit der man manchmal das Unabwendbare zu vertreiben sucht. Inmitten von Überdruss, Ekel und Schmerz trägt jenes Lachen auch noch Spuren der Boshaftigkeit, mit welcher der egozentrische Vater einst über seine „kolossal“ dick gewordene, pubertierende Tochter Emmanuèle seine Späße machte. Ein vorbildlicher Vater war dieser Mann nicht, und durch seine plötzlich entdeckte homosexuelle Veranlagung hat er später auch seine Frau noch verletzt. Nichts ist süßlich in diesem Bericht. Ebenso wenig haftet so etwas wie Ressentiment am Verhältnis von Vater und Tochter. Im tabulos erzählten Auf und Ab der Ereignisse weht vielmehr eine seltsame Frische durch den Text.
Das Sandwich, das die Tochter dem Vater auf dessen Wunsch hin ins Krankenhaus mitgebracht hat und das er wegen seiner Schluckstörung dann doch nicht essen kann, liegt angebissen noch lange im Kühlschrank und später im Eisfach, bevor die Autorin es fertigbringt, es im Mülleimer verschwinden zu lassen. Und die etwas gebieterisch vorgetragene Aufforderung an sie, ihm beim Schlussmachen zu helfen, denn dieser Daliegende sei ja nicht mehr wirklich er, braucht Zeit, bis sie innerlich akzeptiert werden kann. Die fünfzehn verschiedenen Papiere, welche die aus Bern angereiste Dame – erbetene Kostenbeteiligung: 300 Euro – dann verlangt, wären Grund genug, den Mut zur Tat wieder sinken zu lassen, bringen andererseits aber auch eine willkommen konkrete Problemstellung für ein klares Projekt, an die man sich fortan halten kann.
Den beiden Töchtern fällt die paradoxe Wirkung des Vorhabens jedenfalls schnell auf: Ihr Vater kann wieder besser schlucken, verständlicher sprechen, spontane Wünsche äußern und bald in die Reha gehen – nicht zuletzt wohl eben auch dank der Aussicht auf ein baldiges Ende. Dass der schon festgesetzte Termin in Bern dann noch einmal verschoben werden muss, weil ein enger Freund eine schwierige Operation vor sich hat und man ihn nicht einfach allein seinem Schicksal überlassen kann, setzt dem Ganzen ein absurdes Krönchen auf.
Die Reise nach Bern verläuft dann auch anders als ursprünglich geplant. Auf die Fahrt im engen Familienkreis mit einer Fahrkarte weniger für den Rückweg muss nach Anraten des Rechtsanwalts verzichtet werden, denn das Risiko eines Gerichtsverfahrens wäre zu groß. Die beiden Töchter sitzen dann zwar, während der schon reisefertige Vater im Rollstuhl in einer Ecke des Hausflurs zu warten hat, wegen einer Indiskretion doch noch zur Vernehmung im Polizeirevier. Die Beamtin, die ihre Erklärungen zu Protokoll bringt, fragt bei der Verabschiedung jedoch überraschend, ob sie die beiden Frauen umarmen darf. Im Privatleben hat sie gelernt, für solche nicht ganz legalen Akte Bewunderung aufzubringen.
Auch die Notwendigkeit, den Todeswilligen allein mit einer bezahlten Begleitung fahren zu lassen, wird weder beklagt noch sonst wie kommentiert. An der Schwelle zur Endgültigkeit ist für solche Gefühlswallungen kein Platz mehr. Entscheidend ist allein die Entschlossenheit des Betroffenen selbst – und dem scheint der Lauf der Dinge recht gewesen zu sein, ob so oder so. Champagner-Geschmack wäre ihm lieber gewesen als das bittere Zeug, soll er, so die Nachricht aus Bern, zuletzt nur noch gesagt haben.
Angesichts der Schwierigkeit unserer auf individuelle Selbstbestimmung fixierten Zivilisation, in Sachen Sterben eine eigene Sprache und einen glaubwürdigen Ton zu finden, ist dieses Buch eine wertvolle Anregung. Im Mittelpunkt steht allein die konkrete Lebenssituation eines Unheilbaren. Auf allgemeine Betrachtungen verzichtet die Autorin. Früher seien diese Dinge einfach so passiert, ohne viele Worte drum herum, sagt ihr die Vertreterin eines Sterbehilfevereins: Doch vor dem Hintergrund gewisser in die Schlagzeilen gekommener Einzelfälle und der entsprechenden Debatte sei alles komplizierter geworden.
Zur Einfachheit von früher führt kein Weg zurück. Zur Frage des aktiven Sterbens kann und will dieses von Angela Sanmann feinsinnig übersetzte Buch keine endgültigen Antworten geben. Es kann aber dabei helfen, nicht an der falschen Stelle zu lachen, kategorische Urteile zu fällen oder Tränen fließen zu lassen. „Wie war ich?“ – fragt der Halbgelähmte, der kein Dokument mehr eigenhändig unterzeichnen kann, nach der Bestätigung seiner Tatentschlossenheit vor der Filmkamera. Auch die Eitelkeit ist ein Gut, das die Menschen gern in den Tod mitnehmen würden.
Zur Frage der aktiven Sterbehilfe
maßt Bernheim sich
keine endgültige Antwort an
Sterbezimmer des umstrittenen Vereins Dignitas in Zürich.
Foto: laif
Emmanuèle Bernheim:
Alles ist gutgegangen.
Aus dem Französischen von Angela Sanmann. Verlag Hanser Berlin, Berlin 2014.
208 Seiten, 18,90 Euro, E-Book 14,99 Euro.
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de
"Hier wird nicht existenziell gegrübelt, sondern existenziell gehandelt." Gabriele von Arnim, Die Zeit, 03.04.14
"'Alles ist gutgegangen' ist ein mutiger, atemloser und zugleich zärtlicher Bericht über das Glück des Lebens und die Freiheit zu sterben." Bremen Magazin