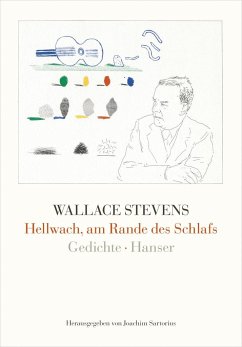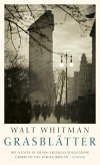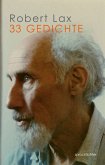Wallace Stevens gilt heute als der bedeutendste amerikanische Lyriker des 20. Jahrhunderts. Von ihm stammen einige der vollkommensten Verse der modernen Literatur. Wie kann man Dichter sein in einer unmetaphysischen Zeit? Diese Frage hat Stevens auf ganz eigene Weise beantwortet. Der Einzelgänger, der Frankreichs Kultur liebte und doch nie in Paris war, hat zeitlebens in Hartford gelebt, wo er sein Geld als Vizepräsident einer großen Versicherungsgesellschaft verdiente. Nun entdecken deutsche Dichter ihn und seine Poesie wieder.

Wallace Stevens ist einer der ganz großen amerikanischen Lyriker. Dank einer bezwingenden neuen Auswahl muss er bei uns kein Geheimtipp bleiben.
Von Heinrich Detering
Von den amerikanischen Lyrikern, die im frühen zwanzigsten Jahrhundert die Poesie der Moderne erfanden, ist Wallace Stevens hierzulande weithin noch immer ein Geheimtipp. Die umfangreicheren deutschen Übersetzungen liegen Jahrzehnte zurück - das ist, auch wenn 1995 noch ein Gedichtzyklus in der Übersetzung von Karin Graf und Hans Magnus Enzensberger folgte, eine karge Ausbeute. Dieser Notlage soll der stattliche Band, den Joachim Sartorius nun in enger Zusammenarbeit mit Durs Grünbein vorlegt, endlich abhelfen. Der Erfolg ist ihm zu wünschen. Hier ist ein ganz eigenständiger Weg in die Moderne wiederzuentdecken und eine Poesie von sinnlicher Schönheit und intellektuellem Glanz. Wie wenige seiner Zeitgenossen ist Stevens ein zugleich verführerisch einfacher und bis zur Sprödigkeit rätselhafter Poet, ein Artist des doppelten Bodens und der kippenden Perspektiven.
Wer in dieses poetische Universum eintritt, glaubt sich sogleich konfrontiert mit unverkennbar amerikanischen Szenerien, in denen unverkennbar amerikanische Mannsbilder agieren. So urban diese Gedichte auftreten, so ländlich sind ihre Ansichten eines vorindustriellen Amerika. Da wohnt man in Hütten, sitzt am Lagerfeuer und wandert durch heroische Landschaften von leuchtender Farbigkeit, erfüllt von Wind und Vogelrufen, "the sound of the land". Das Land ist das Land der Freien und Tapferen, aber es ist zugleich die Welt schlechthin. Ihr "heroic sound" ist es, der hier beschworen wird; diesem Klang antwortet das Gedicht.
Wie aber wäre es, wenn die heroischen Klänge des Landes nichts wären als das Echo der eigenen Stimme? Die betörenden Evokationen hätten dann gleichsam erst selbst in die Welt hineinsingen müssen, was das entzückte Ohr dann hören soll. Steigern ließe sich diese Beunruhigung durch eine Ausweitung der vertrauten Motive ins kosmisch Unheimliche: "Draußen vorm Fenster / Sah ich wie die Planeten sich sammelten / Wie die Blätter selbst / Sich drehten im Wind". Wo Blätter und Planeten so nah beieinander sind, da kann sich im Allernächsten jederzeit der Abgrund der Unendlichkeit auftun. Tatsächlich erweist sich das Wort "Planet" als eines der Motive, die in diesen Gedichten aufleuchten wie unheimliche Chiffren des Unbehaustseins.
Erst diese Erfahrung bildet das Fundament, auf dem sich der Kunstbau von Stevens' Gedichten erhebt. Immer skeptischer werden schon seine frühen Texte gegenüber W. C. Williams' Maxime, es gebe "no ideas but in things". Nichtig und leer sind ihm die Dinge geworden; die Welt, die ihn eben noch aus tausend Augen ansah, beginnt zu erblinden. Indem Stevens seine Gedichte auf diesen Zerfall antworten lässt, stilisiert er sie zum Bannstrahl gegen das, was Baudelaire, im Uranfang der Moderne, den "ennui" genannt hatte. Das Gedicht soll dem Unbestimmten Gestalt geben. Es soll mit seinem Geist erfüllen, was zuvor nur taubes und blindes Dasein war.
Auch wenn dies alles in den zwanziger Jahren in der weltliterarischen Luft liegt - mit gleicher Emphase wie Stevens haben nur wenige Poeten die Poesie zur einzig legitimen Nachfolgerin einer nicht mehr geglaubten Religion ausgerufen. Man muss wohl bis zu Nietzsche zurückgehen, um Vergleichbares zu finden. In dessen "Fröhlicher Wissenschaft" schleudert der Verkünder des "Todes Gottes" den Zuhörern die Frage entgegen, ob "nicht wir selber zu Göttern werden" müssen. Nüchterner, aber nicht weit entfernt klingt das bei Stevens so: "After one has abandoned a belief in God, poetry is that essence which takes its place as life's redemption." Das ist Kunstreligion im striktesten Sinne: Die Poesie soll die Stelle einnehmen, die mit dem Verlust des Glaubens leer geworden ist. Damit gewinnt sie selbst religiöse Dignität. Noch immer heißt die Aufgabe, die nun ihr allein zufällt, "Erlösung", als sei nach dem Verschwinden Gottes nur die Sünde geblieben. Nicht den Dichter oder die Menschheit aber soll sie erlösen, sondern das Leben selbst: "life's redemption".
Erst in dem Augenblick, in dem ein Mensch die Dinge wahrnimmt, sie in der Wahrnehmung ordnet, zu Bildern arrangiert und wenigstens auf diese Weise mit Sinn auflädt (also: dichtet), kommen sie zu sich selber. Erst im Lichte dessen, was die nach Sinn verlangenden Menschen auf sie projizieren, beginnt die Welt zu leuchten. In einem programmatischen Aufsatz über Dichtung und Malerei, der diesem Band wie ein Nachwort beigegeben ist, heißt das: "Die Welt um uns herum wäre trostlos, gäbe es nicht die Welt in uns." Die Imagisten hatten die Ideen in den Dingen gesucht; der entlaufene Imagist Wallace Stevens erfindet im Licht der Ideen die Dinge neu.
Nur darum kann ein Gedicht, das in langsam ansetzenden und dann zu Anrufungen aufschwellenden Versen den Mond anspricht, die erstaunliche Überschrift tragen: "Gott ist gut. Es ist eine schöne Nacht." Denn das "himmlische Rendezvous", das diese Verse schildern wie ein magisches Geschehen aus archaischen Zeiten, haben sie selbst erst im Sprechen hergestellt, vor unseren Augen und Ohren. Weil und solange das Gedicht redet, ist Gott gut. Weil und solange es andauert, soll es den Dichter vor dem Absturz ins Nichts behüten. Entfaltet wird diese neue Mythologie in dem Band "Parts of a World", erschienen 1942, mitten im Zweiten Weltkrieg und wie ein Abwehrzauber gegen ihn.
In den gelungensten Gedichten von Wallace Stevens bleibt die Beschwörung durch die Reflexion gebannt. Erst indem sie die hitzige Verführung durch eine allzu vertraut erscheinende Naturmystik kühl zerbricht, kommt seine eigene, einzigartige Poesie zustande. "Dreizehn Arten, eine Amsel zu sehen" ist so ein Gedicht. Es spricht von der Amsel - und von der Art, in der sie gesehen wird: vom eigenen Sprechen, in dessen Vollzug erst die Amsel zur Amsel wird. Zugleich vollzieht die spezifische Musikalität der Verse, wovon sie sprechen, im fortwährenden Balancieren zwischen prosaischer Nüchternheit und klassischem Jambenfall, zwischen dem süßen Klang der Tradition und sachlicher Lakonie.
Dieser Dichter arbeitete als Vizepräsident einer Versicherungsfirma. Dass es auch im eigenen Land lange dauerte, ehe ihm die verdiente Anerkennung zuteilwurde, lag nicht nur an diesem Beruf, auch nicht allein an seiner oft provozierend konservativen politischen Einstellung. Es ergab sich wohl auch aus der literarischen Konkurrenz, in der während dieser großen Zeit der amerikanischen Moderne ein Dichter den anderen verdrängte. Schon Stevens' erstes Meisterwerk, der Band "Harmonium", wurde 1923, im Jahr nach Eliots "The Waste Land", eher versteckt als veröffentlicht; der größte Teil der Auflage blieb unverkauft. Und dabei waren es schließlich gerade diese Gedichte, auf die sich Stevens' Weltruhm begründete, dreißig Jahre und eine Handvoll Gedichtbände später.
Die zweisprachige Auswahl von Joachim Sartorius bietet nicht nur - was schon rühmenswert genug wäre - "The Best of Stevens", sondern auch Fundstücke. Das schönste ist das hier erstmals übersetzte mehrteilige Gedicht "The Rock", erschienen kurz vor Stevens' Tod 1955. Es ist eine eindringliche Summe seiner Poesie und seiner Poetik gleichermaßen. Nach den Durststrecken der Abstraktion, in denen die Selbstreflexionen sich zeitweise verloren hatten (das hier ebenfalls erstmals übersetzte "Notes Toward a Supreme Fiction" gibt davon einen Eindruck), zeigte sich Stevens noch einmal auf der Höhe seiner Kunst. Die älteren wie auch die erst für diesen Band angefertigten Übersetzungen, in denen vor allem Durs Grünbein als sensibler Nachdichter überzeugt, sind teils als prosaische Lesehilfe, teils als Nachdichtungen konzipiert. Diese Uneinheitlichkeit und die allzu große Zurückhaltung in den Erläuterungen trüben nur wenig die Dankbarkeit für ein Buch, das in den schlichten Versen kulminiert: "Wenn die Blätter gefallen sind, kehren wir / zu einem einfachen Gefühl für Dinge zurück."
Wallace Stevens: "Hellwach, am Rande des Schlafs".
Gedichte.
Aus dem Amerikanischen von Hans Magnus Enzensberger, Karin Graf, Durs Grünbein, Michael Köhlmeier, Bastian Kresser und Joachim Sartorius. Hrsg. von Joachim Sartorius. Hanser Verlag, München 2011. 352 S., geb., 24,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Ultimative Eleganz: Eine schöne Werkauswahl aus dem
pulsierenden Kosmos des Dichters Wallace Stevens
„Fischzauber“ heißt ein Gemälde von Paul Klee. Ein Unterwasserbild, so scheint es, auf dem die Fische und Muscheln über Algen ruhen und ihre Farben zeigen, Blau und Rot und Gold. Doch das Meer könnte auch der Himmel sein, ein Schimmer geht von diesem Wasser aus, das schuppig wirkt und dunkelbraun getönt ist. Und beim genauen Hinsehen lassen sich Blumen auf der Leinwand erkennen, aber auch Gräser und ein stilisierter Mond. Man sieht das Meer in der Landschaft und die Landschaft im Meer, bis der Unterschied fast aufgehoben ist.
Es ist kein Zufall, dass der amerikanische Lyriker Wallace Stevens ein großer Verehrer Paul Klees war und Maler wie Kandinsky oder Matisse schätzte, Künstler allesamt, die der Vormacht der Dinge eine Absage erteilten. Wie im Spiegel einer anderen Sprache fand Stevens bei diesen Malern Ausformungen seiner eigenen dichterischen Vorstellungen, deren Essenz er in den Satz gefügt hat: „Wirklichkeit ist nicht, was sie ist. Sie besteht aus den vielen Wirklichkeiten, in die sie verwandelt werden kann.“
Das klingt gut, ist aber mehrdeutig, weil Stevens in seinen poetologischen Notizen den Begriff „Wirklichkeit“ offen hält. Mal meint er die sinnlich wahrnehmbare Wirklichkeit, mal die Wirklichkeit im umfassenden Sinne der Entfaltung all ihrer Möglichkeiten. Die äußere Wirklichkeit ist ihm der Grundstein des Schreibens – „nur der Grundstein“, wie er andernorts notiert. Was man mit dem Geist sieht, ist für Stevens ebenso wirklich wie das, was man mit dem Auge sieht. Gleichwohl darf sich die Imagination nicht von der Wirklichkeit lösen. Vielmehr ist es ein Wechselverhältnis, die „Seele“, wie er es nennt, setzt sich zusammen aus der äußeren Welt, und umgekehrt entfaltet sich die Wirklichkeit erst zur Gänze, wenn sie von der Kraft des Geistes durchströmt wird.
So angestrengt diese Überlegungen bisweilen auch wirken – viele von Wallace Stevens’ Gedichten sind angenehm frei von bloßen Begriffen. Er ließ sich Zeit mit seiner Lyrik. Als 1923 sein Erstling „Harmonium“ erschien, war er bereits 44. Umso klarer sind hier seine Mittel schon entfaltet. Die Kunst, der Stimme Raum zu geben etwa, bis Anschauung, Denken und Empfindung zu einer Einheit verschmelzen wollen: „Die Farbe, die wie ein Gedanke bricht / aus einer Stimmung, Geste halb, / halb Wort.“ Nicht von ungefähr bezieht sich Stevens immer wieder auf die Musik, zitiert Komponisten oder spricht von Tönen und „Rhapsodien“. Die Metapher ist für ihn der Ausdruck des Geistes, „die Sinne malen bildlich“ schreibt er einmal. Und so kann man als Leser Bilder entdecken, die aus dem Jonglieren mit Rhythmen und Klängen erst eigentlich entstehen. Und sieht dem Spiel der Bedeutungen zu, die sich drehen und verschieben wie die Blätter, die Farben und die Schreie der Pfauen in dem Stück „Schwarz dominiert“.
„Definitionen, Lichter, wirf sie fort / und sprich von dem, was du im Dunkel siehst“ – der Dichtung traute Wallace Stevens das Höchste zu. Sie war ihm eine Kraft, das Dunkel zu erleuchten, das Hier und Jetzt erklingen zu lassen. Aber auch eine Zerstörungskraft, voller „Formen, Flammen und den Funken von Flammen“. Wer schreibt, müsse etwas Großes auf dem Herzen haben: „einen Löwen in der Brust / einen Ochsen, / ihn dort atmen zu fühlen“.
Dieses Plädoyer für das Wilde und Zerstörerische mag verwundern, wenn man einen Blick auf Stevens’ eigenes Leben wirft. Anders als viele seiner amerikanischen Dichterkollegen zog es ihn nicht nach Europa. Ein studierter Jurist, arbeitete er eine Weile journalistisch, um bald schon zu den Wurzeln seiner Ausbildung zurückzukehren. Den größten Teil seines Lebens verbrachte Stevens bei einer Versicherungsfirma in Connecticut, deren Vizepräsident er sogar wurde. Ein ruhiges, ganz der Arbeit und der Kunst verpflichtetes Leben, so scheint es. Doch unter der Oberfläche brodelt es: „Der Löwe döst in der Sonne.“
Joachim Sartorius hat eine schöne Auswahl aus diesem pulsierenden Kosmos getroffen. Vielleicht ist das Kapitel zu Stevens’ drittem Band „Ideas of order“ ein wenig schmal ausgefallen. So kommt der Leser nicht in den Genuss jenes Dämmerlichts, in dem Stevens zur Abwechslung einmal das Schmutzige des Geistes betont: „The mind is muddy“. Dafür hat Sartorius auch Stücke aus dem Nachlass aufgenommen und viele der langen Zyklen aus dem späteren Werk, in denen das Gedicht über sich selber nachzudenken beginnt. In einer Zeit, in der die Religion ihre Wirkung verloren hat und der Mensch ganz auf sich selbst gestellt ist, misst Stevens der Dichtung gottgleiche Schöpferkraft zu.
Nun macht er sich auf die Suche nach einer Sprache, die wie „klares Wasser in einer funkelnden Schale“ sein soll. Wenn es ihm gelingt, „Sehen und Nichtsehen“ ins Gleichgewicht zu bringen, wird tatsächlich das „Summen und Summen“ seiner neu angekommenen Biene Poesie spürbar. Bisweilen aber gefallen sich die Gedichte auch zu sehr im Ausstellen ihrer Gedanken.
Es dürfte kaum Schwierigeres geben, als diese unterschiedlichen Töne zu übersetzen. Oft arbeitet Stevens mit kleinsten rhythmischen oder lautlichen Verschiebungen, etwa wenn das Echo der „echoing hills“ in einem Wort wie „choir“ nachklingt. Sartorius hat gleich mehrere Stimmen auf Stevens’ Verse angesetzt. Während Durs Grünbein manchmal ein wenig zu feierlich wird, zeichnet der Herausgeber gut den verschlungenen Weg zu einer „höchsten Fiktion“ nach. Hans Magnus Enzensberger überzeugt ebenso, doch hätte seine Übertragung der „Dreizehn Arten eine Amsel zu betrachten“ von 1960 eine kleine Auffrischung vertragen. Sei’s drum. Wer Wallace Stevens, den Künstler der „ultimativen Eleganz“, kennenlernen will, der greife zum vorliegenden Buch.
NICO BLEUTGE
Wallace Stevens
Hellwach, am Rande des Schlafs Gedichte. Aus dem Amerikanischen von Hans Magnus Enzensberger, Karin Graf, Durs Grünbein, Michael Köhlmeier, Bastian Kresser und Joachim Sartorius. Herausgegeben von Joachim Sartorius. Carl Hanser Verlag, München 2011. 352 Seiten, 24,90 Euro.
Auf der Suche nach einer
Sprache „wie klares Wasser in
einer funkelnden Schale“
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Wallace Stevens zählt zwar zu den großen Mitbegründern der Poesie der Moderne, ist aber hierzulande weitgehend ein "Geheimtipp" geblieben, teilt Rezensent Heinrich Detering mit. Groß ist daher des Kritikers Dankbarkeit für diesen zweisprachigen Band, der nicht nur ein "Best of" Stevens'scher Verse darstelle, sondern obendrein so manche Entdeckung enthalte. Stevens habe wie kaum ein anderer moderner Dichter an die Ersetzung der Religion durch die Poesie geglaubt, schreibt Detering. Lediglich Nietzsche hätte einen vergleichbaren Erlösungsanspruch an die Kunst herangetragen, wie Detering ihn aus Stevens? Gedichtzeilen und auch aus einem dem Band beigefügten Essay über Dichtung und Malerei heraushört. Es sind jedoch nicht allein die poetologischen Implikationen der Texte, die den Rezensenten interessieren, gewissermaßen ihr "intellektueller Glanz". Auch und vor allem die "sinnliche Schönheit" Stevens'scher Poesie hat es Detering sichtlich angetan.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Ein kostbarer, sorgsam gestalteter und gewichtiger Band." Manfred Papst, NZZ am Sonntag, 27.11.11
"Das Paradies auf Erden zu schaffen, ist eine enorme Aufgabe für die Poesie. Wallace Stevens, ... einer der wortgewaltigsten Dichter der USA, ist dies bewundernswert gelungen." Peer Trilcke, Literaturen, 11/2011
"Eine schöne Werkauswahl aus dem pulsierenden Kosmos des Dichters Wallace Stevens... Wer Wallace Stevens, den Künstler der "ultimativen Eleganz" kennenlernen will, der greife zum vorliegenden Buch."
Nico Bleutge, Süddeutsche Zeitung, 06.12.11
"Die Übersetzerriege hat alles unternommen, die Gedichte in adäquaten und einfühlsamen deutschen Fassungen zu präsentieren. Einen besseren Boden kann man dem amerikanischen Dichter, der Europa niemals besucht hatte, wohl kaum bereiten." Jürgen Brôcan, Neue Zürcher Zeitung, 12.04.12
"Das Paradies auf Erden zu schaffen, ist eine enorme Aufgabe für die Poesie. Wallace Stevens, ... einer der wortgewaltigsten Dichter der USA, ist dies bewundernswert gelungen." Peer Trilcke, Literaturen, 11/2011
"Eine schöne Werkauswahl aus dem pulsierenden Kosmos des Dichters Wallace Stevens... Wer Wallace Stevens, den Künstler der "ultimativen Eleganz" kennenlernen will, der greife zum vorliegenden Buch."
Nico Bleutge, Süddeutsche Zeitung, 06.12.11
"Die Übersetzerriege hat alles unternommen, die Gedichte in adäquaten und einfühlsamen deutschen Fassungen zu präsentieren. Einen besseren Boden kann man dem amerikanischen Dichter, der Europa niemals besucht hatte, wohl kaum bereiten." Jürgen Brôcan, Neue Zürcher Zeitung, 12.04.12