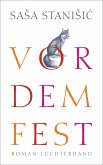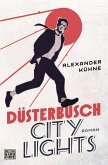Dies ist die Geschichte einer maßlosen und erschreckenden Verstrickung: Ein Vater, der in den Osten ging, um dem Land seiner Hoffnungen zu dienen. Ein Sohn, der als Komponist die Sounds seiner Generation einfängt und sich mit der Zensur arrangiert. Als der Sohn Karriere macht, steht der Vater vor der Tür. Fortan umkreisen sich die beiden, nur langsam ahnt man, welchen Kampf sie miteinander führen.
Uwe Kolbes Roman vom Verrat am eigenen Leben ist auch eine Absage an die Gleichgültigkeit, ob im Alltag einer Diktatur oder anderswo.
Uwe Kolbes Roman vom Verrat am eigenen Leben ist auch eine Absage an die Gleichgültigkeit, ob im Alltag einer Diktatur oder anderswo.

Ein Buch, das bei allem lyrischen Gefunkel auch zu schuften weiß: Uwe Kolbes Roman "Die Lüge" über einen Stasi-Vater und dessen komponierenden Sohn.
Von Gerhard Stadelmaier
Um es kurz zu machen: Dieses Buch ist - seid ehrlich! - unlesbar. Nicht, weil es schlecht geschrieben wäre. Es enthält wunderbare Formulierungen, wie zum Beispiel, dass in und um Berlin die Flüsse nicht fließen, sondern "nur sickerten, sich vergaßen in Seen". Obwohl: Es enthält auch wunderliche bis peinliche Formulierungen, vor allem, wenn es in sexibus schwelgt, und das tut es häufig, denn die beiden Generationsprotagonisten des Romans, Vater und Sohn, wechseln äußerst häufig die Frauen. Den Alten "schauten" da schon mal "Beate Brinkmanns kleine, auf den Rippen stehende Brüste mit steifen Warzen aufmerksam an, während er in dem kleinen Kanal unter ihrer flachen Bauchdecke kam." So viel Kanalarbeit war nie.
Aber wenn man nicht gerade die Perspektive von Beates Brüsten einzunehmen oder deren "geruchsintensive Stellen" wahrzunehmen gezwungen ist, das "Stallhafte" in "ihrem filigran ausrasierten Nacken" oder ihrem "kräftig behaarten Schoß" (was für ein Schmock, um den Genossen-Odeur zwischen SED-treuen Kommunisten zu schnuppern!), bieten sich dem Auge des Lesers häufig auch prunkvoll expressionistelnd-lyrische Funkelfunde. Wunderbar, wie die "schwarzen Wände der abendschwarzen Häuser" (im Trakl-Ton) oder die "glitschigen Pflastersteine in den Schluchten der Stadt", durch die der Sohn zieht "als ein heulender Wolf" (im Jakob-van-Hoddis-Sound), dem pastosen Sprachfarbauftrag sich anschmiegen.
Ganz zu schweigen von den tief empfundenen Unterirdischkeiten: das Unter-die-Haut-Gehen im Geographischen, das Aufritzen der Erdoberfläche, das Erkunden des Schrundigen im blätternden Putz, in der Gräue, im Sumpf und Moder und Glanz und Gurgeln von Landschaft und Wasser und Wald. Der Autor Uwe Kolbe ist von Hause aus Lyriker. Natur- und Landschaftsdurchdringer (aber ein Personenplakatierer). Das merkt man jeder Zeile an. Ein Verdichter. Das merkt man auch jeder Zeile an. Er macht sie dicht. Man kommt nicht in sie rein.
"Die Lüge" ist der erste Roman des Siebenundfünfzigjährigen. Er ist unlesbar. Weil er eine Mauer um sich herum gezogen hat. Die ungefähr identisch mit der Mauer ist, die um die uralte, längst untergegangene DDR errichtet ward. Uwe Kolbe ist in der DDR (Ost-Berlin) aufgewachsen, hatte als Junglyriker Schwierigkeiten mit der SED, für deren Staatssicherheit sein Vater als verdeckte hauptamtliche Führungskraft arbeitete.
Der junge Held des Romans ist wie Kolbe Jahrgang 1957, nur dass er nicht Lyriker, sondern Komponist ist, der "dem Sound der Welt", vorzüglich in einem "Konzert für Straßenbahn und Schienenschleife", hinterher ist. Sein Vater ist verdeckter Kulturaufpasser der Stasi. Wobei am Ende Vater und Sohn sich nicht nur dieselben Frauen teilen (des Vaters Beate geht an des Sohnes Hosenlatz, und die vom Vater hochschwangere Wiebke wird vom Sohne unter der Dusche "durchdrungen"), sondern auch dieselben Schwammigkeiten: der Sohn schwammig widerständig, im Untergrund herumkomponierend (und -vögelnd), der Vater schwammig linientreu, im Obergrund herumtaktierend (und -vögelnd). Zwei Lebenslügner, zwei Sich-was-Vormacher - aus der uralten, längst vergangenen DDR. Vielleicht wäre uns so ein Buch 1994 brisant vorgekommen. Zwanzig Jahre später wirkt das nichts als ranzig bis abgeschmackt. Etwas, das sich erübrigt hat.
Der Romancier arbeitet hier was ab. Und er schuftet schwer: in Wechselschichten. Was das Ganze sehr vorhersehbar macht. Man blättert sozusagen vorgewarnt. Denn einmal ist der Vater dran: in Er-Erzählhaltung. Im nächsten Kapitel der Sohn: in Ich-Erzählhaltung. Im 63. und 64. Kapitel, man schreibt das Jahr 1984, der Junge ist siebenundzwanzig, kommen die beiden zum großen biographischen Ich-Einerlei zusammen. Wobei die Karriere des Vaters, der von Westdeutschland nach "drüben" ging, um dort etwas "aufzubauen", "seinen Schwanz nicht beherrschen kann" und deshalb seine Stasi-Deckung gefährdet, und die Karriere des Sohnes, der dort mitsamt seiner in die Psychiatrie abgehenden Mutter vom Vater sofort verlassen, aber aus der Ferne überwacht wird in seinem Sich-treiben-Lassen, doch sehr nach Partei- und Gegenpartei-Papiergeraschel klingen. Klischee-Figuren. Pappkameraden.
Dem Ganzen schaut man wie von einer der Plattformen zu, wie sie zum Teil im guten alten West-Berlin vor der bösen alten Mauer aufgestellt waren. Von denen aus man "nach drüben" schaute: wie in einen Zoo hinein. In ein Land, das Oberfläche ist, unter der wie in einem Bergwerk die Flöze und Schächte der Beziehungen und Verluste sich hinziehen, erzählerische Fluchttunnel, durch die sich alles und doch nichts drängt. Man liest das, als klopfe man Versteinerungen ab.
Zumal der hochlyrische Romancier Anspielungen tanzen lässt, die außer den Angespielten niemand versteht. Gut, "der ausgebürgerte Riebmann" lässt sich buchstabendreherisch als "Biermann" entziffern. Aber wer war "Sebastian Kreisler"? Offenbar ein DDR-Großkomponist mit E.T.A.-Hoffmann- und Schumann-Namensgespinst im Biographiegepäck, der den jungen Nachwuchstonsetzer unter seine schon schwer vom Krebs zerfressenen Fittiche nimmt. Nicht zu verwechseln mit Hanns Eisler oder Paul Dessau, die beide mit Klarnamen auftauchen. Oder wer ist "Leon"? Wer sind die "Blaumänner"? Und wo liegt "Nordost"?
Nimmt man hinzu, dass die Damen-Phalanx des jungen Tonsetzers ebenso beachtlich wie freimütig detailliert offengelegt ist wie die seines Vaters (sieben Kinder von fünf Frauen), verwandelt sich das verquälte Namensversteckspiel, das Kolbe sonst treibt, dann überflüssigerweise noch in eine ziemlich peinliche metaphorische Offenbarungs- und Enthüllungsüberwölbung: Soll doch der Papa Hildebrand, der Sohn Hadubrand gerufen werden. Wie die tragisch familiären Helden aus dem Hildebrandslied, dem einzigen deutschen althochdeutschen Heldengesang (Fulda, um 800 nach Christus), in dem Vater und Sohn sich begegnend verkennen, eventuell sogar töten oder doch erkennen (der Schluss des alten Lieds fehlt beziehungsweise bleibt offen).
Das ist sogar für einen liederliebenden Lyriker zu viel der Zaunpfahlwinkerei und Nachtigallentrapserei. Wir klappen "Die Lüge" zu, suchen nach Wahrerem.
Uwe Kolbe: "Die Lüge". Roman.
S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2014. 384 S., geb., 21,99 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Uwe Kolbes Roman „Die Lüge“ räumt anhand einer krassen Vater-Sohn-Geschichte mit allen Illusionen über die Bohème
der späten DDR auf – trotz der irrwitzigen Spannung lässt einen das Buch doch etwas ratlos zurück
VON INA HARTWIG
Über Geld dachten wir nie nach“, so steht es in Uwe Kolbes Roman „Die Lüge“. Wir – das ist die subkulturelle Künstlerszene der späten DDR und insbesondere Ostberlins, wo sich Dichter, Maler, Musiker tummelten und Zeit hatten; „Zeit war der wahre Luxus in den grauen Straßen und Höfen der Gegend.“ An Alkohol herrscht ebenfalls kein Mangel, er fließt in Strömen, vor allem Rotwein aus Bulgarien und Ungarn und manchmal, wenn einer über besondere Kontakte verfügt, wird ein Müller-Thurgau entkorkt. Das klingt, zunächst, nach einer herrlichen, nie endenden Party bei „Festmieten und Festpreisen für Brot“, den heiligen Kühen des Staats.
Der Autor selbst, Jahrgang 1957 und bisher vor allem als Lyriker und Essayist in Erscheinung getreten, wurde in Berlin als Sohn eines Binnenschiffers und einer zur Schwermut neigenden Mutter geboren. Nach der Schulzeit und dem Militärdienst ist er in jener Kulturszene im Nordosten seiner Heimatstadt sozialisiert worden, lebte dort wohl nicht schlecht, wenngleich, wie die meisten, wie er nahelegt, mit einer Lebenslüge. 1987 verließ er die DDR.
Einiges, was nun in dem umfänglichen Roman „Die Lüge“ zu lesen ist, kommt einem aus dem wunderschönen Essayband „Vinetas Archive“ ( 2011) bekannt vor, etwa der erste, überwältigende Ausflug nach West-Berlin, 1982, an der Seite eines großen alten Mannes des Kunst, seines Förderers. Dort ist es der Schriftsteller Franz Fühmann, der Uwe Kolbe tatsächlich entdeckte und nach Kräften unterstützte; im Roman wird er ersetzt durch den fiktiven Sebastian Kreisler, genannt „der Meister“, seines Zeichens antifaschistischer Komponist der ersten Stunde, der vom sozialistischen Glauben ziemlich abgefallen ist, und, nach Ansicht der Behörden, seine Zeit damit verplempert, jungen Talenten Gutes zu tun. Zu ihnen zählt Hadubrand Einzweck, der Ich-Erzähler der „Lüge“.
Hadubrand, wie kommt man bloß zu solch einem Namen? Im „Hildebrandslied“, an dem Vater Einzweck schon als Schüler einen Narren gefressen hatte, sind Hildebrand und Hadubrand nicht nur Vater und Sohn, sondern auch Krieger, die sich zwischen den Fronten begegnen. Das passt ganz gut zur Romanhandlung; wobei die Fronten ideologischer Natur sind. Geschossen wird mit Idealen und Illusionen.
Viele Namen fallen, fiktive und reale, darunter die von Promis wie Biermann (der hier Riebmann heißt) und Heiner Müller (hier Heiner Alt). Ein „Scharlatan“ ist auch dabei. Ehemalige Szene-Mitstreiter, Freunde oder auch Feinde von Uwe Kolbe werden dieses brisante Buch anders lesen als eine Kritikerin aus dem Westen. Der Ich-Erzähler, das fällt auf, ist hier nicht Schriftsteller, sondern Komponist; ein mit sensiblem Gehör ausgestatteter Autodidakt, der das Straßenbahnschienen-Gekreisch der Großstadt als avantgardistischen „Sound“ entschlüsselt und überhöht.
Es gibt schöne und etwas plumpe Musikpassagen in diesem Buch; im Großen und Ganzen aber klappt die Transposition der Künste. Für die schwermütige Mutter und den einfach gestrickten Stiefvater ist die schräge, bald auch staatlicherseits anerkannte Kunst des Sohnes ein Buch mit sieben Siegeln; im Unterschied zum leiblichen Vater! Der aber, fatalerweise, nicht nur ein strammer Parteisoldat der „Einheitspartei“ ist, sondern zudem Stasi-Offizier, zuständig für exakt jene Szene, in der sein Erstgeborener sich herumtreibt. Dieses Detail ist entscheidend: Der „Feind“ kennt dich besser als der „Freund“. Aber kann der Vater ein Feind sein? Die tragische Dimension, unter der der Roman durchaus ächzt, ist beabsichtigt. Die politische Provokation läuft auf die Frage hinaus, ob die getrennten Sphären – hier die Macht, dort die Subversion – tatsächlich so getrennt voneinander waren, wie man sich das auf der jeweiligen Seite einbildete.
Die Antwort wird, recht spät im Roman, Nein lauten. Das ist eine Bombe. Viele der „Kolleginnen und Kollegen des Untergrunds und aller möglicher Zwischenreiche“, wird Hadubrand Einzweck sich in einer Kernszene eingestehen, hatten „sicher nicht zufällig“ Eltern, die „zum Staatsapparat gehörten bis hinauf zur Nomenklatura“. Was, natürlich, auf ihn selbst zutrifft.
Hildebrand Einzweck, der Vater, der ehemalige Binnenschiffer, der seine erste Frau und den Sohn früh sitzen ließ, war ein stolzer Überläufer von West nach Ost gewesen, gleich nach dem Krieg, bevor er ein routinierter Frauenverkoster im Namen der richtigen Sache wird. Das Porträt dieses Mannes, in der dritten Person erzählt, dürfte Uwe Kolbe Kraft und viele Stunden Aktenstudium gekostet haben; sein eigener Vater (mit dem er nicht aufwuchs) war ebenfalls ein Stasi-Mann.
Nein, eine Heldengeschichte wird hier nicht erzählt, man hätte es sich fast gedacht. „Die Lüge“ betrifft aber keineswegs nur den Vater, der sich die Observation seines Sohnes schönredet. Sie betrifft alle, die sich beharrlich über ihre Herkunft ausschweigen, als könnte man die eigene Biografie mittels einer höheren Wahrheit überwinden. So weit treibt der kaum je verharrende, stets wie gepeitscht vorwärtsjagende Roman die Erkenntnis, dass alle, wirklich alle, selbst die Ausreisewilligen, der entscheidenden Frage ausweichen: ob man bereit sei, von der antifaschistischen Utopie, die so angenehm die Weste reinigt, wirklich Abschied zu nehmen.
Nicht zuletzt betrifft die Lüge den Erzähler selbst, der mal ein bisschen rebelliert, mal eiert, einknickt, Kompromisse macht und nicht wahrhaben will, dass hinter den Maßnahmen zur Förderung (oder zur Linderung der zeitweiligen Behinderung) seiner Karriere der Vater die Fäden zieht. So arglos ist er, dass er dem Papa von einer kritischen Diskussion unter Freunden erzählt. Seine Freundin Katharina kann es nicht fassen: „Du redest nicht nur wieder mit deinem Vater, sondern berichtest ihm obendrein brühwarm über die ach so konspirative Zusammenkunft deiner Künstlerfreunde? Da kannst du gleich selbst bei der Firma anheuern und brauchst ihn nicht die Berichte schreiben zu lassen. Hast du noch alle Tassen im Schrank?“
Es gibt Werke, die literarisch problematisch sein mögen, aber dennoch exemplarisch wirken. Sascha Andersons Autobiografie etwa, deren Ästhetik des Verrats aus Sicht des Verräters Maßstäbe der Skrupellosigkeit gesetzt hat. Im Vergleich damit ist, was Uwe Kolbe aus dem Motiv Verrat formt, geradezu human zu nennen. Denn er handelt die Fehlbarkeit unter psychologisch-biografischen Prämissen ab. Und: Es ist ein Verrat am eigenen Ich. Während der „echte“ Verräter, der Stasi-Vater, demonstriert, wie Verrat sich aus Sicht des Überzeugten anfühlen mag, nämlich wie etwas Notwendiges, also letztlich gar nicht wie Verrat. Was, natürlich, wiederum eine Selbst-Lüge ist. Und so fort. Einprägsame Formulierungen und Bilder findet Kobe, besonders in den Schilderungen der Zusammenkünfte des alternativen Völkchens aus Bärtigen und schönen Frauen, von denen sich immer wieder eine aus der Traube löst, um mit Hadubrand Einzweck, dem bekannten Komponisten, im Dunkeln abzutauchen. Dieser ist genau wie sein Vater, beide wollen einfach jede haben.
Zwei Casanovas also, einander verblüffend ähnlich, trotz des Altersunterschieds. Der „Sexappeal“ des Vaters war dem Geheimdienst sogar lange Zeit ein Werkzeug zur Informationserbeutung. Aber dem Genossen entgleitet sein Liebesleben. Die Vorzeigeehe mit einer jungen Arbeiterfrau (seine dritte Ehe) zerbricht, als die Teufelin in Gestalt einer gerissenen, ehrgeizigen, aufgeschlossenen Genossin auftaucht. Hier pflückt sich das Weib den Mann. Lässt sich schwängern. Behauptet, das Kind sei von ihm. Bei der Hochzeitsfeier, schon mit rundem Bauch, schnappt sie sich den Sohn, der in seiner Erregung nicht ein noch aus weiß. Es ist ein doppelter Betrug, am Vater und an seiner Freundin Katharina.
Damit nicht genug. Er wird, nach dem Tod des Vaters, die junge Witwe heiraten. Wieder ist sie schwanger, „und weil wir es nicht sagen konnten, ob von ihm oder von mir, erkannte ich den Sohn lieber gleich als meinen an“. Damit endet dieses großteils irrwitzig spannende Buch. Man legt es ein wenig ratlos beiseite: Was soll die krasse Pointe, dass Vater und Sohn, Macht und Untergrund, sich am Ende in derselben Frau vereinen? Kolbe will wohl suggerieren, die künstlerische Opposition sei Teil des Systems gewesen. Ob dieser Luhmannsche Gedanke über Lüge und Passion für die DDR taugt?
Uwe Kolbe: Die Lüge. Roman. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2014. 384 Seiten, 21,99 Euro, E-Book 18,99 Euro.
Die Macht und die Subversion
sind in diesem Roman
nicht säuberlich getrennt
Vater und Sohn – zwei
Casanovas, sie sind einander
verblüffend ähnlich
Der „Feind“ kennt dich besser als der „Freund“. Aber kann der
eigene Vater ein Feind sein? Sprossenfenster und gerüschte Stores können die
politische Realität nicht verhübschen. Foto: Plainpicture
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Einen "Schlüsselroman" sieht Michael Braun in Uwe Kolbes Roman über das Leben eines jungen Künstlers im Prenzlauer Berg der frühen 80er Jahre. Im Mittelpunkt des an die Biografie des Autors angelehnten Romans steht für ihn die Schilderung des Künstlerdaseins in der DDR, die im Lauf des Romans allerdings zurücktritt hinter der eines Vater-Sohn-Konflikts: der Vater, der den Sohn in dessen Kindheit in Stich gelassen hat, bespitzelt im Dienst der Stasi seinen Künstler-Sohn, einen Komponisten in der Künstlerszene Ostberlins, der ihm wiederum die Frauen ausspannt. Das Ergebnis ist ein Roman, so Braun, "der alle Heldenlegenden von ästhetischer Dissidenz in der DDR gründlich entzaubert".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Kolbe vermittelt, wie ein Überwachungssystem bis in die intimsten Beziehungen hinein wirkte, und was es hieß, in der Windstille der Geschichte zu verharren. Maike Albath Deutschlandradio Kultur 20140227