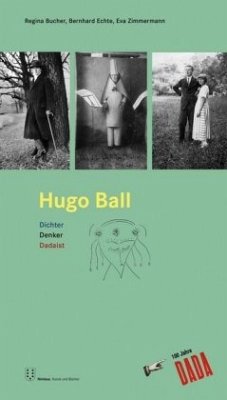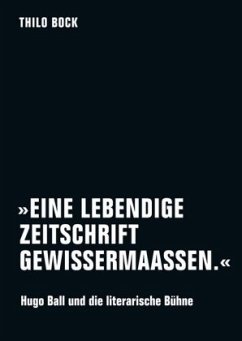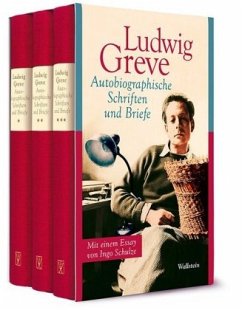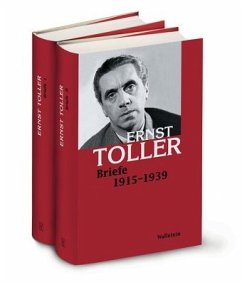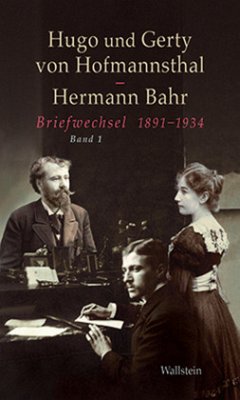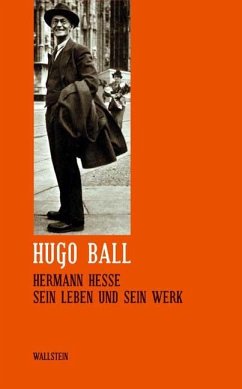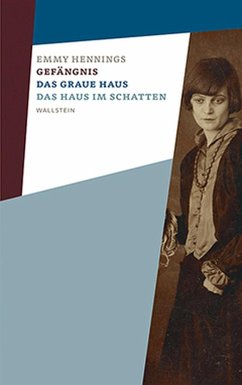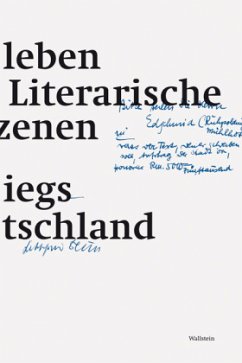Grab.
Diese Blumen aber - sie gemahnen an eine kleine wundersame Lebensgemeinschaft im Tessin, die unter dem grauen Schatten der Alltagssorgen und dem blauen Himmel des gegenseitigen Verstehens für wenige Jahre zusammenrückte. Hugo Ball hatte Emmy Hennings 1914 kennengelernt, sie heirateten 1920. Sie, Schauspielerin, Schriftstellerin und Gelegenheitsprostituierte, brachte eine neunjährige Tochter mit in die Beziehung, die selber eine kinderlose Ehe blieb. Er, Dramaturg, Mitbegründer der Dada-Bewegung und Schriftsteller, war ein Jahr jünger als seine Frau. Die beiden führten ein unstetes Schriftstellerleben, geplagt vom drastischen Geldmangel. Seit 1915 wohnten sie in der Schweiz, kurze Zeit in München, dann im Tessin, wo ihnen Hesse, der einen Fußmarsch entfernt sein Domizil hatte und die Balls gern um sich hatte, unter die Arme griff: Er bat einmal sogar seinen Mäzen, diesen beiden besonderen Menschen finanziell zu helfen.
Emmy Ball-Hennings reist umher, allein oder mit ihrer Tochter. Hugo Ball sitzt im Winter bibbernd vor der Schreibmaschine oder liegt dick angezogen und bibbernd im Bett, weil er die Heizkosten sparen möchte. Er ernährt sich manchmal tagelang nur von Milch, Birnen und Brot. Von Freunden, aus Verlagen oder aus fernen Klosterbibliotheken läßt er sich die für seine Arbeiten dringend benötigten Bücher schicken, die er nächtelang exzerpiert, weil er sie wieder zurückgeben muß. Fast täglich schreibt er seiner Frau, wenn sie unterwegs ist, lange Briefe, in denen er nach ihrem Befinden fragt, ihr Vorschläge zum besseren Überleben unterbreitet, von den fast immer zähen Verhandlungen mit Verlagen und Zeitschriftenredaktionen berichtet und den sinnvollen Einsatz des wenigen Geldes plant.
Und er kämpft immer wieder um Zeit: um Zeit für sich, um Zeit, seine Bücher zu schreiben. Als Emmy Ball-Hennings einmal ihre Tochter aus Italien, wo die beiden sich den Winter über aufhalten, vorab nach Hause ins Tessin zu ihm schicken möchte, sieht Ball seine eiskalte fragile Gelehrteneinsamkeit, der wegen den finanziellen Nöten nie lange Dauer beschieden ist, einstürzen: Die Wohnung sei doch klein, er müßte wegen dem Kind heizen, sich um das Essen kümmern und habe dabei seine "Kritik der deutschen Intelligenz" für eine Neuauflage umzuarbeiten und in Kürze beim Verlag einzureichen - ein verzweifelter Bittbrief um den eigenen Raum. Doch Ball, der oft am Rande seiner Kräfte ist, von Schwindeln befallen, schnurrt zusammen, zieht sich mit seinen Wünschen zurück, gibt nach, empfängt Emmy Hennings' Tochter, heizt ein und macht unter dem Druck der Manuskriptabgabe die Nacht zum Tage.
Hugo Ball litt. Er litt an Deutschland, das in seinen Augen schuld hatte am Ausbruch des Ersten Weltkriegs, er litt am deutschen Geist, der in die Katastrophe geführt habe. Er war ein strenger und hellwacher Beobachter der akuten intellektuellen Strömungen und ein akribischer Deuter der intellektuellen Traditionen, ein Deuter, der seine Ansichten anhand der Quellen beweisen und nicht nur behaupten wollte. Aus dem Leiden an Deutschland entstand seine "Kritik der deutschen Intelligenz". Äußerst lesenswert sind neben seinem Tagebuch "Flucht aus der Zeit" vor allem drei umfangreiche weitsichtige Aufsätze, die alle in den zwanziger Jahren entstanden: "Der Künstler und die Zeitkrankheit", "Carl Schmitts Politische Theologie" und "Die religiöse Konversion". Mit dem Bonner Professor Carl Schmitt wird Ball sich überwerfen, nachdem ein Schmitt-Schüler eine Rezension der überarbeiteten Fassung der "Kritik der deutschen Intelligenz" (erschienen unter dem Titel "Die Folgen der Reformation") veröffentlicht hat - eine Rezension, in der Ball Gedanken wiederfindet, die er in vertraulichem Gespräch mit Schmitt ausgetauscht hatte. Ball schreibt Schmitt einen engelsgeduldkalten Brief, der den Graben zwischen ihnen aussticht - und schnurrt zusammen, zieht sich mit seiner Wut zurück und schickt den Brief nicht ab.
Hugo Ball war ein einsamer, in die Notstände seines Lebens sich ergebender und seines geistigen Ranges bewußter Mensch, der seine durch die Begriffsarbeit geschliffene intellektuelle Kraft, Distanz zu schaffen und zu wahren, auch zur Behebung menschlicher Mißstände einzusetzen wußte: Als seine Frau einem Verhältnis mit einem Spanier erliegt, beendet Ball diese Beziehung mit einem kurzen Brief, der dem Sendschreiben eines Abtes gleicht, dessen Sinn nicht danach steht, an den Regeln eines Liebes- und Lebensordens rütteln zu lassen. In der Brief-Ausgabe findet sich nur ein Brief, in dem Ball ins Trudeln und Turteln gerät - der Brief an die Braut, der er ein fürsorglicher geistiger Vater gewesen zu sein scheint, mit offenen Armen die einst gefallene, immer getriebene und dichtende Emmy, die gerne die Augen zur Mutter Gottes aufschlägt, empfangend.
Das Ehepaar ist auf dem Weg zu Gott: Sie schwärmt poetisch in die Vielfalt der Lebenswunder aus, er kapselt sich begrifflich in die erlösende Einheit der Kirche ein. In einem Brief an Hermann Hesse aus Hugo Balls letzten Tagen erzählt sie, daß Ball sich liebend gerne zum Schreiben in ein Zimmer ohne Fenster zurückzog: der Verfasser des "Byzantinischen Christentums" im Gehäuse. Das Bild eines Asketen - der Mund ein geistreicher Strich, der nach innen schauende und daseinsdemütige Blick von einnehmender Verlorenheit.
Die Briefe Hugo Balls kommen aus der Klosterzelle eines sich immer enger um sehr wenige Menschen ziehenden Lebenskreises. Sie geben kaum Auskunft über den sich stetig ausdehnenden Gedankenkreis Balls. Das intellektuelle Terrain, auf dem er sich bewegt, taucht in den Briefen hier und da einmal auf, aber nicht in der Fülle einer blühenden Landschaft, sondern in der Kargheit einer kleinen Landkarte. Der Kenner der psychoanalytischen Theorien, der sogar als autodidaktischer Analytiker einmal einer leidenden Frau seine Hilfe anbot, muß ein guter Zuhörer gewesen sein. Auch Hesse fühlte sich von keinem anderen Menschen so verstanden wie von Ball.
Der sachliche und geschmeidige Stil seiner wissenschaftlichen Prosastücke, Kupferstiche in der Zeit der Plakate, mag sich aus diesem Vorrang der verstehenden Zuneigung vor der theoretischen Selbstgefälligkeit entwickelt haben. Als er sich in seinen letzten Jahren mit dem Zusammenhang von Psychoanalyse und Exorzismus beschäftigte, begegnete er in der christlichen Literatur immer wieder herausragenden Kirchenmännern, die allein durch ihr geistig festes Auftreten bei den psychisch Kranken heilend wirkten. Diese geistige Festigkeit, fern der intellektuellen Schnörkel, scheint schon seit der Dada-Zeit ein Urbild seines prosaischen Stilwollens gewesen zu sein - so wie ihm der Schritt in die katholische Kirche immer schon näher lag, als das von seinen intellektuellen Erregungen gesehen den Anschein hatte (man erinnere sich nur an das Bild von ihm im Dada-Bischofskostüm). Der heilende Auftritt des Heiligen: Das Urbild des wissenschaftlichen Schreibens wird auch zum Vorbild für ein Leben in Einsamkeit. Der verhaltene und schlichte, dem Hilfesuchenden zuvorkommende, in Not und Gefahr aber bestimmte Stil der Briefe gleicht dem Gestus eines Hirten, der sich verantwortlich weiß für die ihm anvertrauten Seelen und das eigene Heil.
Auf die Dauer und unter den aufreibenden Lebensumständen war das wahrscheinlich schwer durchzustehen: Hugo Ball welkte dahin. Er war ein kompromißloser und erfolgloser Schriftsteller, dessen Bücher sich nur mit Mühe unter die Leute bringen ließen. Hermann Hesse - Ball schrieb im Auftrag des S. Fischer Verlages und auf den Wunsch Hesses hin zu dessen fünfzigstem Geburtstag die erste umfassende Darstellung über Leben und Werk des Schriftstellers - zählte Balls Bücher zu den wichtigsten seiner Zeit. Wahrscheinlich sah Ball von den Tessiner Bergen aus zu weit ins Land: Seine Einsicht, daß die Psychoanalyse fatalerweise keine Antwort auf den auch von ihr selber leergeräumten leeren Himmel findet und das Augenmerk des Menschen immer tiefer auf den Boden des Leibes drängt - das war in den Zwanzigern zuviel des Guten. Vom unerledigten Heiligen auf Erden mochten damals die wenigsten etwas wissen wollen. Hugo Ball ertrug das Leben mit Zähneklappern, aber ohne Jammer, mit Zähigkeit, aber ohne Starrsinn. Er war ein einsamer Intellektueller im Weinberg des Herrn.
EBERHARD RATHGEB.
Hugo Ball: "Briefe". 1904-1927. Herausgegeben und kommentiert von Gerhard Schaub und Ernst Teubner. Band 1 und 2: "Briefe". 514 und 482 S. Band 3: "Kommentar". 804 S. Wallstein Verlag, Göttingen 2003. Alle geb., im Schuber, 124,- [Euro].
Hermann Hesse: "Briefwechsel mit Hugo Ball und Emmy Ball-Hennings". Herausgegeben und kommentiert von Bärbel Reetz. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2003. 612 S., geb., 34,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
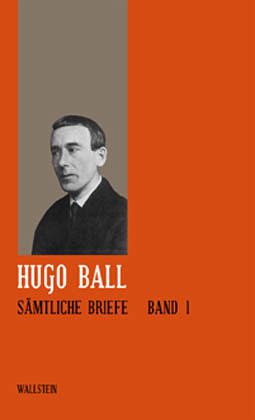




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 23.08.2004
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 23.08.2004