Insel ist ein kleines Phantom aus den Erdkundeklassenarbeiten. Irgendwie hakt sich die Phantasie im Atlas fest, an einem "kleinen Vogeldreck im zerkratzten Blau". Eine diffuse Faszination beginnt sich zu verfestigen.
"Meine Eltern freuten sich über das heftige Interesse, das als milde Neugier begonnen hatte und allmählich immer dringlicher Besitz von mir ergriff." Sie begreifen zwar nicht, weshalb das Interesse ihrer Tochter sich auf die Inseln vor der Küste richtet - doch was sie begrüßen, ist schlechthin die Herausbildung einer Leidenschaft für etwas, irgendeiner Leidenschaft für irgend etwas, denn die braucht der Mensch, um sich zu definieren. Doch führt die Erzählerin mit tückischer Geduld aus, wie ihre Obsession - die keiner versteht - ihr als Schülerin und dann als Studentin als rein defensives Instrument dient, zur Abwehr der Fragen und Erwartungen der anderen, und wie die Selbstfindung durch Leidenschaft ewig stockt. Daß sie nun "den Inseln" verfallen ist, der Insel 34 insbesondere, ist allerdings mittlerweile ein Teil ihres Lebens.
An sich sind die Inseln - das ist sehr kunstvoll geschildert - langweilig. Die Faszination kann durch keine objektive Qualität des Sehnsuchtsgegenstands begründet werden. Die Studiengegenstände - die alten Fotografien, die konfusen Sprachtonbänder, die Karteikarten - sind banal. Sie wirken unendlich rätselhaft, aber das Rätsel, das Geheimnis muß die Betrachterin stets aufs neue mitbringen. Die Inseln sind leer. Vor den Kapiteln dieses Romans stehen Insel-Mottos - aus der "Insel Felsenburg" und aus Synges "Aran-Inseln", von Tschechow ("Die Insel Sachalin"), Homer und Swift, von Robert Creeley und (besonders schön) Klaus Reichert. Sie erinnern daran, daß Inseln alles sein können - Sehnsuchtsheimat, Strafkolonie. Annette Pehnt führt vor, daß angesichts dieser Allmacht der Möglichkeiten die ins Auge gefaßte Insel 34 zwangsläufig das Nichts sein muß, die leere Projektionsfläche des Wunsches.
Dieses Prinzip führt nicht zum Verzicht auf Beschreibung, im Gegenteil, die Inseln, auf denen die Erzählerin schließlich im Verlauf ihrer so absurden wie nüchtern geschilderten kleinen Studienexpedition an Land geht, wirken ungeheuer solide, obwohl sie vollkommen uninteressant sind. Sie haben etwas magisch Triviales, sie haben den leicht gespenstischen Reiz Kabakovscher Installationen: eine provinzielle Schäbigkeit, deren versunkene Weltferne und Gleichgültigkeit zum Geheimnis angeschwollen scheint - die wie von einer hilflosen, hilflos "teilnehmenden" Ethnologin geschilderte Insel achtundzwanzig mit ihren Sackpfeife blasenden Bewohnern, die Insel zweiunddreißig mit ihrer stumm grabenden Archäologentruppe. Es gibt nichts eigentlich Rätselhaftes, aber alles bleibt unbegreiflich.
Die letzte Station der Fahrt, von der wir lesen, ist eine Deponie im Meer, es ist Nummer dreiunddreißig, die Insel des Gestanks. Hier endet die Initiationsreise, soweit es uns gestattet ist, sie zu verfolgen: auf der Müllkippe, die durch Annette Pehnts lakonische Schilderung etwas Friedlich-Bukolisches bekommt: "Manchmal hingen alte Plastiktüten in den Zweigen, die sich im Wind rundeten wie Lampions." Von hier aus könnte man nun die äußerste Insel, Nummer 34, sehen (wenn der Nebel nicht wäre). Die Entfernung ist gering. So gering, daß die Erzählerin "hinübergehen könnte", als sich in den letzten Sätzen des Romans das Wasser senkt und bei Ebbe der Schlick und die Priele einer Wattlandschaft auftauchen. Doch sie geht zum Haus des Deponieleiters zurück und packt ihre Sachen. Für die Rückfahrt mit dem Versorgungsschiff, muß man - so, wie die letzten, offenen Sätze konstruiert sind - annehmen. Was ist aus der unerklärlich hartnäckigen Reiseleidenschaft geworden? Hier muß sie enden, denn die Insel 34 ist unbeschreiblich und unerforschlich. Wie gefährlich schon die Nähe des Traumziels ist, das hat zu Beginn des letzten Kapitels das Epigraph formuliert: Es stammt diesmal aus den Märchen aus Tausendundeiner Nacht, aus der Sindbad-Geschichte, es erzählt von der Insel, auf der die Seefahrer landen und ein Feuer entzünden, nur um zu erfahren, daß es sich um einen riesigen Fisch handelt, auf dem sich Erdreich gesammelt hat und Bäume gewachsen sind und der nun überrascht die Hitze des Feuers verspürt: "In diesem Augenblick wird er mit euch in die Tiefe versinken, und ihr werdet alle ertrinken."
Die Insel - ein Phantom, ein Traum, ein Tod, eine erfolglose Rückkehr: das sind die Verkleidungen der Utopie. Nackt heißt sie: der Wunsch, der ausschließlich der meine ist. Ein Kapitelmotto stammt von John Donne - "Niemand ist eine Insel, gänzlich auf sich selbst gestellt . . ." Der Roman jedoch demonstriert das Gegenteil: die Insularität der verrückten jeweiligen individuellen Existenz mit ihren nicht mitteilbaren, "vermittelbaren" Vorhaben. Diese Geschichte von der Beliebigkeit des großen Traums lehrt auch die größere Beliebigkeit all dessen, was diesen Traum nicht erfüllt (die Beliebigkeit der anderen Inseln). So kann Annette Pehnt mit traumwandlerisch sicherer Sprache demonstrieren, daß ein derartiger Roman keine Plausibilität braucht, keine Psychologie, kaum eine Handlung - außer der Route, der Richtung hinaus. "Wer etwas Unendliches will, der weiß nicht, was er will", sagt Friedrich Schlegel.
Nach dem im Grund nur dekorativen "leisen Humor" ihres ersten Buches "Ich muß los" hat die Autorin nun ein wirklich erstaunliches und makelloses kleines Werk verfaßt. Sie hat den Genüssen des kokett Pittoresken entsagt und sich ganz dem unerschöpflichen Zauber der Banalität verschrieben. Und sie hat ein ästhetisches Prinzip beherzigt, das Mr. Pickwicks Diener Sam Weller einmal sehr schön zusammenfaßt. Als sein Herr fragt, ob der Brief, den Sam an seine Freundin geschrieben hat (und der nur aus einem lapidaren Satz besteht), denn nicht zu kurz sei, antwortet er: "Aber nie. Sie wird sich wünschen, daß noch mehr da stehen sollte, und das ist die große Kunst des Briefeschreibens."
Annette Pehnt: "Insel 34". Roman. Piper Verlag, München 2003. 189 S., geb., 16,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
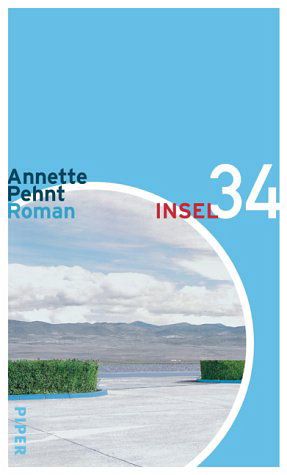




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 07.10.2003
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 07.10.2003