hingebungsvolles Opfer für das Gemeinwohl zu stilisieren.
Doch Joyce Carol Oates will nicht bekannte Rituale der Heldenverehrung wiederholen. Dem Mythos des American dream, der Glückseligkeit für jedermann proklamiert, am meisten jedoch für die Wohlhabenden und Erfolgreichen, mißtraut sie seit langem; und so erzählt sie auf den restlichen sechshundert Seiten ihres neuen Buches davon, wie schnell das geordnete Leben einer gutsituierten New Yorker Vorortgemeinde durch Adams Tod durcheinandergewirbelt wird.
In dem schmucken Städtchen Salthill, eine halbe Autostunde nördlich von Manhattan gelegen, hatte Adam seit langem als bewunderter Außenseiter gelebt. Im Milieu der saturierten Geschäftsmänner, Ärzte und Juristen und ihrer ebenso gepflegten wie gelangweilten Gattinnen war der einäugige Bildhauer mit dem "Neandertalergesicht" als bunter Paradiesvogel auf allen Parties willkommen gewesen, die Damen der Gesellschaft hatten um seine Liebe, die Herren um seine Freundschaft geworben. Für sie alle aber war der Künstler in ihrer Mitte ein Beweis dafür, daß sich der Sinn ihres Daseins nicht in Unternehmensbilanzen und Cocktaileinladungen erschöpft.
Nach jenem ereignisreichen 4. Juli jedoch gerät das einstudierte Leben der Kleinstädter aus der Balance. Die Trauer um Adams Tod und die überraschenden Details aus seinem Nachlaß - der scheinbar mittellose Künstler besaß ein großes Vermögen, von dem niemand etwas ahnte - werden zum Katalysator für so heftige Leidenschaften, wie sie die biederen Bewohner Salthills bislang womöglich tatsächlich nicht gekannt, aber gewiß niemals in der Öffentlichkeit gezeigt haben. Mit satirischer Schärfe eröffnet Oates entlarvende Einblicke in die Spielregeln der feinen Gesellschaft, deren Angehörigen viel daran liegt, jahrzehntelang einem schwer definierbaren "mittleren Alter" anzugehören. Auf einen Schlag jedoch bricht im Salthiller Establishment eine kollektive Midlife-crisis aus, die zu immer turbulenteren Verwicklungen führt.
Brave Ehepartner verlassen da mit einem Mal ihre scheinbar intakten Bindungen und stürzen sich Hals über Kopf in abenteuerliche Affären; Eltern verzweifeln an der Aufsässigkeit ihrer halbwüchsigen Kinder, die einstmals so gehegten Anwesen verwahrlosen, und der allgemeine Klatsch findet überall reichliche Nahrung. Das alles liest sich amüsant und unterhaltsam, zumal Oates eine einfallsreiche Erzählerin ist und auch vor manch makabrer Pointe nicht zurückscheut. Besonders angetan hat es ihr das ehrenamtliche soziale Engagement, in dem so viele Angehörige der amerikanischen Oberschicht Anerkennung und Selbstbestätigung suchen. Daß solch vorbildliches Tun böse Folgen haben kann, zeigt das Beispiel des erfolgreichen Geschäftsmannes Lionel. Während er zunehmend den Reizen seiner dunkelhäutigen Krankengymnastin verfällt, verwandelt seine unscheinbare Frau das gemeinsame Haus in ein Asyl für streunende Hunde. Das aber bekommt dem Hausherrn schlecht, denn am Ende wird er von den Schützlingen seiner Gattin zerfleischt wie einst der lüsterne Aktäon von den Hunden der Diana.
Die sinnliche Augusta schließlich, die Adam stets freizügigere Angebote als alle anderen Frauen gemacht hatte, bricht nach seinem Tod unversehens zu einer Entdeckungsreise quer durch die Vereinigten Staaten auf, was ihrem ratlosen Ehemann große Sorgen bereitet und ihn zum Orchideenzüchter aus Verzweiflung werden läßt, ihr aber allerlei erotische Abenteuer beschert und am Ende die ernüchternde Erkenntnis, daß die tiefe Bewunderung der Salthiller Bürger für den Bildhauer nichts als eine kollektive Phantasie gewesen ist. Nach einer langen Spurensuche erweist er sich nämlich keineswegs als der große Ausnahmemensch, als den ihn seine Mitbürger sehen wollten, sondern ihre Recherchen offenbaren der enttäuschten Augusta die klägliche Banalität eines unspektakulären Lebenslaufes, zu dessen frühen Erfahrungen Armut, Gewalt und Gefängnishaft gehören.
So könnte die Lektüre des Romans eigentlich ein uneingeschränktes Vergnügen sein. Englischsprachigen Lesern wird dieser Genuß unmittelbar zuteil; wir müssen uns hierzulande jedoch mit einer Übersetzung herumschlagen, die die flüssige Sprache des Originals mit der stilistischen Schwerfälligkeit von Schulaufsätzen wiedergibt. Man mag es ja noch hinnehmen, daß die Romanfiguren unter einem "opaken" Himmel ihren Leidenschaften nachgehen und über die Verwerflichkeit von "Kriminellen mit weißem Kragen" nachdenken, womit natürlich Wirtschaftskriminalität ("white collar crimes") gemeint ist, nicht etwa eine besondere Sorgfalt in der Körperpflege. Unverständlich muß die Sorglosigkeit bleiben, mit der die Übersetzerin Redewendungen Wort für Wort ins Deutsche überträgt. Häusermakler sind beim besten Willen keine "Grundstücksentwickler", und wenn auf einer Einladungskarte der dezente Hinweis "black tie" zu lesen ist, dann hat dies nicht allein Folgen für Farbe und Form der Krawatte, sondern bestimmt die gesamte Abendgarderobe: Smoking für die Herren (mit schwarzer Fliege!), Cocktailkleid für die Damen. Man muß nicht im Ausland gelebt haben, um diesen Kleidungscode zu verstehen; ein Blick in Langenscheidts "Großes Schulwörterbuch" hätte es auch getan.
SABINE DOERING
Joyce Carol Oates: "Hudson River". Roman. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Silvia Morawetz. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2003. 608 S., geb., 24,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
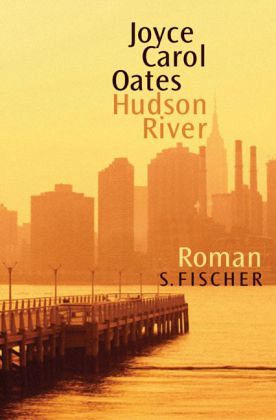




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 18.06.2003
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 18.06.2003